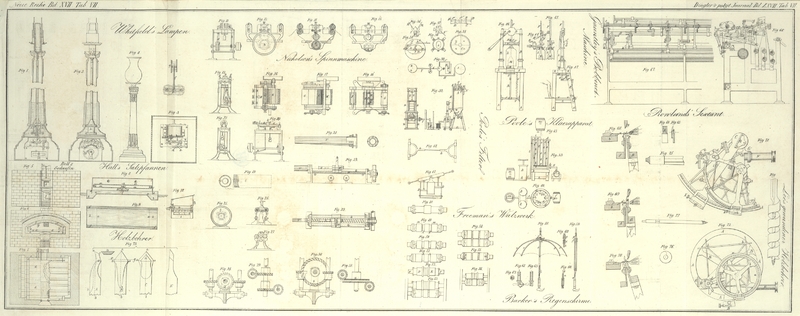| Titel: | Verbesserter Mechanismus zur Erzeugung der Parallelbewegung der Kolbenstangen an den Lampen, welcher auch auf andere Parallelbewegungen anwendbar ist, und worauf sich Thomas Bradshaw Whitfield, Lampenfabrikant im New Street Square, Grafschaft Middlesex, am 4. März 1837 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. CIX., S. 414 |
| Download: | XML |
CIX.
Verbesserter Mechanismus zur Erzeugung der
Parallelbewegung der Kolbenstangen an den Lampen, welcher auch auf andere
Parallelbewegungen anwendbar ist, und worauf sich Thomas Bradshaw Whitfield, Lampenfabrikant im
New Street Square, Grafschaft Middlesex, am 4.
Maͤrz 1837 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Februar
1838, S. 65.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Whitfield's verbesserte Lampen.
Meine Erfindung besteht: 1) in der Zusammensezung eines Apparates, womit die
Parallelbewegung der Kolbenstangen an den Pumpen der Lampen bewirkt wird. 2) in der
Anwendung eines aͤhnlichen Mechanismus auf die Pumpen im Allgemeinen. 3)
endlich in einem aͤhnlichen Mechanismus, womit von einer rotirenden Bewegung
her eine Stange oder ein anderer derlei Theil einer Maschine eine Parallelbewegung
mitgetheilt erhalten soll.
In Fig. 1 sieht
man einen Durchschnitt einer mit meiner Erfindung ausgestatteten Tafellampe. Fig. 2 ist
gleichfalls ein theilweiser Durchschnitt: jedoch von der Fig. 1 entgegengesezten
Seite. Fig. 3
ist ein Grundriß der Vorrichtung, womit der Kolben der Pumpe in Bewegung gesezt
wird. Fig. 4
endlich zeigt die Lampe im Aufrisse. An saͤmmtlichen Figuren beziehen sich
gleiche Buchstaben auf gleiche Theile.
Die Pumpe der Lampe erhaͤlt ihre Thaͤtigkeit durch eine Feder, die
jener eines Uhrwerkes aͤhnlich ist, und welche, wie die Zeichnung andeutet,
ein Raͤderwerk in Bewegung sezt. Zur Regulirung der Geschwindigkeit des
Raͤderwerkes dienen die Fluͤgel a, a, in
denen nichts Neues gelegen ist. Die beiden, in einander eingreifenden
Zahnraͤder b, b haben gleiche Durchmesser, und
bewegen sich folglich auch mit gleichen Geschwindigkeiten. Sie erhalten ihre
Bewegung von dem Getriebe c, und an ihnen sind in
gleichen Entfernungen von ihren Mittelpunkten die Zapfen d, d angebracht, an
denen sich Reibungsrollen befinden, damit die Bewegung so sanft als moͤglich
werde. Die Zapfen d, d bewegen sich in einer
gefensterten Stange e, so daß also diese Stange, so wie
die Raͤder b, b umlaufen, sich parallel mit sich
bewegt; und da an dieser Stange die Kolbenstange f
befestigt ist, so wird sich leztere, wie aus der Zeichnung deutlich hervorgeht,
stets in gerader Linie und parallel mit dem Pumpencylinder g,
g auf und nieder bewegen muͤssen. Dieser Cylinder selbst ist in
einem Gehaͤuse h, h angebracht, welches sich
innerhalb des Fußes der Lampe befindet. Mit dem oberen Theile dieses
Gehaͤuses steht die zur Speisung des Brenners dienende Roͤhre i in Verbindung, welche auf einige Entfernung In dieses
Gehaͤuse hinabreicht. Es soll auf diese Weise uͤber der in dem
Gehaͤuse befindlichen Fluͤssigkeit ein Raum erzielt werden, und die in
diesem Raume enthaltene Luft soll wie ein gewoͤhnliches Luftgefaͤß zur
Ausgleichung der an den Brenner fließenden Menge Oehl dienen. An dem Gehaͤuse
h, h bemerkt man die beiden Eintrittsventile j, j und die beiden Austrittsventile k, k. Erstere oͤffnen sich in den Fuß der Lampe,
in den das Oehl bei der oben befindlichen Oeffnung eingetragen wird; die
Austrittswege der lezteren hingegen oͤffnen sich in die obere Kammer des
Gehaͤuses h und folglich in die Roͤhre i, wie dieß die Zeichnung deutlich anzeigt. Das
Gehaͤuse h ist durch eine Scheidewand in zwei
Kammern abgetheilt, damit die Ventile richtig arbeiten. Im Falle die Pumpe mehr Oehl
emportreibt, als verbrannt wird (was in einem geringen Grade der Fall seyn soll), so
fließt der Ueberschuß durch die Oeffnungen l, welche
sich da befinden, wo die Lampe mit frischem Oehle oder einem anderen Brennmaterials
gespeist wird, in den Fuß zuruͤk.
Ich nehme die hier beschriebenen Theile nicht einzeln fuͤr sich, und auch nur
in der angegebenen Verbindung als meine Erfindung in Anspruch, beschraͤnke
mich aber keineswegs auf den Bau der Lampe, noch auch auf eine Methode deren Pumpe
in Bewegung zu sezen, da diese mannigfach abgeaͤndert werden kann. So erhellt
aus der gegebenen Beschreibung mit Beihuͤlfe der Zeichnung, daß der
Pumpenstiefel g und das Gehaͤuse h, anstatt in dem Fuße einer Lampe untergebracht zu
seyn, auch mit einem Brunnen oder irgend einem anderen Wasserbehaͤlter in
Verbindung gebracht werden kann, und daß sich an diesem meine Erfindungen,
naͤmlich die Theile b, b, d, d und e befinden koͤnnen, um eine Parallelbewegung der
Kolbenstange innerhalb des Cylinders zu erzielen. Eine solcher Maßen mit meiner
Vorrichtung ausgestattete Pumpe laͤßt sich mannigfach benuzen, und anstatt
dieselbe durch ein Raͤderwerk in Bewegung zu sezen, kann das Getrieb c mit einer Kurbel umgetrieben werden; oder man kann die Kurbel direct
an eine der Achsen der Raͤder b, steken, oder man
kann die Bewegung mittelst eines Treibriemens oder auf irgend andere Weise erzielen.
Was die Anwendung meiner Vorrichtung auf Maschinen betrifft, so habe ich nur zu
bemerken, daß in Faͤllen, wo eine Stange wie e
entweder fuͤr sich allein oder mit Theilen, die einer Kolbenstange
aͤhnlich sind, in paralleler Richtung bewegt werden soll, mein Mechanismus
sachdienlich erscheint, und auch je nach Umstaͤnden angebracht werden
kann.
Tafeln