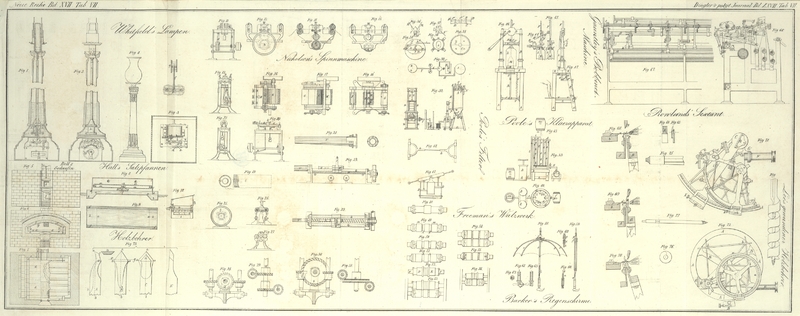| Titel: | Verbesserungen in der Zubereitung gegohrener Flüssigkeiten, worauf sich Moses Poole, am Patent-Office, Lincoln's Inn in der Grafschaft Middlesex, am 21. März 1837 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. CXIII., S. 425 |
| Download: | XML |
CXIII.
Verbesserungen in der Zubereitung gegohrener
Fluͤssigkeiten, worauf sich Moses Poole, am Patent-Office, Lincoln's Inn in der Grafschaft
Middlesex, am 21. Maͤrz 1837 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Februar
1838, S. 82.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Poole's Klaͤrmethode fuͤr gegohrene
Fluͤssigkeiten.
Meine Verbesserungen betreffen: 1) eine verbesserte Methode gegohrne
Fluͤssigkeiten zu klaͤren; und bestehen 2) darin, daß ich diesen
Fluͤssigkeiten unmittelbar nach ihrem Verfuͤllen in Flaschen ein so
helles und klares Aussehen gebe, als sie haben, wenn sie laͤnger in
Faͤssern oder dergleichen gelegen, dann abgezogen, und hierauf abermals
laͤnger aufbewahrt wurden. Die Fluͤssigkeiten werden auf diese Weise
unmittelbar nach geschehener Verfuͤllung zum Verschleiße geeignet.
Ich schreite zuerst zur Beschreibung meiner Klaͤrmethode, die ich mit einem
Apparate bewerkstellige, den man in Fig. 40 im Grundrisse und
in Fig. 33 in
einer seitlichen Ansicht sieht. Das Gefaͤß a hat
einen Dekel d, womit ein Filtrum, welches ich
spaͤter beschreiben werde, in Verbindung steht. m' ist ein Behaͤlter, der zur Speisung des Filtrums dient, und den ich,
wie Fig. 43
zeigt, in gehoͤriger Hoͤhe anbringe, wenn die Umstaͤnde dieß
gestatten. Waͤre nicht hinreichender Raum hiefuͤr vorhanden, so
bewirke ich die Speisung des Filters mittelst der Drukpumpe k von dem Behaͤlter m aus. Das Filter
b besteht aus einem Sake aus Filz oder aus einem
haarenen Zeuge oder aus irgend einem anderen, zum Filtriren geeigneten Stoffe, und
ist in einen Drahtsak von gleicher Groͤße eingepaßt, damit es dem von Oben
auf dasselbe wirkenden Druke besser widerstehen kann. Der Filtrirsak wird mit
metallenen Staͤben an Ort und Stelle erhalten, und ist sammt seinem
Drahtuͤberzuge so in den Dekel d, d eingepaßt,
daß die Fluͤssigkeit nur durch das Filtrum entweichen kann. In der Mitte des
Dekels befindet sich ein Loch, und dieses dient zur Aufnahme einer Roͤhre,
durch welche die Fluͤssigkeit entweder von dem Behaͤlter m' her durch die Roͤhre n', oder von dem Behaͤlter m her durch
die Roͤhre l in das Filtrum gelangt. Das Filtrum
fuͤllt das Gefaͤß nicht ganz aus, sondern es ist sowohl an dessen
Seiten, als auch am Boden ein Raum gelassen, in welchem sich die Fluͤssigkeit
ansammelt, bevor sie durch die Roͤhre g in das zu
deren Aufnahme bestimmte Gefaͤß f gelangt. Die
Roͤhre g ist mit einem Hahne versehen. Das
Gefaͤß f ruht auf der Unterlage i; das Gefaͤß a
hingegen auf der Unterlage b', b'. Wenn die Operation beginnt, so wird der Dekel d, d und das Filtrum b, b so hergerichtet, daß
durchaus keine atmosphaͤrische Luft darin enthalten ist. Die
Fluͤssigkeit gelangt, waͤhrend sie noch gaͤhrt, entweder von
dem Behaͤlter m' oder von dem Behaͤlter
m her in das Filtrum.
Zur Bewerkstelligung des zweiten Theiles meiner Erfindung dient der in Fig. 32
abgebildete Apparat. Das die Fluͤssigkeit enthaltene Gefaͤß A, welches ich den Napf (amphora) nenne, ruht auf dem Gestelle B, und
enthaͤlt den Kolben C. Es hat einen Dekel D, von dem die Spindel E und
auch die Arme F auslaufen. G
ist eine Schraube und eine Schraubenmutter. Durch die Roͤhre H wird atmosphaͤrische Luft auf den Kolben C getrieben. Der Hebel I des
Sicherheitsventiles L ist mit dem Gewichte K ausgestattet. Der Barometer N deutet den Druk der atmosphaͤrischen Luft, welche zwischen dem
Kolben C und dem Dekel D
enthalten ist, an. O ist der untere Hahn;
waͤhrend P jenen Hahn bezeichnet, bei dem die
Fluͤssigkeit in Flaschen verfuͤllt wird. Q
sind die Saͤulen der Maschine, welche das Verkorken bewerkstelligt, und
welche auf dem Gestelle R ruht. Durch die Roͤhre
S wird Luft in die Flaschen getrieben. T ist der Hahn der zum Verkorken dienenden Maschine. Der
Luftbehaͤlter U wird von der Drukpumpe V aus mit Luft gespeist, wobei der Barometer X den Druk der Luft andeutet. Y ist die Welle der Dampfmaschine Z.
In Fig. 34
sieht man bei A' die Muͤndung des Gefaͤßes
oder Napfes, und bei B dessen Gestell.
In Fig. 35 ist
C der Kolben. B' sind
Bolzen; S' ist ein Ventil und D' ein lederner Ring.
In Fig. 36 ist
E' der Kopf des Bolzens; F' ein Loch im Bolzen, durch welches die Fluͤssigkeiten entweichen;
I' ein zulaufender Schraubenring; M' der untere Theil des Napfes.
In Fig. 37 ist
G' der seitliche Hahn des Bolzens; H' ein Loch, durch welches die Fluͤssigkeit entweicht; L' ein lederner Ring; N' ein
Theil des Napfes.
In Fig. 38 ist
D die Muͤndung des Napfes A: F sind die Arme des Dekels; H ist eine Roͤhre fuͤr den Durchgang der
atmosphaͤrischen Luft; N ein Barometer; L das Ventil und I der
Hebel.
In Fig. 39
endlich ist Z die Dampfmaschine mit deren Welle Y: V, V die Pumpe; U der
Behaͤlter fuͤr die comprimirte Luft, die durch die Roͤhre S in die Flasche getrieben wird, waͤhrend sie
durch die Roͤhre H in den Napf gelangt, um auf
den daselbst befindlichen Kolben einen Druk auszuuͤben. R ist der untere Theil der zum Verkorken dienenden
Maschine Q. W ist die Stelle, auf die der Arbeiter die
Flasche in die Maschine bringt. Waͤhrend der Fuͤllung wird eine
Schuzwehr vor die Flasche gesezt, damit durch das allenfallsige Zerplazen einer
Flasche keine Beschaͤdigungen hervorgebracht werden koͤnnen.
Man bedient sich des zweiten Theiles meines Apparates auf folgende Weise. Die
gegohrene Fluͤssigkeit befindet sich, wenn sie durch den beschriebenen
Klaͤrapparat gegangen ist, zwar in einem zum Verfuͤllen geeigneten
Zustande; allein um ihr ein besseres, schaͤumendes Ansehen zu geben, bringe
ich den zweiten Apparat in Anwendung. Ich gebe sie zu diesem Behufe in das
Gefaͤß oder in den Napf A, A, der vom Dekel D bis zum Hahne P
cylindrisch ist; von hier aber nach Unten zu unter einem Winkel von
beilaͤufig 30° kegelfoͤrmig zulaͤuft. Die
Fluͤssigkeit muß, um den gewuͤnschten Zwek zu erreichen, so viel
gaͤhrungsfaͤhigen Bestandtheil enthalten, daß sich reichliches
kohlensaures Gas aus ihr entwikeln kann. Dieses Gas muß in der Fluͤssigkeit
zuruͤkgehalten werden, und deßhalb muß auch das Gefaͤß der
Expansivkraft desselben widerstehen. Es ist zu diesem Zweke mit einem Dekel D verschlossen, den man in Fig. 38 im Grundrisse
sieht, der mittelst der Arme F an Ort und Stelle
erhalten wird, und der mittelst der Schraube G so dicht,
als man es fuͤr geeignet haͤlt, an den oberen Theil des Cylinders
angedruͤkt wird. In dem oberen Theile des Dekels befinden sich zwei
Oeffnungen, die in Fig. 38 mit L und K bezeichnet sind. Ersteres dient zur Aufnahme des Sicherheitsventiles,
welches das uͤberschuͤssige kohlensaure Gas entweichen laͤßt;
lezteres dient zur Aufnahme der Roͤhre H, deren
Zwek sogleich naͤher angegeben werden soll. Die Muͤndung P ist so geformt, daß sie genau an den Hahn T der Verkorkungsmaschine Q
paßt. Innerhalb des Napfes oder Gefaͤßes befindet sich ein Kolben oder eine
Platte, die mit ihr beinahe einen und denselben Durchmesser hat, und die sich in dem
cylinderfoͤrmigen Theile A des Napfes nach Art
eines Kolbens einer Dampfmaschine auf und nieder bewegt. Man sieht diese Platte, in deren Mitte sich
eine Oeffnung befindet, die mit einem Ventile von maͤßiger Schwere
verschlossen ist, in der Zeichnung in ihrer oberen, durch Punkte angedeutet hingegen
in der unteren Stellung.
Wenn der Napf leer ist, so wird er auf folgende Weise gefuͤllt. Man
oͤffnet, wenn der Dekel D, D gehoͤrig
adjustirt ist, das Sicherheitsventil L, damit die Luft
entweichen kann; jene, die sich unter dem Kolben oder unter der Platte befindet,
entweicht durch die Oeffnung S, die, wie gesagt, mit
einem maͤßigen Gewichte beschwert ist. Wenn dieß geschehen ist, so bringt man
an die Stelle des Hahnes T eine Roͤhre T', durch welche die zu behandelnde Fluͤssigkeit
in den Napf geleitet wird. Hiedurch wird die Platte ungeachtet ihrer Reibung an den
Seitenwaͤnden aus der unteren Stellung bis an den Dekel D emporgetrieben.
Mit der in dem Napfe enthaltenen Fluͤssigkeit geht hiebei Folgendes vor. Sie
entwikelt, da sie, wie gesagt, eine Quantitaͤt
gaͤhrungsfaͤhigen Stoffes enthalten muß, kohlensaures Gas und Hefen.
Da das Gefaͤß das Gas nicht entweichen laͤßt, und da dasselbe also in
der Fluͤssigkeit zuruͤkbleibt, so fallen die Hefen in dem Maaße, als
sie erzeugt werden, und in Folge des Drukes, den die Expansivkraft des kohlensauren
Gases in der Fluͤssigkeit ausuͤbt, auf den Boden des Napfes nieder.
Das kohlensaure Gas wuͤrde bei der Trennung der Hefen von der klaren
Fluͤssigkeit das Ganze aufruͤhren: dieß zu verhuͤten ist die
Aufgabe der Kolbenplatte. Sie leistet dieß, indem man einen Druk auf sie wirken
laͤßt, der dem Druke des kohlensauren Gases gleichkommt. Ich lasse zu diesem
Zweke eine auf 6 1/2 Atmosphaͤren comprimirte Luft auf die Platte wirken, und
diese liefert mir die mit Z, Z, Z bezeichnete
Dampfmaschine. Ich beschraͤnke mich uͤbrigens nicht auf die Anwendung
dieser lezteren allein; da die Luft auch auf andere Weise in erforderlichem Grade
comprimirt und durch die Roͤhre H, H in den Napf
getrieben werden kann. Das Sicherheitsventil, dessen Belastung den auf die
Fluͤssigkeit wirkenden Druk andeutet, dient zur Regulirung des Luftzutrittes
zu dem Napfe.
Die Hefen sezen sich demnach unter dem Hahne P auf dem
Boden des Napfes ab, waͤhrend die Fluͤssigkeit mit kohlensaurem Gase
gesaͤttigt wird. Ich habe also nur noch zu zeigen, wie die
Fluͤssigkeit ohne Verlust an Gas in Flaschen verfuͤllt wird. Ich habe
schon oben bemerkt, daß die Oeffnung P so geformt ist,
daß der Hahn genau in sie einpaßt. Diese Oeffnung nun wird, wie Fig. 37 zeigt, auf
folgende Weise geoͤffnet und geschlossen. Der Theil G' ist seiner Laͤnge nach bis auf sine gewisse Entfernung von dem
Kopfe hohl, und mit
Loͤchern L versehen, die in der aus Fig. 37
ersichtlichen Stellung durch den Ring L', L' verschlossen sind. Der vierelige Theil H', G' laͤßt sich
mittelst eines gewoͤhnlichen Schluͤssels umdrehen, wodurch bewirkt
wird, daß die aus den beiden Loͤchern L', L' entweichende Fluͤssigkeit durch die
Roͤhre T' in den Napf zuruͤkkehrt und
unter rechten Winkeln in denselben eintritt. Zum Behufe dieser Operation wird der
Hahn geoͤffnet. Wenn die Fluͤssigkeit verfuͤllt werden soll, so
stekt man den Hahn T' an den Hahn P, und treibt lezteren auf einige Entfernung in die Fluͤssigkeit
ein, wo dann die Operation folgender Maßen von Statten geht. Man nimmt, wie Fig. 44, 45, 46 und 47 zeigen,
eine Flasche M und sezt sie unter den Hahn, dessen
Muͤndung kegelfoͤrmig gestaltet und mit Leder oder einem anderen
entsprechenden Materiale so ausgefuͤttert ist, daß, wenn man den Hals der
Flasche in dessen inneren Theil stekt, alle Communication mit der
atmosphaͤrischen Luft aufgehoben ist. Ist dieß geschehen, so druͤkt
der Arbeiter mit seinem Fuße den Tretschaͤmel T
herab. Die Folge hievon ist, daß die Verbindungsstange R
herabgezogen wird, und daß der Hebel P, P in
Thaͤtigkeit kommt. Hiedurch wird bewirkt, daß die Verbindungsstange O, welche an dem Bloke, auf den die Flasche gesezt
worden, fixirt ist, emporgetrieben wird. Der auf den Tretschaͤmel
ausgeuͤbte Druk wirkt auf die Feder U, U, und
veranlaßt hiedurch, daß der Blok gegen den Boden der Flasche und deren Hals also
gegen die kegelfoͤrmige Muͤndung des Hahnes angedruͤkt wird.
Ist dieß geschehen, so fuͤhre ich einen Pfropf in den Hals G ein, der senkrecht uͤber dem Halse der Flasche
in dem Hahne gebildet ist, und senke dann mittelst des Griffes E den Kolben I herab, damit
er den Pfropf in den oberen Theil des Hahnes eintreibt, ohne daß
atmosphaͤrische Luft zutreten kann. Wenn auch dieß geschehen ist, wobei
sorgfaͤltig darauf zu achten, daß der Pfropf nicht uͤber die Oeffnung
K herab gelangt, so fuͤlle ich die Flasche
durch den Hahn G von dem Napfe aus, und nach
vollbrachter Fuͤllung schließe ich den Hahn, und treibe den Kolben I mittelst des Griffes E
herab, damit der Kork aus dem Halse des Hahnes in den Hals der Flasche
eingedruͤkt wird.
In Fig. 44,
45, 46 und 47 ist A das Gestell; B die
Saͤule; C der Traͤger des Hahnes G: D das Querhaupt des Gestelles, an dem der Griff E angebracht ist; L die
Schuzvorrichtung bei allenfallsigem Zerplazen der Flasche; T der Tretschaͤmel; F die an dem Kolben
I angebrachte Zahnstange; V die Muͤndung des Hahnes; G der Hahn;
N' die Roͤhre, durch welche die
Fluͤssigkeit in die Flasche geleitet wird; Q die
Communication mit dem Sicherheitsventile R', dessen Arm
mit S bezeichnet ist, und an welchem man das Gewicht T' angehaͤngt sieht; H der
Griff des Hahnes G: M die Flasche, die auf dem Bloke b ruht, dessen Boden mit N
bezeichnet ist; Y der Traͤger des Hahnes; O die von dem Hebel P an den
Blok b fuͤhrende Verbindungsstange; d der Traͤger des Hebels P: R die Verbindungsstange von lezterem an den Tretschaͤmel R: g der Zapfen, um den sich der Tretschaͤmel
dreht; U die Feder, und V
der innere Theil der Muͤndung des Hahnes.
Ich nehme keinen der einzelnen Theile fuͤr sich allein in Anspruch, binde mich
aber auch an keine bestimmte Verbindung derselben, wofern die in obiger Beschreibung
aus einander gesezten Principien aufrecht erhalten werden.
Tafeln