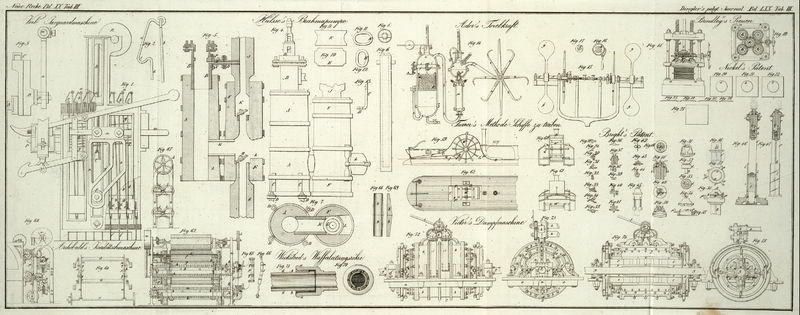| Titel: | Verbesserte rotirende Dampfmaschine, worauf sich Duchemin Victor aus London am 19. März 1838 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XXXVII., S. 164 |
| Download: | XML |
XXXVII.
Verbesserte rotirende Dampfmaschine, worauf sich
Duchemin Victor aus
London am 19. Maͤrz 1838 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, August
1838, S. 65.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Victor's verbesserte rotirende Dampfmaschine.
Meine Erfindung beruht hauptsaͤchlich auf der vereinten Anwendung folgender
Dinge, und zwar: 1) eines constanten Gleichgewichtes des Drukes auf den inneren
concentrischen Cylinder; 2) eines aͤußeren Cylinders, der so gebaut ist, daß
er, welches sein Durchmesser seyn mag und wie groß auch seine Hoͤhe von einer
Basis bis zur anderen ist, den Widerstand gegen den Druk soviel als erforderlich
seyn kann, verhindert; 3) eines Apparates, wodurch jene Theile, auf die der Dampf
seinen Impuls ausuͤbt, die Verrichtungen von Kolben vollbringen, ohne sich an
irgend einer anderen Oberflaͤche als der inneren Cylinderflaͤche zu
reiben, und ohne also eine groͤßere Abnuͤzung zu erleiden als die
gewoͤhnlichen Kolben. Meine Maschine, deren Kraft eine beliebige seyn kann,
ist frei von den Maͤngeln der bisherigen rotirenden Maschinen, und
gewaͤhrt dagegen alle die großen Vortheile, die von einem guten rotirenden
Systeme zu erwarten sind. Dieses System allein beseitigt naͤmlich den großen
Verlust an Kraft, der aus der Umwandlung der geradlinigen Bewegung in eine kreisende
mittelst Anwendung der Kurbel erwaͤchst. Meine Maschine ist, kurz gesagt,
eine durch Dampf oder andere luftfoͤrmige Fluͤssigkeiten zu treibende,
rotirende Maschine mit zwei oder vier beweglichen Kolben, die mittelst einer
aͤußeren mechanischen Vorrichtung in einen inneren concentrischen Cylinder
eintreten, an der dieser Cylinder stets einem gleichen Druke ausgesezt ist, da der
Druk gleichzeitig auf gleiche und gegenuͤberliegende Oberflaͤchen
wirkt, und an welcher der große, innen allerwaͤrts cylindrische Cylinder
nirgendwo zum Behufe des Durchganges eines Kolbens ausgeschnitten ist, so daß er
nicht nur die ganze Staͤrke des Metalles besizt, sondern daß er auch einen
großen Durchmesser, und von einer Basis zur anderen eine große Hoͤhe haben
kann.
Ich besize nicht hinreichende Geldmittel, um meine nach England gebrachte Erfindung
hier im Großen auszufuͤhren. Ich wuͤnsche jedoch sehr, daß dieß
geschehe, indem ich uͤberzeugt bin, daß sie in diesem Falle von allen
Ingenieurs guͤnstig aufgenommen werden wuͤrde, da die unendlichen
Vortheile, welche sie sowohl fuͤr den Fabrikbetrieb, als fuͤr die
Dampfschifffahrt gewaͤhrt, in die Augen fallen. Meine Maschine, welche sich
wegen einer bedeutenden Ersparniß an Brennmaterial hauptsaͤchlich fuͤr
die Dampfschifffahrt eignet, beseitigt nicht nur, wie gesagt, den durch die
Anwendung der Kurbel bedingten Verlust an Kraft, sondern sie nimmt auch bei großer
Leichtigkeit einen sehr kleinen Raum ein. Ich hoffe daher um so mehr, daß sich ein
englischer Ingenieur ihrer Ausfuͤhrung im Großen unterziehen wird, als ich
geneigt bin, ihm alle meine Rechte unter sehr billigen Bedingungen abzutreten.
Ich habe meine Maschine in der gegenwaͤrtiger Beschreibung beigegebenen
Zeichnung als mit vier, den Impuls des Dampfes erhaltenden Kolben versehen,
dargestellt, indem ich diese Einrichtung fuͤr die Dampfschifffahrt am
geeignetsten halte. Die Kraft ist naͤmlich bei gleichem Umfange
groͤßer und in jedem Theile des Laufes eine und dieselbe, da der Dampf stets
auf zwei dieser Kolben seinen Nuzeffect ausuͤbt. Ich glaube, daß diese
Maschine hauptsaͤchlich dann eine große Reform in der Dampfschifffahrt
bewirken duͤrfte, wenn sie mit Dampf arbeitet, der in Kesseln erzeugt wird,
welche aus einer großen Menge kleiner Roͤhren bestehen, die eine große
Heizoberflaͤche darbieten, und welche also im Vergleiche mit der in ihnen
enthaltenen Wassermasse eine große Menge Dampf erzeugen. Diese Kessel, die dem
Bersten nicht ausgesezt sind, lassen sich selbst auf weiten Seereisen leicht mit
Suͤßwasser speisen, wenn man den verbrauchten Dampf in Roͤhren, die
außen am Schiffe unter der Wasserlinie hinlaufen, verdichtet und das verdichtete
Wasser wieder in den Kessel pumpt. Zum Fabrikbetriebe seze ich meine Maschine
dagegen lieber aus zwei Kolben zusammen, indem ich in diesem Falle vorziehe,
waͤhrend eines Theiles der Bewegung von der Ausdehnung des Dampfes Nuzen zu
ziehen. Es wird dann ein Schwungrad und ein Schieber noͤthig, der die
gewuͤnschte Zeit uͤber den Dampf einstroͤmen laͤßt.
Stets muͤßte aber der Dampf in dem Momente abgesperrt werden, in welchem die
beweglichen Kolben an den in dem großen Cylinder fixirten Scheidewaͤnden
voruͤbergehen. Dessen ungeachtet kann man auch mit dieser Maschine unter
Anwendung von jedwedem Druke und mit Verdichter und Luftpumpen arbeiten. Auch ließe
sie sich ebenso gut mit Gasen betreiben, im Falle man welche ausmitteln
koͤnnte, die wohlfeiler zu stehen kommen als der Dampf.
Fig. 72 ist
ein Aufriß der Maschine; Fig. 73 zeigt dieselbe
von der Seite betrachtet. Fig. 72 ist ein
Durchschnitt nach der Linie C, D, und Fig. 75 ein solcher nach
A, B, A, C. Saͤmmtliche Theile, aus denen die Maschine
zusammengesezt ist, ruhen auf der Grundplatte a. Auf ihr
bemerkt man zuvoͤrderst den aͤußeren oder großen Cylinder b; dieser ist an beiden Enden, wie man in Fig. 74 sieht,
mittelst eines Ringes geschlossen, der zugleich auch den fixirten und unebenen Theil
einer Stopfbuͤchse bildet. Der zwischen diesem und dem inneren Cylinder
befindliche Raum ist durch Scheidewaͤnde, welche gegen den Druk des Dampfes
Widerstand leisten, in zwei gleiche Theile geschieden. Diese Scheidewaͤnde
sind mit Platten ausgestattet, die in Hinsicht auf Laͤnge der Hoͤhe
des inneren Cylinders gleichkommen, und an denen eine solche Anordnung getroffen
ist, daß jener Theil, der sich allmaͤhlich und zur Ersezung des
Abgenuͤzten annaͤhert, stets dieselbe Laͤnge haben kann. Auf
diese Platten, welche zur Erzielung eines genauen Verschlusses dienen, wirken
bestaͤndig kleine Federn. Der innere und concentrische Cylinder c ist an dem Wellbaume befestigt. Seine vier Arme, Fig. 75, sind
nach Außen zu verlaͤngert, Fig. 72 und 74, und ihrer
ganzen Laͤnge nach so tief gespalten, Fig. 74, daß die Kolben,
welche die der Welle mitzutheilende Bewegung von dem Dampfe her erhalten, in
dieselben eindringen koͤnnen, wenn sie an den Scheidewaͤnden, Fig. 75,
voruͤbergehen. Diese Kolben sind so an den Enden, Fig. 75, angebracht, daß
der Ring, der einen Theil der Stopfbuͤchse bildet, Fig. 73 und 74, dessen
Oberflaͤche polirt ist, und der sich selbst mit dem inneren Cylinder bewegt,
fixirt werden kann. An den Enden der Arme, Fig. 72, 74 und 75, befinden sich auch
kleine Platten, welche dem Dampfe den Austritt zu versperren haben. Die beweglichen,
die Stelle der Kolben vertretenden Theile, Fig. 74 und 75, sind an
den Scheidewaͤnden mit Platten versehen, auf welche stets kleine Federn
druͤken. Diese Platten, in Verbindung mit einer eigenthuͤmlichen
Einrichtung der Enden des Cylinders, Fig. 74, bedingen zu
beiden Seiten einen gaͤnzlichen Verschluß. Das Hervortreten dieser Platten
ist durch kleine Zapfen, Fig. 74,
beschraͤnkt. Kleine Austiefungen, welche zu beiden Seiten an den Armen, Fig. 74 und
75,
angebracht sind, dienen zur Verhinderung der Reibung der Kolben. d ist ein Kreuz, dergleichen an jedem Ende des Cylinders
eines an der Welle aufgezogen ist. An der Mitte eines jeden Armes des Kreuzes ist
den Kolben genau gegenuͤber ein zur Fuͤhrung dienender Schieber, Fig. 73 und
74,
angebracht, der an der einen Seite mittelst einer Walze seine Bewegung mitgetheilt
erhaͤlt, und sie an der anderen Seite mittelst einer durch eine kleine
Stopfbuͤchse laufenden Stange an die Kolben fortpflanzt. Die Stuͤke,
in denen sich die Walzen drehen, und die ihren Mittelpunkt in der Achse der Maschine
haben, sieht man bei e. Zu jeder Seite des Cylinders und
außerhalb der Kreuze ist auf der Grundplatte eines dieser Stuͤke befestigt. Die
Walzen, welche die Bewegung an den Schieber und dann an die Kolben fortpflanzen,
laufen in der Achse parallelen Fuͤhrern, Fig. 73, in jenen
Theilen, welche den Scheidewaͤnden gegenuͤber und in solchen
Entfernungen von diesen angebracht sind, daß die Kolben an den Scheidewaͤnden
voruͤber gehen koͤnnen, ohne sie zu beruͤhren. f sind die Buͤchsen mit den Anwellen, in denen
die Welle der Maschine laͤuft; sie tragen das Gewicht dieser Welle und sind
mit Regulirschrauben ausgestattet, welche die Welle stets und ungeachtet aller
Abnuͤzung in der geeigneten Stellung erhalten. Die erste von den vier
Schrauben, welche parallel mit der Achse gestellt ist, Fig. 72, 73 und 74, erhaͤlt, indem
sie seitwaͤrts von den Anwellen auf einen an der Welle, Fig. 74, fixirten Ring
druͤkt, die Welle und ferner die Basen des inneren Cylinders in Beziehung auf
jene des aͤußeren Cylinders bestaͤndig in derselben Stellung, obschon
die Kolben so eingerichtet sind, daß aus einer geringen Abweichung von dieser
Stellung kein Nachtheil entstehen kann. Die zur Rechten unterhalb befindliche
Regulirschraube, Fig. 73, dient zum Eintreiben eines Keiles, Fig. 74, damit dieser das
Zapfenlager gradweise emporhebe, wenn sich dasselbe ausgerieben hat. Mit den zur
Rechten, aber etwas hoͤher angebrachten Schrauben, Fig. 73, kann das
Zapfenlager, je nachdem es noͤthig ist, nach Links oder nach Rechts getrieben
werden. Das obere Zapfenlager wird von zweien Bolzen festgehalten, welche zugleich
auch zu starker Befestigung des unteren Theiles der Buͤchse auf der
Grundplatte dienen. Eine an dem unteren und fixirten Theile der Buͤchse
befindliche halbkreisfoͤrmige Oeffnung gestattet, daß man sich so oft als man
will uͤberzeugen kann, ob eine vollkommene Concentricitaͤt besteht.
Die Welle der Maschine, durch welche die Bewegung vermittelt wird, sieht man bei g. h sind die Roͤhren und Haͤhne, durch
die der Dampf in den Cylinder eingelassen wird. Von den beiden Haͤhnen i, Fig. 72 und 74,
laͤßt abwechselnd der eine, und zwar je nach der Richtung, in der die
Maschine arbeitet, den Dampf eintreten, waͤhrend ihm der andere Ausgang
gestartet. Die Roͤhren j dienen abwechselnd
fuͤr den Ein- und Austritt des Dampfes; sie sind, wie man aus Fig. 73 und
75 sieht,
gabelfoͤrmig gebildet, damit der Dampf gleichzeitig an gleichen und diametral
gegenuͤberliegenden Oberflaͤchen eintreten kann; damit er
bestaͤndig und in entgegengesezter Richtung auf zwei der vier Kolben wirken
kann; und damit er, nachdem er seine Wirkung vollbracht, auch gleichzeitig an den
beiden entgegengesezten Seiten austreten kann. Zu bemerken ist, daß, wenn Dampf
austritt, dieß jedes Mal nur in jener Quantitaͤt Statt findet, welche in dem
zwischen zwei Kolben befindlichen Raume enthalten war. Die Roͤhren k gestatten dem verbrauchten Dampfe Austritt.
Diese Maschine ist, wie man hienach sieht, sehr einfach, und alle ihre Theile lassen
sich leicht untersuchen, wenn man die Grundplatte so einrichtet, daß eines ihrer
Enden herabgelassen werden kann, und daß also dem aͤußeren Cylinder ein
Gleiten gestattet ist. Die Maschine laͤßt sich nach beiden Richtungen in
Bewegung sezen, und auch ebenso leicht anhalten, da es dazu lediglich eines Wechsels
in dem Griffe l, Fig. 72, 73, 74, bedarf. Dieser Griff
wirkt naͤmlich zugleich auf die drei Haͤhne, Fig. 72 und 74, und zwar
mittelst dreier Zahnraͤder, von denen das eine 30 und die beiden anderen 40
Zaͤhne haben. In jener Stellung, in der sich der Griff in Fig. 74 befindet, ist der
Hahn h und der zur Linken befindliche Hahn i geoͤffnet, damit der Hahn links durch die
Roͤhren j in den Cylinder eintreten kann,
waͤhrend er rechts durch die Roͤhren j und
durch den Hahn i, der die Communication mit der
Roͤhre k herstellt, austritt. Bei dieser Stellung
des Griffes gestatten die Roͤhren j, Fig. 75, dem
Dampfe Austritt aus der Maschine, die sich von Links nach Rechts dreht. Um die
Maschine zum Stillstehen zu bringen, braucht man mit dem Griffe nur den sechsten
Theil eines Kreises zu beschreiben, d.h. man hat ihn senkrecht zu stellen, indem
dann die Oeffnungen des Hahnes h sowohl zur Linken als
zur Rechten geschlossen sind. Soll sich die Maschine nach der entgegengesezten
Richtung drehen, so hat man den Griff abermal um den sechsten Theil eines Kreises zu
drehen, und zwar nach Rechts, indem dann der Dampf bei den zur Rechten befindlichen
Roͤhren ein- und bei den Roͤhren zur Linken austreten wird. Bei
dieser Stellung werden demnach die Roͤhren j zu
Eintrittsroͤhren fuͤr den Dampf, und die Maschine dreht sich also von
Rechts nach Links.
Tafeln