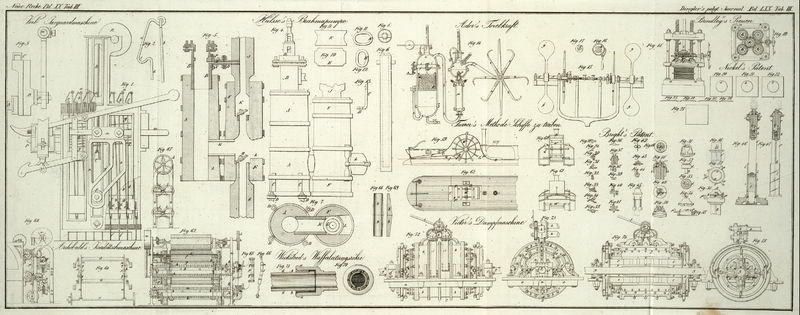| Titel: | Ueber die verbesserte Jacquardmaschine der HHrn. d'Homme und Romagny; von Hrn. Prof. Rabenstein. |
| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XLVI., S. 195 |
| Download: | XML |
XLVI.
Ueber die verbesserte Jacquardmaschine der HHrn.
d'Homme und
Romagny; von Hrn. Prof.
Rabenstein.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Rabenstein, uͤber die verbesserte
Jacquardmaschine.
So gewiß es ist, daß Jacquard genau mit den
Beduͤrfnissen der Weberei bekannt war und diesen zufolge seinem Stuhle eine
bis jezt noch unuͤbertroffene Zwekdienlichkeit gab, so ist derselbe doch in
einzelnen Punkten noch einiger Verbesserungen faͤhig. Unter diese Punkte
gehoͤrt namentlich die Einrichtung, daß die Nadeln durch Spiralfedern gegen
die Karden gedruͤkt werden, wodurch Stoͤrungen beim Gebrauche der
Maschine veranlaßt werden; denn wenn schon uͤberhaupt Federn bei Maschinen
moͤglichst vermieden werden muͤssen, da ihre Spannkraft sich nach und
nach vermindert, so ist auch besonders die Anwendung so vieler einzelner Federn
wegen mangelnder Gleichfoͤrmigkeit der Spannung zu widerrathen.
Durch die Mechaniker d'Homme und Romagny in Paris ist an der Jacquardmaschine eine Einrichtung getroffen
worden, durch welche die Federn entbehrlich gemacht werden. Fig. 1 ist eine
Seitenansicht in 1/4 der natuͤrlichen Groͤße, welche links oben und
rechts unten ein Stuͤk Durchschnittszeichnung enthaͤlt, um die
erwaͤhnte Einrichtung deutlicher zu zeigen. Fig. 2 zeigt ein einzelnes
Platin in natuͤrlicher Groͤße; dasselbe besteht aus einem am obern
Ende gekruͤmmten Drahte a und einem zweiten b, welcher durch ein Oehr mit dem Drahte a verbunden ist. Sizt a im
Punkte c auf einer Flaͤche auf, so wird, wenn
kein Hinderniß vorhanden ist, b durch seine Schwere den
Haken a herabziehen und den Theil d noͤthigen, nach Links auszuschlagen. In Fig. 1 zeigt sich nun
aber, daß das verlaͤngerte Ende d an dem
Winkelstuͤk e anliegt und auf demselben zugleich
aufsizt. Eine Zweihundert-Maschine besizt acht solcher Winkelstuͤke,
die durch die ganze Breite der Maschine hindurchgehen und an den Seiten zu einem
Roste verbunden sind. Bei der gezeichneten Stellung wuͤrden durch den
aufbewegten Rost alle Platinen gehoben werden, folglich auch alle
eingehaͤngten Schnuͤre f, f aufgehen.
Liegt aber nun auf dem Prisma P (welches
gewoͤhnlich Cylinder genannt wird) eine durchloͤcherte Karde, so wird,
wie gewoͤhnlich, ein Theil der Nadeln g, g nach
Rechts vorgeschoben, und die mit denselben durch die Oehre h,
h in Verbindung stehenden Draͤhte dadurch von dem Roste
weggeschoben, wodurch verursacht wird, daß der Rost, ohne sie zu heben, aufgeht.
Platinen und Schnuren der weggeschobenen Nadeln bleiben in Ruhe und bilden so mit
den aufgehobenen den Sprung in der Kette. Sobald der Rost niedergeht, sezen sich die
Enden d, d der Platinen wieder auf und koͤnnen
nun von Neuem wieder herabgestoßen werden. Die Nadeln g,
g liegen etwas schraͤg, um leichter zuruͤkgehen zu
koͤnnen und damit die Oehre h, h in ihrer
Hoͤhe nicht zu sehr abweichen.
Die Verbindung des Rostes zeigt Fig. 3, wo A ein abgebrochenes Winkelstuͤk ist, B die vertikale Fuͤhrung im eisernen Geleise
bewirkt, C einen Henkel vorstellt, deren zu beiden
Seiten einer angebracht ist, um die Gurte D (Fig. 1) zu
befestigen, welche mit der Rolle R verbunden sind und
durch deren Umdrehung gehoben werden.
Eine andere Verbesserung, welche jedoch minder wesentlich ist, zeigen ebenfalls Fig. 1 und 3. Das Prisma
P bewegt sich gewoͤhnlich im Bogen, wird aber
durch den hier angegebenen Mechanismus mit sich selbst parallel horizontal
ausgeschoben und eingezogen. Auf dem Stabe m ist der
Rahmen n festgeschraubt; in dem Schlize o desselben bewegt sich die Rolle p, welche sich gleichzeitig mit dem Roste hebt und senkt, und dabei gegen
die schiefe Ebene q druͤkt, wodurch n und m in der Richtung des
angezeichneten Pfeiles bewegt werden. Mit m steht das
Prisma P in Verbindung; senkt sich p, so wird daher P gegen die
Nadeln bewegt, hebt sich p, so wird P von den Nadeln abgeruͤkt; P ist dabei immer rechtwinkelig gegen die Nadeln gerichtet. Hiedurch
wird auch die bei der alten Einrichtung nothwendige freistehende Feder entbehrlich
gemacht. Das Umdrehen des Prismas geschieht uͤbrigens hier genau so wie
fruͤher.
Der beschriebene Stuhl wird nicht nur Alles leisten, was der bisherige leistete, und
seine Bewegungen werden dabei sicherer und leichter und fuͤr
sorgfaͤltige Fabrication geeigneter seyn, um so mehr, wenn die ganze
Vorrichtung von Eisen ausgefuͤhrt ist, wie dieß die Zeichnung voraussezt. In
Chemnitz werden bereits drei der angegebenen Maschinen bearbeitet, an deren Leistung
man um so weniger zweifelt, als sich eine technische Deputation des
Handwerkervereins schon guͤnstig uͤber dieselbe aussprach.
(Gewerbebl. f. Sachsen, 1838, S. 74-75.)
Tafeln