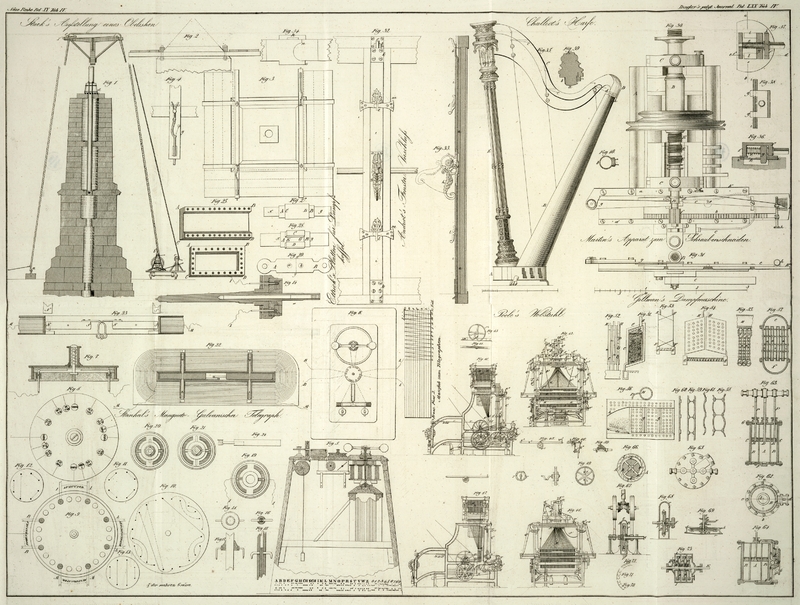| Titel: | Verbesserungen an den Stühlen zum Weben façonnirter Zeuge, worauf sich Moses Poole, am Patent Office, Lincoln's Inn in der Grafschaft Middlesex, am 30. Nov. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. LXIV., S. 280 |
| Download: | XML |
LXIV.
Verbesserungen an den Stuͤhlen zum Weben
façonnirter Zeuge, worauf sich Moses Poole, am Patent Office, Lincoln's Inn in
der Grafschaft Middlesex, am 30. Nov. 1837 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Septbr.
1838, S. 129.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Poole's verbesserte Stuͤhle zum Weben façonnirter
Zeuge.
Die gegenwaͤrtigem Patente zu Grunde liegende Erfindung beruht auf der
Anwendung der bekannten Jacquard'schen Maschinerie auf
die sogenannten mechanischen Webestuͤhle, um mittelst Dampf oder einer
anderen Triebkraft façonnirte Seiden-, Baumwoll-, Hanf-,
Leinen- oder andere Zeuge fabriciren zu koͤnnen. Obschon es bereits
mannigfache Vorrichtungen gibt, denen gemaͤß die Art und Weise, auf welche
die Faͤden in einem Gewebe gelegt werden, nach dem Jacquard'schen Systeme durch Anwendung durchloͤcherter Pappendekel
controlirt werden soll; und obschon wir bereits mehrfache Arten mechanischer, durch
Dampf oder eine andere Triebkraft in Bewegung zu sezender Webestuͤhle
besizen, so geschieht es nun meines Wissens doch zum erstenmal, daß das Jacquard'sche System mit einem mechanischen Webestuhle in
Verbindung gebracht wird.
Fig. 41 zeigt
den neuen Webestuhl in einem Seitenaufrisse, waͤhrend man denselben in Fig. 42 in
einem Frontaufrisse dargestellt sieht. An beiden Figuren sind zur Bezeichnung
gleicher Theile gleiche Buchstaben beibehalten. Ich habe der Beschreibung nur die
Bemerkung vorauszuschiken, daß ich bei derselben angenommen habe, der mit acht Lizen
erzeugte Grund des Fabricates habe das Aussehen von sogenanntem Atlas. Sollte der
Grund ein anderer seyn, so muͤßte eine etwas andere Einrichtung getroffen
werden; ich habe uͤbrigens gedacht, daß meine Beschreibung am deutlichsten
ausfallen muͤßte, wenn ich den Stuhl dabei als in der Erzeugung eines
bekannten Fabricates begriffen dachte.
Die Rolle oder Trommel A wird von einer Dampfmaschine
oder einer anderen Triebkraft her mittelst eines Treibriemens in Bewegung gesezt. An
ihrer Welle befinden sich die Kurbelarme B, an denen die
beiden Verbindungsstangen C angebracht sind. Leztere
theilen die Bewegung auf solche Art an die Lade D mit,
daß diese so viele Schlaͤge macht, als die Rolle A Umgaͤnge vollbringt. Die Bewegung der Lade bedingt das Aufrollen
des fabricirten Zeuges auf den Werkbaum, und in dem Maaße, als die Fabrication
fortschreitet, auch das Abwinden der Kette von dem Kettenbaume. An der Welle des Werkbaumes E, auf dem das erzeugte Gewebe aufgewunden wird,
befindet sich das Rad F, welches in das an der Welle des
Zahnrades H aufgezogene Getrieb G eingreift. An der Welle des Zahnrades H
bemerkt man einen Hebel I, an dessen Ende die in das Rad
H einfallenden Sperrkegel oder Daͤumlinge J angebracht sind. Derselbe Hebel ruht mit seinem
anderen Arme auf einer Walze K, die an dem Hebel L, dessen Drehpunkt sich unter der Welle des Zahnrades
H befindet, aufgezogen ist. Die Stange N verbindet das Ende dieses Hebels L mit der Lade. Um uͤbrigens den Hebel L auf der erforderlichen Hoͤhe zu erhalten, ist
auch noch eine andere Stange O vorhanden. An dem Hebel
I ist mittelst einer Schnur oder einer Stange das
Gewicht P aufgehaͤngt, welches die Sperriegel J fortwaͤhrend mit dem Zahnrade H in Beruͤhrung erhaͤlt. Am Schlusse einer
jeden Bewegung der Lade D wird der Hebel L von der Stange N
aufgehoben, wo dann die Walze K ihrerseits die auf ihr
ruhenden Arme des Hebels I emporhebt. Durch leztere
Bewegung werden die die Sperrkegel J fuͤhrenden
Arme des Hebels I dagegen herabgesenkt, so daß diese
Sperrkegel die Zaͤhne des Rades H verlassen, und
dafuͤr in andere, weiter unten befindliche Zaͤhne einfallen. Wenn die
Lade D hingegen wieder zuruͤkkehrt, so sinkt der
Hebel L herab, ohne daß jedoch seine Walze K die Arme des Hebels I in
die Hoͤhe treibt, da diese durch das Gewicht P
herabgezogen werden. Dagegen steigen die die Sperrkegel J fuͤhrenden Arme empor, um das Rad H
um eben so viele Zaͤhne umzutreiben, als die Sperrkegel waͤhrend der
Bewegung der Lade D voruͤbergehen ließen.
Waͤhrend sich die Lade vorwaͤrts bewegt, haͤlt ein Sperrer R, der bei S einen Drehpunkt
hat, das Rad H fest. Die Bewegung, die das Rad H durch die Sperriegel J
mitgetheilt erhielt, pflanzt sich durch das Getrieb G an
das an der Welle des Werkbaumes E befindliche Rad F fort, so daß also auf diesen Baum eine den
Verhaͤltnissen der Durchmesser der Raͤder H und F und des Getriebes G, und der Zahl der Zaͤhne, an denen die
Sperrkegel J beim Herabfallen voruͤbergingen,
entsprechende Zeuglaͤnge aufgewunden wird. Die Zeuglaͤnge, welche der
Werkbaum bei jedem Schlage der Lade aufrollt, und der Schlag, den das Fabricat
erleidet, laͤßt sich demnach beliebig reguliren. Je schneller sich das
Getrieb G bewegt, um so weniger wird der Zeug geschlagen
werden. Die Festigkeit desselben laͤßt sich also durch Regulirung der
Laͤnge der Stange N, die den Hebel L mit der Lade D verbindet,
veraͤndern. Wenn man z.B. diese Stange verlaͤngert, so wird die Lade
den Hebel L nicht so hoch emporheben; folglich wird dem
Hebel I keine so ausgedehnte Bewegung mitgetheilt
werden, die Sperrkegel J werden sich nicht uͤber so viele
Zaͤhne des Rades H bewegen, und der Zeug wird
also, da er nicht so rasch aufgewunden wird, staͤrker geschlagen werden.
Dieses Aufwinden des gewebten Zeuges bedingt ein entsprechendes Abwinden der Kette
T, unter der sich die Walze U befindet. An dieser Walze sind die beiden Riemen V, V befestigt, die, nachdem sie mehreremale um die Walze U gewunden, endlich an den Hebeln X, X, die ihre Drehpunkte in Y haben,
festgemacht sind. An diesen Hebeln befinden sich die Gewichte Z, die den Riemen eine groͤßere oder geringere Spannung geben, je
nachdem man sie mehr oder weniger von den Drehpunkten Y
entfernt. Die Spannung der Riemen V bestimmt die
Spannung der Kette, die jedoch nicht so weit getrieben werden darf, daß dadurch das
Glitschen der beiden Walzenenden U in den dieselben
umschlingenden Riemen verhindert wird. Denn die Reibung dieser Riemen ist es, welche
die Kette auf den gehoͤrigen Grad gespannt haͤlt; und diese Reibung
muß eine solche seyn, daß sie dem Zuge nachgibt, der durch das Aufwinden des Zeuges
auf den Baum E auf die Kette ausgeuͤbt wird. A¹ ist eine kleine Walze, uͤber welche die
Kette laͤuft, nachdem sie die Walze U verlassen;
sie kann mittelst ihrer Anwellen B¹ , die in den Fugen oder Spalten C¹ fixirt sind, hoͤher oder tiefer gestellt werden, so daß
man die Kette auf die Hoͤhe des Geschirres bringen kann. Die drei
Staͤbe D¹, D¹, D¹ dienen dazu, die
Kettenfaͤden in gehoͤriger Ordnung zu erhalten; von ihnen aus laufen
die Faͤden in das Jacquard-Geschirr E¹ ; hierauf in die
Lizen X¹, X¹
, und endlich in das Rietblatt G¹ , worauf sie durch
das Einschießen des Eintrages in Zeug verwandelt an die Querstange und von dieser
hinab an den Werkbaum E gelangen.
Ich gehe nun zur Beschreibung der Anwendung des Jacquard'-schen Apparates uͤber. Dieser Apparat, der, so wie man
sich seiner an den Handwebestuͤhlen bedient, hinlaͤnglich bekannt ist,
beruht auf der Leitung der Bewegung der Kettenfaͤden mittelst einer Reihe
durchloͤcherter Pappblaͤtter, um bei der Damast-,
Seiden- oder sonstigen Weberei Muster zu erzeugen, die durch die Zahl der
Faͤden, welche bei den einzelnen Wuͤrfen der Schuͤze aufgehoben
oder niedergelassen sind, bedingt werden. I¹, I¹ sind die Bleie, welche die Schnuͤre J¹, J¹ des Jacquard-Geschirres bestaͤndig gespannt
erhalten, und deren Gewicht so wie an dem gewoͤhnlichen Jacquard-Stuhle nach der Art und Qualitaͤt des Fabricates
abgeaͤndert werden muß. Die Schnuͤre J¹, J¹ gehen zuerst durch ein
durchloͤchertes Brett K¹, K¹ , welches man in
einigen Fabriken das heilige (holy board) zu nennen
pflegt, und uͤber dem jede einzelne Schnur, je nach dem Muster, welches
gewebt werden soll, mit einer groͤßeren oder kleineren Anzahl von
Schnuͤren verbunden wird. Die Schnuͤre M¹, M¹ laufen ihrerseits durch ein zweites
durchloͤchertes Brett L¹, L¹ damit sie im Koͤrper des Jacquard zusammengehalten werden, worauf dann jede
einzelne Schnur durch das Oehr einer horizontalen Nadel N¹ gefuͤhrt ist. Diese Nadeln sollen je nach der
Laͤnge, die sie haben muͤssen, aus Eisendraht Nr. 13, 14 oder 15
verfertigt werden. Nachdem die Schnuͤre durch das Oehr der Nadel gezogen
worden, fuͤhrt man sie durch die Loͤcher eines dritten Brettes, hinter
dem sie einzeln mittelst eines Knotens festgehalten werden. Außerdem hat jede der
Schnuͤre M¹ beilaͤufig einen Zoll
vor der Nadel, durch die sie gefuͤhrt ist, auch noch einen anderen Knoten.
Hieran sind die Zaͤhne eines Kammes fixirt, der jene Faͤden, die durch
die Wirkung der Nadeln und der Pappblaͤtter aufgehoben worden sind,
emporzuheben hat. P¹, P¹ sind die Daͤumlinge, welche sich bei jeder
Veraͤnderung der Musterblaͤtter umdrehen. Die Aufgabe des unteren
Daͤumlinges ist den Cylinder O¹ , und wenn es noͤthig ist, auch nach der
entgegengesezten Richtung mittelst der Schnur Q¹
und der Rolle R¹ umzudrehen. Diese Schnur Q¹ wird von dem den Stuhl bedienenden Arbeiter
gehalten und in einen Knoten geschlungen. Soll der Cylinder nach entgegengesezter
Richtung umgedreht werden, so wird er in einer Auskerbung zuruͤkgehalten,
wodurch der untere Daͤumling mit dem Jacquard-Cylinder in Beruͤhrung kommt, und der
gewuͤnschte Erfolg auf die bekannte Weise eintritt. S¹, S¹ sind die
durchloͤcherten Pappblaͤtter, welche zum Behufe der Erzeugung des
Musters mit dem Cylinder O¹ in Beruͤhrung
kommen; sie laufen in Gestalt einer endlosen Kette uͤber die zu ihrer Leitung
bestimmten Walzen T¹, T¹. Sie werden hiebei von den ledernen Riemen U¹, U¹
getragen, und sind leicht so zu ordnen, daß sie in einer gewissen Reihenfolge an den
Cylinder gelangen. Ein zur Bedienung des Stuhles aufgestellter Knabe kann leicht mit
den Haͤnden das Emporsteigen dieser Pappblaͤtter reguliren. Der Hebel
V¹ dient dazu, dem Jacquard seine Bewegung mitzutheilen. Die Stange X¹, welche an der Seite des Sahlbandes der Kette hinlaͤuft,
verbindet diesen Hebel mit dem sogenannten Contremarsche Y¹ , der durch eine andere Stange auch
mit dem Tritte Z¹ des Cylinders O¹ in Verbindung steht. Das Gewicht des Trittes
Z¹ ist durch ein auf den Hebel W¹ wirkendes Gewicht ausgeglichen; und um die
Bewegung des Trittes regelmaͤßiger zu machen, ist dessen Ende in einer Spalte
fixirt. Es dreht sich um seinen Drehpunkt A¹ , wenn der Cylinder O¹ gegen die Nadeln N¹ getrieben
wird. Die Loͤcher der Pappblaͤtter bleiben an der Stelle der Nadeln,
die durch sie hindurchgedrungen sind; alle gleichen Pappblaͤtter bringen aber
die Nadeln wieder mit diesen Loͤchern in Beruͤhrung, wodurch die durch
die Nadeln gefuͤhrten Schnuͤre M¹
angezogen und deren
Knoten auf den Zaͤhnen des Kammes fixirt werden. Wenn dann der Hebel V¹ durch die Stange X¹ des an dem Tritte Z¹ angebrachten
Contremarsches Y¹ in Bewegung gesezt wird, so
wird das Muster durch die Pappblaͤtter erzeugt. Der Hebel V¹ ist an einem Eisenstabe D² , der sich an seinen beiden Enden
E², E²
dreht, festgemacht. Ebenso ist an diesem Stabe D²
aber auch noch der Hebel F² befestigt, der an dem
einen Ende mit einer um eine Achse beweglichen Stange G² in Verbindung steht. Das andere Ende dieser Stange G² steht seinerseits mit einer anderen Stange I² in Verbindung, und an der Verbindungsstelle
dieser beiden Stangen befindet sich eine Walze H². Die Stange I² ist mit dem
Gestelle, welches den Cylinder O traͤgt,
verbunden, und die Schraͤgflaͤche J² nimmt die Walze H² auf. Der
andere Arm des Hebels F² ist mit dem den Kamm C² fuͤhrenden Gestelle verbunden, und hebt
also diesen empor, wenn der erstere Arm des Hebels herabgesenkt wird. Wenn der Hebel
V¹ von Oben nach Abwaͤrts gezogen
wird, so erhellt offenbar, daß sich der Hebel F²
gleichfalls in derselben Richtung bewegen, und mithin eine entsprechende Bewegung
der Stange G² , der
Walze H² auf der Schraͤgflaͤche J² , der Stange I² und des einen der Gestelle des Cylinders O¹ veranlassen wird, wodurch bewirkt wird, daß
der Cylinder die Nadeln entfernt. Findet die Bewegung des Hebels V¹ nach entgegengesezter Richtung Statt, so wird
der Cylinder O¹ gegen die Nadeln getrieben.
Waͤhrend der Cylinder O¹ die Nadeln
entfernt, dreht sich einer der Daͤumlinge P¹ , wodurch ein neues Pappblatt vor die
Nadeln gebracht wird. Die Schraͤgflaͤche J² gewaͤhrt nur den Vortheil, daß sie die Bewegungen des Jacquard regulirt. Das Gestell oder der Rahmen, der den
Cylinder O¹ traͤgt, dreht sich am oberen
Theile des Stuhles bei K², und wird mittelst
Schrauben so regulirt, daß die Loͤcher in directe Beruͤhrung mit den
Nadeln kommen. Der untere Theil des Jacquard hat seine
Stuͤzpunkte bei L², L². An dem oberen Ende des Stuhles befinden sich die Schrauben und
Schraubenmuttern, deren Aufgabe es ist, den Cylinder O¹ fixirt zu erhalten, wenn er durch die Daͤumlinge P¹ umgetrieben worden. An dem oberen Theile des
Jacquard ist aber ferner einer Stange N² aufgehaͤngt, die unten mit einem
Gewichte versehen ist; ihr Geschaͤft ist waͤhrend der
ruͤkgaͤngigen Bewegung des Cylinders O¹ jene Nadeln, die bei der Bewegung desselben nach Vorwaͤrts
vorgedrungen sind, wieder zuruͤkzufuͤhren. Sie bewege sich bei O² um eine Spindel; wuͤrde sie stets mit
den Nadeln in Beruͤhrung bleiben, so wuͤrde sie eine bedeutende Gewalt
darauf ausuͤben, was jedoch nicht noͤthig ist, ausgenommen sie werden
durch den Ruͤklauf des Cylinders O¹
zuruͤkgetrieben. Eine nach Abwaͤrts sich erstrekende Verlaͤngerung P² dieser Stange trifft mit einem kleinen
Vorsprunge Q² der Stange I² zusammen. Dieser Vorsprung treibt also beim Zuruͤkweichen
der Stange I² die Verlaͤngerung P² und mithin auch die Nadeln zuruͤk;
dagegen druͤkt die Verlaͤngerung P²
vermoͤge ihrer eigenen Schwere gegen die Nadeln, wenn die Stange I² vorschreitet, um den Rahmen des Cylinders O¹ zu bewegen. R² ist eine kleine horizontale Platte mit mehreren kleinen Walzen,
uͤber welche die Schnuͤre M¹ gegen
die Mitte des Stuhles hin gefuͤhrt werden, damit die den Sahlleisten
zunaͤchst gelegenen Schnuͤre der Kette eben so hoch aufgehoben werden,
als die in der Mitte befindlichen. Je hoͤher der Jacquard uͤber dem Stuhle angebracht wird, um so besser ist es.
Ich will nun zeigen, wie der Stuhl, wenn er in Thaͤtigkeit ist, auf den
Jacquard wirkt. Das Rad S², welches man in Fig. 43 und
44
einzeln fuͤr sich abgebildet sieht, und welches an der Welle T² aufgezogen ist, druͤkt, wenn es
umlaͤuft, den Tritt Z¹ des Cylinders
herab, weil sein Umfang stets mit der an dem Tritte Z¹ angebrachten Walze U² in
Beruͤhrung steht. Die Folge hievon ist, daß der Jacquard mittelst der Stange Z¹ und des
Hebels V¹ in eine entsprechende Bewegung versezt
wird, und daß also von den mit den Schnuͤren in Beruͤhrung stehenden
Kettenfaͤden jene aufgehoben werden, die von den Nadeln erfaßt worden. Bei
jedem Umgange des Rades S² faͤllt jedoch
die Walze U² in einen an dem ersteren
befindlichen Ausschnitt, wie man dieß in Fig. 41 und 43 sieht; und
hieraus folgt, daß die Schnuͤre und mit ihnen auch die emporgehobenen
Kettenfaͤden wieder herabsinken. Wenn in demselben Momente das eben gewebte
Pappblatt durch ein neues ersezt worden, so sezt das Rad S² seine Bewegung fort, wodurch der Tritt Z¹ abermals herabgedruͤkt wird. Die mit den Muster-
oder Pappblaͤttern in Beruͤhrung gebrachten Kettenfaͤden werden
also bei jedem Umgange des Rades S² aufgehoben.
Der Tritt V² bewegt sich, wie Fig. 41 zeigt, an seiner
Welle A³ ; und der
Contremarsch hat seine Welle in B³ , wie dieß in Fig. 42 angedeutet ist.
Jede Schnur ist durch eine Schnur C³ mit einer
Contreschnur verbunden. Zwei andere Schnuͤre oder auch Draͤhte G³ sind an den Hebeln E³ befestigt, die mittelst der Stange F³ mit dem Hebel G³ verbunden sind.
An dem anderen Ende dieses Hebels G³ sind die
Gewichte H³ aufgehaͤngt, welche die Lizen
X³ , die sonst
durch das Gewicht des Trittes und des Gegentrittes herabgezogen werden
wuͤrden, bestaͤndig emporzuziehen streben. In senkrechter Stellung
werden diese Gewichte H³ durch die Fuͤhrer
I³ erhalten. Hieraus ergibt sich, daß, wenn
die Stange Y² herabgesenkt wird, sie mittelst der
beschriebenen Anordnungen die mit ihr in Beruͤhrung stehenden Schnuͤre herabziehen
wird; daß aber, wenn ihre Wirkung aufhoͤrt, die Schnuͤre wieder durch
die Gewichte H³ emporgezogen werden, indem
leztere durch die angegebenen Hebelverbindungen und Schnuͤre auf sie wirken.
Der Tritt V² wird mittelst Fugen, die in das
Gestell J³ geschnitten sind, in einer und
derselben Richtung erhalten. Der Querbalken K³
traͤgt die Welle A² des Trittes Z¹ des Cylinders, so daß also die Hebelarme
dieses Trittes zum Behufe der Regulirung des Winkels, den die Kettenfaͤden zu
bilden haben, um hinreichenden Spielraum fuͤr die Schuͤze zu
gestatten, regulirt werden koͤnnen. Je laͤnger naͤmlich der
Hebelarm ist, um so groͤßer wird dieser Raum seyn und umgekehrt.
Ich will nun zeigen, wie die Lizen X² durch den
Tritt V² und die gegenuͤberliegende Stange
Y² in Bewegung gesezt werden. An der Welle
T² sind acht Kaͤmme oder
Muschelraͤder L³ aufgezogen, welche durch
den Tritt V² in gehoͤriger Ordnung in
Thaͤtigkeit gesezt werden, zu welchem Zweke sie auch spiralfoͤrmig an
der Welle T² angebracht sind. Eine deutlichere
Ansicht derselben erhaͤlt man aus Fig. 50. Mit dieser
Anordnung lassen sich alle dem zu webenden Fabrikate entsprechenden Stellungen
erzielen. Eine an jedem der Tritte V² befindliche
Hervorragung M³ erfaͤhrt die Einwirkung
des zu diesem Gange gehoͤrigen Muschelrades. Der Umfang der Welle T² ist in neun gleiche Theile abgetheilt, von
denen acht von je einem der Muschelraͤder L³ eingenommen werden, waͤhrend der neunte Theil dem Ausschnitte
des Rades S² entspricht. Die im Grunde des
Fabricates befindlichen Lizen bewegen sich nicht; auch sind hier keine
Kettenfaͤden aufzuheben. Die Welle T²
erhaͤlt ihre Bewegung durch das im ihr bemerkbare Rad S² und durch das Getrieb O³ an
der Welle P³ , die
von der Trommel A her umgetrieben wird. Da das Getrieb
O³ neunmal weniger Zaͤhne hat, als das
Rad S², so vollbringt es neun Umlaͤufe,
waͤhrend lezteres einmal umgeht. An der Welle P³ sind zwei Kurbeln befestigt, und an diesen befinden sich zwei
ausgefalzte Stangen C³ , die mit ihren anderen Enden an die Lade D
gefuͤgt sind. Hieraus folgt, daß jeder Umgang der Welle P³ oder des Getriebes O³ einen Schlag der Lade D, jeder
Umgang des großen Rades S² dagegen neun solcher
Schlaͤge bewirkt. Dabei kommt zu bemerken, daß bei dem Atlasgrunde, der hier
als Beispiel gewaͤhlt ist, auf jedes Pappblatt acht
Schuͤzenwuͤrfe kommen; und daß, waͤhrend das Pappblatt
fuͤr ein anderes umgewechselt wird, die Schuͤze ruhig zu verbleiben
hat, wonach also waͤhrend des neunten Schlages der Lade D die Schuͤze unbewegt bleiben muß. Ein Beispiel
wird dieß erlaͤutern. Die Lade D ist auf
gewoͤhnliche Weise an dem oberen Theile des Stuhles aufgehaͤngt; der
Schuͤzentreiber Q³ ist an dem Schwerte K³ der Lade angebracht, und zwar mittelst der Kruͤke S³ ; an ihm bemerkt
man auch den Riemen U³; je weiter er sich bewegt,
um so hoͤher wird er empor gehoben. Seine Bewegung erhaͤlt der
Schuͤzentreiber Q³ durch das an der Welle
T² laufende Rad V³. Diese Raͤder V³, von
denen man in Fig.
45 eines fuͤr sich allein abgebildet sieht, sind in neun gleiche
Theile getheilt, von denen vier ausgetieft sind, waͤhrend die fuͤnf
anderen zahnartige Vorspraͤnge bilden. Der vierte und fuͤnfte Zahn,
welche miteinander verbunden sind, bilden einen Doppelhaken. Auf jedem dieser
Raͤder V³ ruht ein Hebel X³ , der seinen
Drehpunkt in Y³ hat, und an dem sich ein
Vorsprung Z³ befindet. So oft dieser Vorsprung
mit einem der Zaͤhne des Rades in Beruͤhrung kommt, wird der Hebel
aufgehoben; dagegen sinkt dieser herab, wenn der erwaͤhnte Vorsprung in die
ausgetieften Stellen des Rades gelangt. Durch das Umlaufen der Raͤder V³ werden demnach die Hebel X³ abwechselnd gehoben oder herab gesenkt, und
zwar so, daß einer der Hebel gehoben, der andere dagegen gesenkt ist, ausgenommen,
wenn am Ende des Umlaufes die beiden Vorspruͤnge der beiden Raͤder V³ gemeinschaftlich wirken, was bei jedem neunten
Umlaufe des an der Welle P³ befindlichen
Getriebes O³ Statt findet. An das Ende eines
jeden dieser Hebel ist eine Stange W³
gefuͤgt, die mit einem sogenannten Hunde A⁴ in Verbindung steht. Lezterer ist seinerseits auf solche Weise an
dem Gestelle des Stuhles befestigt, daß er sich leicht bewegen kann, wenn der Hebel
X³ gehoben oder gesenkt wird. Vorne vor
diesem Hunde A⁴ ist an dem Schwerte der Lade D ein Mechanismus B⁴
angebracht, den man in Fig. 46 einzeln
fuͤr sich abgebildet sieht, und den ich den Triangel nennen will. Dieser
Triangel vollbringt an der Welle oder Spindel C⁴
, an der sich ein kleiner Vorsprung D⁴ befindet, abwechselnd eine
kreisfoͤrmige und eine horizontale Bewegung. Wenn einer der Hebel X³ durch einen der Zaͤhne der
Raͤder V³ emporgehoben wird, so wird der
correspondirende, damit in Verbindung stehende Hund A⁴ gleichfalls gehoben werden, dagegen wird derselbe herabsinken, so
oft die Hebel X³ in die Austiefungen der
Raͤder V³ einfallen. In der Zeichnung ist
der Hund A⁴ als herabgesunken dargestellt. Die
Lade D trifft bei ihrer Ruͤkkehr auf den
Vorsprung D⁴ des Triangels B⁴ ; und die Folge hievon ist, daß sich
lezterer rasch um seine Welle C⁴ dreht, und
zugleich den ledernen Riemen U³ anzieht, der mit
dem Schuͤzentreiber in Verbindung steht, so daß dann dieser auf die
gewoͤhnliche Weise auf die Schuͤze wirkt. Hat der
Schuͤzentreiber die Schuͤze ausgeschleudert, so wird er durch die
Feder E⁴ wieder an seine Stelle zuruͤk
gefuͤhrt. Der Anordnung der Raͤder V³ gemaͤß, bleibt einer der Schuͤzentreiber im Ruhestand,
waͤhrend der andere in Bewegung ist; beide bleiben sie aber bewegungslos, wenn der
große Zahn der Raͤder V³ gleichzeitig auf
die Hebel X³ wirkt. In diesem Augenblike, wo die
Schuͤze ruht, bewirkt das Rad S² eine
Veraͤnderung der Pappblaͤtter, was denn auch wirklich bei jedem
neunten Umlaufe der Welle P³ geschieht. Die
Bewegung, welche die Lade in dieser Zeit vollbringt, hat keinen Einfluß auf das
Fabricat; denn da der Kamm kein zu verarbeitendes Material findet, so kann er auch
nichts ausrichten. Die Kraft des Schuͤzenwurfes laͤßt sich durch
Verlaͤngerung oder Verkuͤrzung des ledernen Riemens U³ oder auch durch irgend einen anderen
Mechanismus reguliren.
Aus der voranstehenden Beschreibung ergibt sich, daß man sowohl an dem mechanischen
Webestuhle, als an dem Apparate, durch den eine Reihe durchloͤcherter
Pappblaͤtter nacheinander in Thaͤtigkeit gesezt werden kann, an den
Nadeln oder an den Instrumenten, welche zur Fuͤhrung der Kettenfaͤden
mittelst solcher durchloͤcherter Pappblaͤtter dienen, verschiedene
Modificationen machen kann. Ich gruͤnde daher meine Anspruͤche auf
keinen dieser einzelnen Theile, noch auf eine bestimmte Anordnung derselben, sondern
ich dehne sie wie gesagt auf die Verbindung des Jacquard'schen Systemes mit der mechanischen Weberei im Allgemeinen aus.
Nachdem ich somit gezeigt, wie die Jacquard'sche
Maschinerie durch den in Fig. 41 und 42
abgebildeten Mechanismus mittelst Dampf oder einer anderen Kraft in Bewegung gesezt
werden kann; nachdem ich bisher eine Einrichtung gezeigt, der gemaͤß der
Grund des Fabricates mit Tritten, deren Anzahl von der Art des gewuͤnschten
Grundes abhaͤngt, erzeugt wird, waͤhrend das Muster durch die
durchloͤcherten Pappblaͤtter hervorgebracht wird; will ich nunmehr
auch erlaͤutern, wie ich jedes beliebige Muster ohne Anwendung der in Fig. 41 und
41
abgebildeten Tritte und lediglich mit den Pappblaͤttern allein zu erzeugen im
Stande bin.
Bekanntlich sind an allen Jacquard-Stuͤhlen,
mit denen Muster in den Zeugen erzeugt werden, wenn man sich zur Erzeugung des
Grundes des Fabricates der Tritte bedient, durch jedes der sogenannten Ringelchen
drei oder mehrere Kettenfaͤden gezogen, und diese Faͤden sind einzeln
durch die vorderen Blaͤtter oder Tritte gefuͤhrt. Wenn daher die Jacquard-Maschine mittelst der Pappblaͤtter
je nach dem zu erzeugenden Muster einen gewissen Theil des Kettengarnes aufhebt, so
werden je nach der Zahl der in jedem Ringelchen befindlichen Faͤden drei oder
mehrere Kettenfaͤden zugleich emporgehoben werden. Wenn es sich z.B. um einen
achtblaͤtterigen Atlas handelte, so wuͤrden auf jedes Pappblatt acht
Einschußfaͤden kommen, bevor irgend ein Wechsel im Muster Statt
faͤnde, wie dieß auch in Fig. 41
und 42 der Fall war. Die
Hauptursache, warum ich fuͤr den Grund des Fabricates Tritte benuͤze,
liegt, wie ich nun bemerken muß, darin, daß ein mit Tritten ausgeruͤsteter
Stuhl weit weniger an Pappblaͤttern, Bleien, Mustern etc. kostet. Dagegen
kommt in Betracht, daß das Fabricat oder das Muster nicht so schoͤn
ausfaͤllt, als wenn durch jedes Ringelchen nur ein Faden gezogen ist, und
wenn auf jedes Pappblatt nur ein Faden Einschuß kommt.
In Fig. 47 und
48 sieht
man einen Stuhl, der mit Pappblaͤttern allein und ohne Anwendung von Lizen
jedes Muster liefert. Da meine Maschinerie sich zum Betriebe aller Formen des Jacquard eignet, so hielt ich es nicht fuͤr
noͤthig, eine andere Art des lezteren abzubilden, und zwar um so weniger, als
die in Fig.
41 und 42 dargestellte mir die beste zu seyn scheint. Ich habe ferner auch zur
Bezeichnung der einzelnen Theile dieselben Buchstaben beibehalten. Es ist hier durch
jedes Ringelchen nur ein Faden gefuͤhrt, und es kommt auch auf jedes
Pappblatt des Musters nur ein einziger Einschußfaden. Da jeder Kettenfaden auf
solche Weise einzeln und unabhaͤngig fuͤr sich aufgehoben werden kann,
so folgt, daß wenn eine solche Einrichtung getroffen ist, daß die eine
Haͤlfte der Pappblaͤtter mit Loͤchern versehen ist, glatter
Zeug gewebt wird, indem dann abwechselnd die Haͤlfte der Kette aufgehoben
wird. Waͤre der vierte Theil der Pappblaͤtter durchloͤchert, so
wuͤrde der Zeug ein gekoͤperter werden u.s.f. An dem in Fig. 47 und
48
abgebildeten Stuhle gibt die Lade jedem Einschußfaden zwei Schlaͤge, und zwar
den einen offen, den anderen hingegen, wenn die Maschine beinahe in ihre
anfaͤngliche Stellung zuruͤkgekehrt ist. Man erhaͤlt auf solche
Art ein viel besseres Fabricat, besonders wenn dasselbe aus feinen Seiden-
oder Wollenfaͤden gewebt wird.
Ich erziele mittelst meiner Erfindung dieselben Bewegungen, wie sie an der
gewoͤhnlichen, mit der Hand getriebenen Jacquard'schen Maschine Statt finden. In Fig. 47 ist A das Zahnrad und B dessen
Getrieb; ersteres hat viermal so viel Zaͤhne als lezteres, oder es
verhaͤlt sich zu diesem wie 4 zu 1, so daß also das Getrieb viermal umlaufen
muß, bis das Rad A einen Umgang zuruͤklegt. Die
Lade gibt jedem Einschußfaden zwei Schlaͤge. Die Schuͤze wird nur bei
jedem zweiten Umlaufe des Getriebes B geworfen, und ihre
Bewegung ist nach dem in Fig. 41 und 42
angedeuteten Principe regulirt. An der Welle des Stuhles bemerkt man ein Excentricum
X, welches in vier Theile getheilt ist, von denen
zwei nach entgegengesezten Richtungen ausgeschnitten sind, wie man dieß in Fig. 47 bei
K, K sieht. Da dieses Excentricum X an der Welle des Stuhles festgemacht ist, so wird es,
wenn der Stuhl in Bewegung gesezt wird, die Jacquard-Maschine mittelst des Trittes O und der
Walze G in Thaͤtigkeit bringen. In der Zeichnung
sieht man dasselbe uͤbrigens in der Stellung, die es einnimmt, wenn der Stuhl
stillsteht. In Fig.
49 sieht man eine Rolle, an deren gegenuͤberliegenden Armen die
beiden Loͤcher i, i angebracht sind. In diese
Loͤcher sind verschiebbare Zapfen V, V eingepaßt,
die mittelst eines Hebels, welcher an einer fuͤr den Weber bequemen Stelle
angebracht ist, beliebig vor- und ruͤkwaͤrts bewegt werden
koͤnnen. Ein zweites Rad Z ist an der Treibwelle
o aufgezogen; und an diesem Rade befinden sich zwei
Daͤumlinge oder Luͤpfer, die emporsteigen, wenn die Zapfen V, V eingetrieben werden. Haben die Zapfen V, V die Luͤpfer aufgehoben, so werden die Federn
T, T sogleich wieder in ihre fruͤhere
Stellung zuruͤk gelangen, wodurch die Zapfen V, V
gesperrt werden und der Stuhl unmittelbar in Thaͤtigkeit geraͤth.
Tafeln