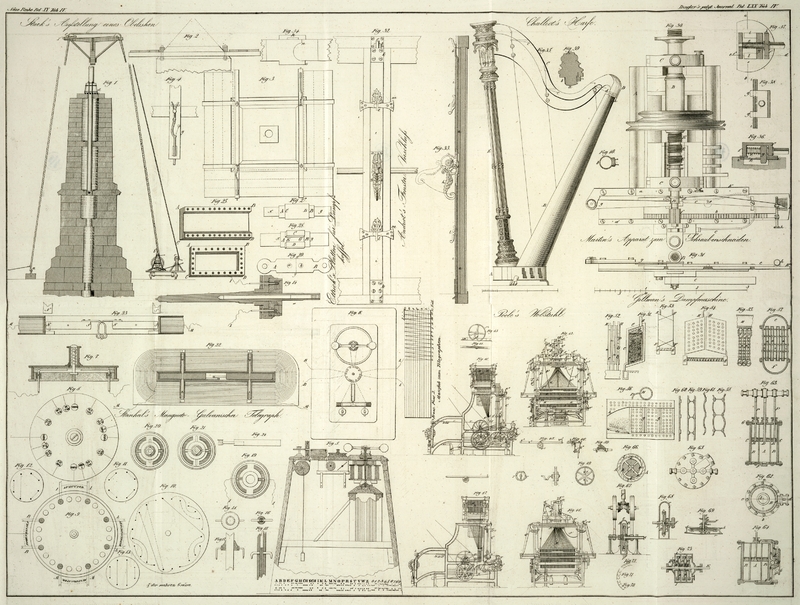| Titel: | Beschreibung des galvano-magnetischen Telegraphen zwischen München und Bogenhausen, errichtet im Jahre 1837 von Hrn. Prof. Dr. Steinheil. |
| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. LXVI., S. 292 |
| Download: | XML |
LXVI.
Beschreibung des galvano-magnetischen
Telegraphen zwischen Muͤnchen und Bogenhausen, errichtet im Jahre 1837 von Hrn.
Prof. Dr. Steinheil.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Steinheil's galvano-magnetischer Telegraph.
Der Telegraph (woruͤber bereits im polyt. Journal Bd. LXVII. S. 388 eine historische Notiz
mitgetheilt wurde) besteht aus drei wesentlichen Theilen: 1) einer metallenen
Verbindung zwischen den Stationen; 2) dem Apparat zur Erzeugung des galvanischen
Stromes und 3) dem Zeichengeber.
1) Verbindungskette.
Man muß sich die sogenannte Verbindungskette als einen sehr verlaͤngerten
Schließungsdraht der Volta'schen Saͤule denken.
Was von diesem gilt, gilt auch von ihr. Bei demselben Metall und gleicher Dike
erleidet der galvanische Strom einen der Laͤnge proportionalen Widerstand.
Dieser ist aber bei derselben Laͤnge und demselben Metall um so kleiner, je
groͤßer die Dike des Metalls ist, und zwar umgekehrt der
Durchschnittsflaͤche proportional. Die Leitungsfaͤhigkeit der Metalle
ist aber sehr verschieden. Nach Fechner's Messungen
leitet Kupfer z.B. sechsmal besser als Eisen, viermal besser als Messing. Die
Leitungsfaͤhigkeit von Blei ist noch geringer, so daß also die einzigen
Metalle, welche bei technischer Anwendung mit Vortheil in Concurrenz treten
koͤnnen, Kupfer und Eisen sind. Indem nun der Preis von Eisen nahezu sechsmal
geringer als der des Kupfers ist, man aber eine Leitung von Eisen sechsmal schwerer
bei derselben Laͤnge machen muͤßte als eine Kupferleitung, damit beide
gleichen Widerstand leisten, so ist es in finanzieller Beziehung
gleichguͤltig, welches dieser Metalle man waͤhlt. Kupfer scheint vortheilhafter, weil es
in der Luft weniger der Oxydation ausgesezt ist als Eisen. Man kann aber auch
lezteres durch einfache Mittel (galvanisiren) schuͤzen. Ja es scheint die
bloße Benuͤzung einer Eisenleitung beim Telegraphiren durch galvanische
Kraͤfte ausreichend, sie vor Rost zu schuͤzen, wie sich an einem
Theile der hiesigen Leitung, die fast schon ein Jahr aller Witterung ausgesezt,
ergeben hat.
Wenn der galvanische Strom die ganze Leitungskette mit gleicher Erregungskraft
passiren soll, so darf der Draht sich selbst nirgends beruͤhren. Er darf aber
auch nicht in vieler Beruͤhrung mit Halbleitern stehen, weil sich sonst durch
diese ein Theil der erregten Kraft den naͤchsten Weg bahnt, und also die
entferntesten Stellen Kraftverlust erleiden.
Vielfache Versuche, die Draͤhte zu isoliren und unter dem Boden fortzuleiten,
haben bei mir die Ueberzeugung begruͤndet, daß dieß auf große Entfernungen
unausfuͤhrbar ist, weil unsere besten Isolatoren doch immer nur sehr
schlechte Leiter sind. Wenn aber bei sehr großer Laͤnge ihre
Beruͤhrungsflaͤche mit dem sogenannten Isolator gegen die
Durchschnittsflaͤche der Metallleitung ungemein groß wird, so entsteht ein
nothwendiger allmaͤhlicher Kraftverlust, indem die Hin- und
Zuruͤkleitung in Zwischenpunkten, wenn auch nur wenig, communicirt. Man darf
nicht glauben, daß diesem Uebelstande auszuweichen ist, durch große Abstaͤnde
der Hin- und Zuruͤkleitung von einander. Dieser Abstand ist, wie wir
spaͤter zeigen werden, fast gleichguͤltig. Da es also wohl nicht
gelingen wird, gehoͤrig isolirte Leitungen im Innern des stets feuchten
Erdreichs herzustellen, so bleibt nur eine Moͤglichkeit, naͤmlich: sie
durch die Luft zu fuͤhren. Hier muß zwar die Leitung von Distanz zu Distanz
unterstuͤzt werden, sie ist boͤswilliger Beschaͤdigung
ausgesezt, und kann von anhaͤngendem Eis und starken Stuͤrmen
beschaͤdigt werden. Da aber keine andere Moͤglichkeit gegeben ist, so
muß man suchen, diesen allerdings erheblichen Uebelstaͤnden durch passende
Anordnungen moͤglichst entgegen zu wirken.
Die Leitungskette des hiesigen Telegraphen besteht aus 3 Theilen. Der eine
fuͤhrt von der k. Akademie nach der k. Sternwarte zu Bogenhausen und
zuruͤk; dessen Drahtlange ist 30, 500 Pariser Fuß. Der dazu verwendete
Kupferdraht wiegt 210 Pfund. Beide Draͤhte (hin und zuruͤk) sind in
Abstaͤnden zwischen 3 und 10 Fuß uͤber die Thuͤrme der Stadt
hin gespannt. Die groͤßten Laͤngen von Unterstuͤzungspunkt zu
Unterstuͤzungspunkt betragen 1200 Fuß. Dieß ist fuͤr einfachen Draht
unstreitig viel zu groß, weil anhaͤngendes Eis das Gewicht des Drahtes selbst
bedeutend vermehrt, ihm auch eine viel groͤßere Durchschnittsflaͤche
gibt, so daß alsdann Stuͤrme ihn zu zerreißen vermoͤgen. Ueber Streken,
wo keine hohen Gebaͤude vorhanden sind, wurde die Drahtleitung durch
Floßbaͤume unterstuͤzt, die 5 Fuß tief eingegraben, zwischen 40 und 50
Fuß hoch, auf einem oben befestigten Querholz den Draht tragen. An den
Auflegungspunkten ist nur Filz untergelegt, und der Draht zur Befestigung um das
Holz geschlungen. Die Abstaͤnde je zweier Baͤume betragen zwischen 600
und 800 Fuß, was ebenfalls noch zu viel ist, weil, wie die Erfahrung zeigte, sich
die Draͤhte durch Stuͤrme etc. bedeutend dehnten, und mehrmals
gespannt werden mußten.Alle diese Uebelstaͤnde sind zu vermeiden, wenn man die Leitung nicht
aus einfachem Draht, sondern aus wenigstens dreifach zusammengewundenem
bildet, und etwa von 200 Schuh zu 300 Schuh unterstuͤzt, dabei spannt
mit einer Kraft, die nicht uͤber 1/3 der Tragkraft geht. Dieß war
jedoch bei dem hiesigen Probetelegraphen, aus Gruͤnden, die nicht
weiter entwikelt werden koͤnnen, nicht ausfuͤhrbar.St.
Die auf solche Art gefuͤhrte Leitung ist keineswegs vollkommen isolirt. Wenn
die Kette z.B. in Bogenhausen geoͤffnet wird, so sollte ein in
Muͤnchen bewirkter Inductionsstoß durchaus keine galvanische Erregung in den
jezt getrennten Theilen der Kette hervorbringen. Das Gauß'sche Galvanometer zeigt aber auch dann noch einen schwachen Strom an; ja
es haben Messungen ergeben, daß dieser Strom proportional waͤchst mit dem
Abstande der Trennungsstelle von dem Inductor. Die absolute Groͤße dieses
Stroms ist nicht constant. Im Allgemeinen waͤchst sie mit der Feuchtigkeit.
Bei heftigen Regenguͤssen ist sie wohl fuͤnfmal groͤßer als bei
andauernd trokenem Wetter. Auf kleine Entfernungen von einigen Meilen hat nun
allerdings dieser geringe Verlust keinen erheblichen Einfluß, um so mehr, als man
durch die Construction des Inductors uͤber fast beliebig große galvanische,
Kraͤfte disponiren kann. Er wuͤrde aber auf Entfernungen von 50 Meilen
den groͤßten Theil der Wirkung aufheben. Deßhalb muͤßte fuͤr
solche Faͤlle weit groͤßere Vorsicht an den
Unterstuͤzungspunkten der Drahtleitung beobachtet werden.
Wenn sich Gewitter bilden, so sammelt sich auf dieser halb isolirten Leitung, wie auf
einem Conductor, Elektricitaͤt der Luft. Diese stoͤrt jedoch den
Durchgang galvanischer Stroͤme in keiner Art.Hier muß ich eines Vorfalles erwaͤhnen, der fuͤr die Zukunft
Vorsicht gebietet. Waͤhrend eines heftigen Blizes am 7. Jul. 1838
durchzukte in demselben Augenblike ein sehr starker elektrischer Funke die
ganze Leitungskette. An dem Zeichengeber, welcher in meinem Zimmer
angebracht ist, erfolgte in dem Augenblik ein Knall, wie der einer Peitsche.
Zugleich ertoͤnte die tiefe Gloke des Zeichengebers, durch Ablenkung
der Nadel so heftig angeschlagen, daß die Drehungsspizen des
Magnetstaͤbchens Schaden litten. Die naͤmliche Erscheinung
wurde auf einer andern Station bemerkt. Da die ablenkende Kraft der
Reibungs-Elektricitaͤt auf Magnete sehr gering ist, so deutet
dieser Fall auf bedeutende Elektricitaͤtsmengen hin. Diese
Erscheinung kann nur dadurch entstanden seyn, daß in diesem Augenblike
Elektricitaͤt des Bodens sich den Weg zu der in der Kette gesammelten bahnte.
Ob dieß geschehen ist durch in der Naͤhe befindliche Blizableiter
oder durch die nicht voͤllige Isolirung der
Unterstuͤzungspunkte, kann nicht wohl entschieden werden.St.
In der neuesten Zeit habe ich gefunden, daß man das Erdreich als die eine
Haͤlfte der Leitungskette benuzen kann. So wie bei der Elektricitaͤt,
kann auch bei galvanischen Kraͤften Wasser oder Erdreich einen Theil des
Schließungsdrahtes bilden. Wegen der geringen Leitungsfaͤhigkeit dieser
Stoffe gegen Metalle ist jedoch erforderlich, daß an beiden Stellen, wo die
Metallleitung den Halbleiter beruͤhrt, diese Beruͤhrungsflaͤche
sehr vergroͤßert werde. Wenn z.B. Wasser 2 Millionenmal weniger leitet als
Kupfer, so muß eine so vielmal groͤßere Wasserflaͤche in
Beruͤhrung mit Kupfer gebracht werden, damit der galvanische Strom gleichen
Widerstand im Wasser und Metall von gleicher Laͤnge finde. Betraͤgt
z.B. der Durchschnitt eines Kupferdrahtes 0,5 Quadratlinien, so wird ein Kupferblech
von 61 Quadratfuß Flaͤche erfordert, um durch den Boden den galvanischen
Strom eben so fortzuleiten, wie ihn dieser Draht leiten wuͤrde. Da die Dike
des Metalles hier gar nicht in Betracht koͤmmt, so wird die Herstellung der
erforderlichen Beruͤhrungsflaͤchen immer ohne bedeutende Kosten zu
erlangen seyn. Man erspart dadurch aber nicht nur die Haͤlfte der Leitung,
sondern kann auch den Widerstand im Erdreiche selbst kleiner als in der
Metallleitung machen. Versuche an dem hiesigen Probe-Telegraphen haben dieß
voͤllig bestaͤtigt.
Ein zweiter Theil der Leitungskette fuͤhrt von der k. Akademie nach meiner
Wohnung und Sternwarte in der Lerchenstraße. Diese Leitung besteht aus Eisendraht,
der hin und zuruͤk 6000 Fuß lang ist, und auf dieselbe Weise uͤber
Thuͤrme und hohe Gebaͤude gespannt wurde. Ein dritter Theil der Kette
endlich fuͤhrt im Innern des Gebaͤudes der k. Akademie nach der
mechanischen Werkstaͤtte des physikalischen Cabinettes, und ist ein 1000
Schuh langer duͤnner Kupferdraht, fortgefuͤhrt in den Fugen des
Fußbodens, zum Theil eingemauert. Diese drei Theile zusammen bilden eine in sich
selbst geschlossene Linie, in welche dann die Apparate zur Erzeugung des
galvanischen Stromes und die Zeichengeber eingeschaltet sind.
2) Apparat zur Erzeugung des
galvanischen Stroms.
Der Hydrogalvanismus oder der durch die Volta'sche
Saͤule erzeugte galvanische Strom ist nicht wohl geeignet, sehr lange Schließungsdraͤhte zu durchlaufen, weil
der Widerstand in der Saͤule, selbst wenn mehrere hundert Plattenpaare
angewendet wuͤrden, immer noch klein waͤre gegen den Widerstand in der
Leitungskette selbst. Was aber hauptsaͤchlich gegen Anwendung der Saͤulen oder
Trogapparate spricht, ist die Variabilitaͤt in ihrer Staͤrke und der
Umstand, daß sie nach kurzer Zeit ganz unwirksam sind, also wieder neu aufgebaut
werden muͤssen. Auch der sehr sinnreiche Telegraph von Morse unterliegt diesem Uebelstande. Alles dieß hoͤrt auf, wenn man
nach Faraday's wichtiger Entdekung den Strom durch
Induktion, d.h. durch Bewegung von Magneten gegen Metallleitungen erzeugt. Es ist
jedoch vortheilhafter, nicht die Magnete selbst zu bewegen, wie es Pixii bei seinem elektro-magnetischen Apparate
thut, sondern die Multiplicatoren zu drehen gegen feststehende Magnete. Im Ganzen
ist die Construction von Clarke mit einigen
Modifikationen hier angewendet worden. Wir duͤrfen bei unsern Lesern die
Kenntniß des Apparates im Allgemeinen voraussezen, und fuͤhren also hier nur
an, wie er dem Zwek der Telegraphie angepaßt wurde.
Der Magnet ist aus 17 Hufeisen von gehaͤrtetem Stahl combinirt. Er wiegt mit
der Armirung von Eisen circa 60 Pfd., und besizt eine Tragkraft von beinahe 300
Pfund. Zwischen den Schenkeln dieses Magnetes ist ein Metallstuͤk befestigt,
was in seiner Mitte eine mit Correctionsschrauben versehene Pfanne traͤgt,
die der Achse der Multiplicatorsrollen als Stuͤze dient. Die
Multiplicatorsrollen haben zusammen 15,000 Drahtumwindungen. Der Kupferdraht, von
dem 1 Meter 1053 Milligramme wiegt, ist doppelt mit Seide uͤbersponnen.
Dessen beide Enden sind isolirt im Innern der verticalen Drehungsachse des
Multiplicators hinaufgefuͤhrt, und enden dann in 2 hakenfoͤrmigen
Stuͤken, wie aus Fig. 14 und 15 zu ersehen
ist. Um die Isolirung sicher herzustellen, wurde die Verticalachse Fig. 14 hohl ausgebohrt.
In dieses Bohrloch kamen, von Oben hereingeschoben, 2 halbcylindrische
Kupferlamellen, die durch zwischengeleimten Taffet von einander getrennt, durch
Umwiklung mit Taffet aber von der metallenen Achse isolirt sind. In jeden dieser
Metallstreifen ist oben und unten ein Gewindloch geschnitten, und es sind in die
unteren Loͤcher kleine Metallzapfen eingeschraubt, an welche die Enden des
Multiplicatordrahtes fest geloͤthet wurden. In die oberen
Gewindloͤcher aber sind, wie Fig. 15 und 16 deutlich
zeigt, eiserne Haken eingeschraubt. Diese Haken bilden also die Enden des
Multiplicatordrahtes der Inductionsrollen. Sie greifen hier, Fig. 21, in
halbkreisfoͤrmige Queksilbernaͤpfe, die durch Holz von einander
getrennt sind. Von den Queksilbernaͤpfen gehen Leitungen J, J, Fig. 14 und 19, nach den
Ketten, so daß diese als ein eingeschalteter Theil der Leitungskette zu betrachten
sind. Das Queksilber steht in den halbkreisfoͤrmigen Gefaͤßen,
vermoͤge seiner Capillaritaͤt, hoͤher als die
Zwischenwaͤnde, so daß die Endhaken der Multiplicatordraͤhte, bei Drehung um ihre Achse,
uͤber die Zwischenwaͤnde hinweg gehen. Man sieht, daß nach einem
halben Umgange des Multiplicators die Endhaken die Queksilbernaͤpfe wechseln,
wodurch bewirkt ist, daß der galvanische Strom, so lange man den Multiplicator in
Einem Sinne herum dreht, dasselbe Zeichen behaͤlt, aber aͤndert mit
der Richtung, in welcher man den Multiplicator dreht. Diese Commutation, die sich
uͤbrigens auch ohne Queksilber durch Beruͤhrung federnder
Kupferstuͤke herstellen ließe, ist dem Zweke vollkommen entsprechend. Wir
muͤssen jedoch noch zwei besonderer Einrichtungen erwaͤhnen. Der
erzeugte galvanische Strom soll, wie aus der Natur der Zeichengeber spaͤter
erhellt, nur eine moͤglichst kurze Zeit hindurch wirken, aber waͤhrend
dieser Zeit sehr intensiv seyn. Es greifen daher die Endhaken des
Multiplicatordrahtes nur an derjenigen Stelle, wo die erregte Kraft am
groͤßten ist, ein in Ausbeugungen der Queksilbergefaͤße nach Innen,
Fig. 19,
20 und
21. Fig. 21. zeigt
die Lage des Inductors, bei welcher gerade die Endhaken in die Gefaͤße
eingreifen. In allen uͤbrigen Lagen des Inductors aber soll dieser von der
Kette ausgeschlossen seyn, damit die Zeichen der andern Stationen nicht durch den
Multiplicatordraht desselben gegeben werden muͤssen. Es ist dieß um so
wesentlicher, je groͤßer der Widerstand im Inductor ist. Um also fuͤr
alle anderen Lagen, als die in Fig. 21 dargestellte, den
Inductor auszuschließen, ist uͤber die Rotationsachse des Inductors ein
hoͤlzerner Ring, Fig. 17 und 18, geschoben.
Dieser Ring ist umgeben von einem kupfernen Reife, und in den Reif sind wieder 2
eiserne Haken eingeschraubt. Diese Haken tauchen, wie Fig. 20 zeigt, in die
halbkreisfoͤrmigen Queksilbernaͤpfe. In dem Augenblike aber, wo sie
uͤber die hoͤlzerne Zwischenwand hinweg gehen, tauchen die
Inductorhaken, welche mit ihnen einen Winkel von 90 Grad bilden, ein. Wenn also die
Multiplicatorhaken mit den Queksilbernaͤpfen in Verbindung stehen, sind die
Ausschließungshaken ausgeloͤst. In allen uͤbrigen Lagen aber sind die
Multiplicatorhaken ausgeloͤst, und es tauchen die Ausschließungshaken ein,
wodurch natuͤrlich bewirkt ist, daß der Strom, welcher von der andern Station
her etwa die Kette durchlaͤuft, direct durch die Ausschließungshaken, also
direct von einem Queksilbergefaͤße zum andern uͤbergeht, und nicht
erst den Inductordraht zu durchlaufen hat. Zur bequemen Bewegung des Inductors ist
endlich noch auf dessen Verticalachse ein horizontaler Balancier angebracht, der in
2 Metallkugeln endet, Fig. 5 und 6. Damit aber bei rascher
Drehung des Multiplikators das Queksilber nicht durch die eingreifenden Haken
zerstreut werde, ist noch ein cylindrischer Glasring uͤber das
Queksilbergefaͤß gesezt, Fig. 5. Bei jedem halben
Umgange sieht man das
Ueberspringen der Funken, wenn die Multiplicatorhaken ihre Queksilbernaͤpfe
verlassen.
Will man verzichten auf die Sichtbarkeit dieser Funken, die uͤbrigens durchaus
unwesentlich sind fuͤr die Anwendung des Instrumentes als Telegraph, so
laͤßt sich der Inductor ungemein viel einfacher construiren. Man muß dann nur
den Commutationsapparat unmittelbar uͤber den Anker sezen, und die
Rotationsachse weiter gegen den Balancier hin im Halse gehen lassen. Es ist alsdann
nicht noͤthig, die Achse zu durchbohren, sondern die Enden des Multiplicators
sind unmittelbar an 2 Kupferplaͤttchen durch Umwinden befestigt, welche
Kupferplaͤttchen in einen Holzring diametral gegenuͤber eingelassen
sind. Der Holzring aber ist auf die Rotationsachse aufgestekt und festgeklemmt. Auf
seinem cylindrischen Umfange ist außer den erwaͤhnten Kupferplaͤttchen
noch ein von Innen getrennter Absperrungsbogen von Kupfer eingelassen, und zwei
Enden der Kette, welcher der galvanische Strom mitgetheilt werden soll, bilden
feststehende, gegen den cylindrischen Holzring diametral gegenuͤber
andruͤkende Federn, so daß auch hier nur waͤhrend eines kleinen Theils
der halben Umdrehung die Enden des Inductors mit der Kette in metallischer
Beruͤhrung sind, die uͤbrige Zeit aber der Schließungsbogen die Enden
der Kette unmittelbar verbindet. Diese Construction, bei welcher durchaus kein
Queksilber vorkommt, verdient, ihrer groͤßern Einfachheit und Dauer wegen,
vor erstbeschriebener den Vorzug. Auch sind die Apparate auf den Stationen Bogenhausen und Lerchenstraße
nach derselben ausgefuͤhrt.
3) Die Zeichengeber.
Wir haben in vorstehender Abhandlung gezeigt, daß es die Aufgabe ist, den durch den
Inductor hervorgebrachten und durch die Leitungskette gefuͤhrten galvanischen
Strom dahin zu benuͤzen, daß er, an leicht drehbaren Magnetstaͤben
voruͤbergefuͤhrt, nach Oerstedt's Entdekung
Ablenkungen derselben bewirkt. Diese Ablenkungen muͤssen, wenn die Zeichen
schnell hinter einander bewirkt werden sollen, moͤglichst rasch, also
kraͤftig seyn. Dadurch aber sind die Dimensionen der abzulenkenden
Magnetstaͤbchen gegeben. Man darf diese jedoch auch nicht zu klein annehmen,
weil sonst die durch die Ablenkung resultirende mechanische Kraft zu klein wird, um
unmittelbares Anschlagen an Gloken etc. hervorzubringen. Die Ablenkungen sind,
bekannter Weise, bei gleicher galvanischer Erregung des Drahtes um so
staͤrker, je groͤßer die Anzahl der Umwindungen ist, oder je
oͤfter der Draht laͤngs dem Magnetstabe hin
voruͤbergefuͤhrt wird. Die Groͤße des Durchmessers der
einzelnen Umwindungen hat, wie bekannt, nur insofern Einfluß, als sie die
Laͤnge des Schließungsdrahtes im Ganzen vermehrt. Der Zeichengeber ist also
ein in die Leitungskette mit seinen beiden Enden eingeschalteter Multiplicator, in
welchem der abzulenkende Magnetstab steht. Man darf aber nicht vergessen, daß durch
ihn der Widerstand der ganzen Kette um so mehr vergroͤßert wird, je
duͤnner dieser Multiplicatordraht, je groͤßer die Umwindungen und je
groͤßer ihre Anzahl angenommen wird.
Fig. 22 und
23 stellt
nun einen solchen Zeichengeber in horizontalem und verticalem Querschnitte
abgebildet dar, der 2 um Verticalachsen drehende Magnete enthaͤlt, und sowohl
zum Anschlagen an Gloken, als auch zum Fixiren einer aus Punkten bestehenden Schrift
bestimmt ist. In den aus Messingblech zusammengeloͤteten Multiplicatorrahmen,
Fig. 23,
sind 2 Huͤlsen eingeloͤthet zur Aufnahme und freien Bewegung der
Achsen beider Magnetstaͤbchen. Sie sind oben und unten mit Gewinden
eingeschnitten und nehmen 4 Schrauben auf, welche den Achsen als Pfannen dienen.
Durch sie koͤnnen die Magnetstaͤbchen so gestellt werden, daß sie sich
voͤllig frei und leicht bewegen. In den Multiplicatorrahmen sind 600
Umwindungen desselben isolirten Kupferdrahtes, der den Inductor bildet, gelegt.
Anfang und Ende dieses Drahtes zeigt Fig. 22
M, M. Die Magnetstaͤbchen sind, wie aus der Figur
ersichtlich, in solchen Lagen im Multiplicatorrahmen, daß der Nordpol des einen, dem
Suͤdpol des andern zunaͤchst liegt. An diesen naͤchsten Enden,
die wegen ihrer Wechselwirkung nicht fuͤglich naͤher an einander
gebracht werden duͤrfen, sind noch 2 duͤnne Aermchen von Messing
angeschraubt, welche ganz kleine Gefaͤße tragen, Fig. 23 und 24. Diese
Gefaͤßchen, bestimmt zur Aufnahme schwarzer Oehlfarbe, haben kleine, sehr
fein durchbohrte und nach Vorne abgerundete Schnaͤbel. Wenn Oehlfarbe in die
Gefaͤße kommt, zieht sie sich vermoͤge der Capillar-Attraction
durch die Bohrung der Schnaͤbel und bildet an ihren Oeffnungen, ohne
auszufließen, halbkugelfoͤrmige Erhoͤhungen. Die leiseste
Beruͤhrung reicht also hin, einen schwarzen Punkt zu fixiren. Wird der
Multiplicatordraht dieses Zeichengebers galvanisch erregt, so streben beide
Magnetstaͤbchen, sich in demselben Sinne um ihre Verticalachse zu drehen. Es
wuͤrde also eines der Farbgefaͤßchen aus dem Multiplicatorrahmen
hervortreten, das andere in diesen hinein gehen. Um lezteres zu vermeiden, sieht man
in dem Spielraume zur Schwingung der Magnetstaͤbe zwei Platten
gegenuͤber befestigt, Fig. 23, gegen welche die
andern Enden der Magnetstaͤbe andruͤken. Es kann also immer nur eines
der Gefaͤße aus dem Multiplikator heraustreten, waͤhrend das andere in
Ruhe bleibt. Um die Magnetstaͤbchen nach vollbrachter Ablenkung rasch wieder
in die urspruͤngliche Lage zuruͤkzubringen, dienen gesonderte kleine
Magnete, deren Abstand
und Lage so regulirt wird, bis dieser Zwek erreicht ist. Diese Stellung muß durch
Versuche ermittelt werden, weil sie bedingt ist von der Intensitaͤt des
erregten Stromes.
Sollte dieser Apparat dienen, um durch Anschlagen an Gloken zweierlei leicht zu
unterscheidende hoͤrbare Toͤne zu geben, so wird man Uhrgloken oder
auch Glasgloken zu waͤhlen haben, die leicht ansprechen, und etwa um die
Sexte im Ton verschieden sind. Dieses Tonintervall ist keineswegs
gleichguͤltig. Man unterscheidet die Sexte leichter als jedes andere
Intervall, namentlich wuͤrden Quinten und Octaven bei minder Geuͤbten
zu haͤufiger Verwechslung Anlaß geben. Die Gloken kommen auf eine kleine
Stativsaͤule mit Fußplatte zu stehen, und muͤssen den Widerlagplatten
gegenuͤber in ihrer Stellung und in ihrem Abstand gegen die Magnetnadeln
durch Versuche regulirt werden. Sie muͤssen die Gloke an derjenigen Stelle
treffen, wo der Klang am leichtesten anspricht. Sie duͤrfen nicht zu nahe an
den Haͤmmern stehen, weil sonst leicht ein Nachklingen erfolgt. Aber alles
dieß ergibt sich leicht durch einige Versuche. Sollen die Zeichengeber schreiben, so
muß sich eine Papierflaͤche vor den Schnaͤbeln derselben mit
gleichfoͤrmiger Geschwindigkeit voruͤber bewegen. Am schiklichsten
waͤhlt man dazu sehr lange Streifen des sogenannten endlosen
Maschinenpapieres, welches man auf ein Holz aufwindet, und auf der Drehebank in
schmale Streifen absticht. Ein solcher Papierstreifen muß sich von einem Cylinder
abwikeln, an den Gefaͤßchen voruͤbergehen, dann eine Streke weit
horizontal fortgefuͤhrt seyn, um die aufgetragenen Punkte sichtbar zu machen
und endlich wieder auf einen zweiten Cylinder aufwinden. Dieser zweite Cylinder ist
von einem Uhrwerk gedreht, die Regulirung der Bewegung geschieht durch ein
Fugalpendel. Diese ganze Einrichtung ist aus Fig. 5 im
Laͤngendurchschnitt, in Fig. 6 aber von Oben
ersichtlich. Der Rahmen, uͤber welchen der Streifen hinweggeht, hat da, wo er
Eken bildet, 2 um Spizen bewegliche Cylinder zur Verminderung der Friction. Er kann
uͤberdieß verschoben werden im Abstande von den Magnetstaͤbchen, und
somit findet sich auch hier durch Versuche die vortheilhafteste Lage.
Natuͤrlich koͤnnen dieselben Magnetstaͤbe nicht gleichzeitig an
Gloken anschlagen und schreiben, weil schon eine dieser Operationen ihre kleine
Kraft erschoͤpft. Um aber beides zu erlangen, ist bloß noͤthig, noch
einen zweiten Zeichengeber mit in die Verbindung zu bringen. Ja man koͤnnte
auf diese Art durch Vermehrung der Anzahl der Apparate die Glokentoͤne
beliebig verstaͤrken, was jedoch auf Kosten eines groͤßeren
Widerstandes in der Kette geschehen wuͤrde. Um diesen uͤberhaupt
moͤglichst wenig zu vermehren durch die Zeichengeber, wird man besser in Zukunft deren
Multiplicationen aus sehr starkem Kupferdrahte oder Kupferblechstreifen zu bilden
haben.
Das bisher Gesagte wird fuͤr jeden Sachverstaͤndigen zur Herstellung
des Apparates ausreichen. Wir muͤssen aber noch einiges beifuͤgen
uͤber die
Zusammenstellung der Apparate.
Fig. 5 zeigt
den Laͤngendurchschnitt und die obere Ansicht eines pyramidalen, auf dem
Fußboden des Zimmers aufstehenden Tisches, der saͤmmtliche Apparate
enthaͤlt. Die Drahtleitung von Bogenhausen, die von der Lerchenstraße, die
Enden des Zeichengebers und 2 Leitungen aus den Queksilbergefaͤßen des
Inductors, also eigentlich auch die Enden seines Multiplicators, kommen in der Mitte
des Tisches, wie Fig. 6 zeigt, zusammen. Hier fuͤhren sie in 8 mit Queksilber
gefuͤllte Loͤcher, die in einem Holzcylinder angebracht sind, Fig. 9. Von der
Verbindung dieser 8 Enden unter einander haͤngt es nun ab, wohin der erregte
Strom geleitet wird. Waͤren z.B. diese 8 Loͤcher durch 4 Klammern von
Kupferdraht so verbunden, wie es Fig. 9 zeigt, so ginge der
erregte Strom durch saͤmmtliche Apparate und Ketten. Eine Verbindung wie in
Fig. 12
aber, wuͤrde die Kette von Bogenhausen ausschließen und also bewirken, daß
der Strom vom Inductor aus durch den Multiplicator und die Lerchenstraße ginge. Eben
diese Figur um 180 Grad gedreht, bewirkte das Ausschließen der Lerchenstraße und
fuͤhrte den Strom nach Bogenhausen. Ein drittes System von Verbindungen ist
durch die Kupferklammern von Fig. 13 gegeben. In der
Lage der Zeichnung waͤre der Inductor und Multiplicator verbunden, dagegen
die Lerchenstraße und Bogenhausen ausgesperrt. Diese Fig. 13 aber um 90 Grad
gedrekt, verbaͤnde Bogenhausen und die Lerchenstraße, so daß diese beiden
Stationen, mit einander communiciren koͤnnen, ohne daß man auf der Akademie
die Nachricht empfaͤngt. Diese dreierlei Systeme und Verbindungen sind nun in
einem hoͤlzernen Dekel mit Kupferdraͤhten eingetragen, Fig. 10. Aus diesem
stehen also 24 Drahtenden hervor. Es sollen aber immer nur 8 davon wirksam seyn,
deßhalb wurden in dem Cylinder, der die Queksilbergefaͤße enthaͤlt,
noch 16 Loͤcher angebracht, in denen kein Queksilber ist, und die bestimmt
sind zur Aufnahme derjenigen Drahtenden, die gerade nicht in Wirksamkeit seyn
sollen. So entsteht die Moͤglichkeit, den Strom in jeder gewuͤnschten
Richtung zu leiten, und es sind die betreffenden Verbindungen auf der Außenseite des
Dekels Fig. 8,
der die verschiedenen Verbindungssysteme enthaͤlt (Fig. 10), durch
beigeschriebene Buchstaben bezeichnet. S. Fig. 8. Durch Versezung
dieses Dekels gegen den
auf dem Tische befindlichen Pfeil kann also uͤber die Richtung des Stroms
beliebig disponirt werden. Natuͤrlich ließen sich statt
Queksilbernaͤpfchen auch hier konisch gebohrte Kupferstiften anbringen, was
auch auf den Stationen Bogenhausen und Lerchenstraße geschehen ist.
Wir haben jezt noch einige Worte beizufuͤgen uͤber die
Benuͤzung des Apparates zum Telegraphiren.
Nach dem Gesagten weiß man, daß, so oft der Balancier von Rechts nach Unten zur
Linken einen halben Umgang macht, einer der Zeichengeber abgelenkt wird. Ich habe
die Drahtenden so verbunden, daß bei dieser Bewegung jedesmal auf allen Stationen
die hohe Gloke angeschlagen wird. Steht man auf der Seite B,
B vor dem Apparate Fig. 6, so fixirt das
Schreibgefaͤß zugleich einen Punkt auf dem bewegten Papierstreif. Die
Zeitintervalle, in welchen man dieses Zeichen wiederholt, sind repraͤsentirt
durch die wechselseitigen Abstaͤnde der auf dem Papier in einer Linie sich
bildenden Punkte. Dreht man aber nun von Links nach Unten zur Rechten, so
ertoͤnen die tiefen Gloken, und das zweite Schreibgefaͤß traͤgt
jezt einen Punkt auf den bewegten Papierstreifen auf, der nicht mehr in derselben
Linie mit den ersteren liegt, sondern tiefer steht. So sind also die Toͤne
hoch, tief auf dem Papierstreifen, gleichsam wie
durch geschriebene Noten, dargestellt durch hohen Punkt,
tiefen Punkt. So lange die Zwischenzeiten zwischen
den einzelnen Zeichen gleich bleiben, bildet sich eine zusammengehoͤrige
Gruppe, sowohl in den Toͤnen, als in der sie darstellenden Schrift. Eine
laͤngere Pause trennt solche Gruppen kenntlich. Man ist dadurch also im
Stande, durch schiklich gewaͤhlte Combinationsgruppen als Bezeichnung
fuͤr das Alphabet oder fuͤr stenographische Zeichen irgend ein System
zu bilden, und dadurch den Gedanken an allen Punkten der Kette, wo Apparate wie der
beschriebene stehen, im Augenblike selbst wieder zu geben und zu fixiren. Das von
mir gewaͤhlte Alphabet gibt die in unserer Sprache am oͤftesten
wiederkehrenden Buchstaben durch die einfachsten Zeichen. Es hat sich eine
Aehnlichkeit zwischen den lateinischen Lettern und diesen Zeichengruppen herstellen
lassen, wodurch sie sich dem Gedaͤchtnisse leicht einpraͤgen. Die
Vertheilung der Buchstaben und Zahlen in Gruppen, die bis 4 Punkte enthalten, ist
aus Fig. 5
ersichtlich. (Aus der Vorlesung des Verf. uͤber Telegraphie, gehalten in der
koͤnigl. bayer. Akad. d. Wiss. am 25. August
1838.)
Tafeln