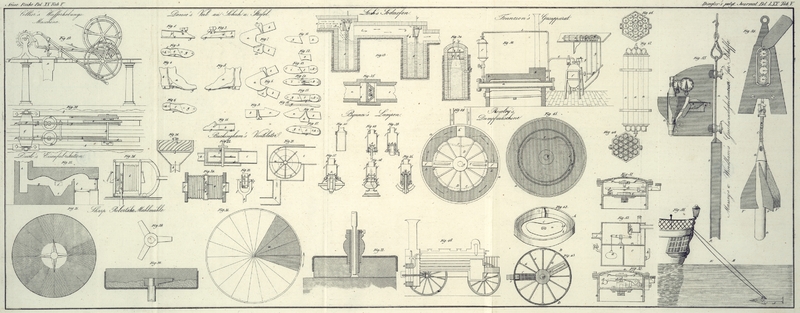| Titel: | Verbesserungen an den Vorrichtungen zum Ventiliren von Bergwerken, Schiffen etc., worauf sich James Buckingham, Civilingenieur von Miner's Hall Strand in der Grafschaft Middlesex, am 16. Novbr. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. LXXV., S. 341 |
| Download: | XML |
LXXV.
Verbesserungen an den Vorrichtungen zum
Ventiliren von Bergwerken, Schiffen etc., worauf sich James Buckingham, Civilingenieur von Miner's
Hall Strand in der Grafschaft Middlesex, am 16. Novbr.
1837 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Sept. 1838, S.
341.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Buckingham's Vorrichtungen zum Ventilliren von
Bergwerken.
Gegenwaͤrtige Erfindung besteht in drei verbesserten Apparaten, womit aus
Bergwerken, Schiffsraͤumen und anderen Orten die daselbst angesammelte
verdorbene oder auch brennbare Luft ausgezogen werden kann, damit sich das hiedurch
entstehende partielle Vacuum durch frische atmosphaͤrische Luft erseze. Der
erste dieser Apparate besteht in einem rotirenden Windfange, der in einem
geschlossenen Gehaͤuse enthalten ist, und der, waͤhrend er
umlaͤuft, die Luft mittelst eines Saugrohres, welches sich an dem einen Ende
in den zu ventilirenden Raum, an dem anderen dagegen lediglich in den Windfang
oͤffnet, aussaugt. Der zweite ist ein doppeltwirkendes Geblaͤs,
welches zur Erzeugung eines ununterbrochenen Luftzuges dient. Der dritte endlich ist
ein rotirendes Windrad, dessen Fluͤgel in schiefer Richtung gegen die Achse
gestellt sind, und welches sich an dem Ende oder an irgend einem anderen geeigneten
Theile der Zugroͤhre mit einem Gehaͤuse umgeben befindet. Die schiefen
Fluͤgel dienen zum Ausziehen und Forttreiben der verdorbenen Luft.
In Fig. 21
sieht man einen Laͤngendurchschnitt des ersten dieser Apparate, woran a der rotirende Windfang und b das Zugrohr ist, welches bis in den zu ventilirenden Raum geleitet
werden muß, waͤhrend die Maschine oder der Apparat in dem Maschinenraume oder
an irgend einem anderen geeigneten Orte untergebracht ist. Das zum Austritte der
verdorbenen Luft dienende Rohr c kann sich an irgend
einem Theile des Gehaͤuses befinden. Durch punktirte Linien angedeutet sieht
man eine an dem inneren Gehaͤuse angebrachte Oeffnung, durch welche die
verdorbene Luft in dieses Gehaͤuse, in welchem sich der Windfang befindet,
eintritt. Der Windfang ist so gebaut, daß seine Raͤnder die Baͤnde des
Gehaͤuses, welches ihn umschließt, beinahe beruͤhren, damit auf diese
Weise ein vollkommenes Vacuum und mithin ein staͤrkerer Zug erzeugt wird.
Noch deutlicher ersieht man aus dem Grundrisse, Fig. 22, die Stellung der
inneren Kammer und auch die Art und Weise, auf welche die verdorbene Luft an den
Windfang gelangt. e, e ist naͤmlich das
geschlossene Gehaͤuse, in welches die schlechte Luft durch die Oeffnung d gesaugt wird, waͤhrend deren Austreibung bei
der Roͤhre c Statt findet. Aus der Zeichnung ist
zu ersehen, daß die Zufuͤhrungsroͤhre bedeutend kleiner ist als die
Austrittsroͤhre; und daß die Einrichtung demnach so getroffen ist, daß die
verdorbene Luft bei ihrem Austritte wenig oder gar keinen Widerstand erfahrt.
Der Patenttraͤger gibt an, daß er die Zufuͤhrungsroͤhre
bisweilen direct an dem Windfange anbringt, wo dann weder ein inneres noch ein
aͤußeres Gehaͤuse noͤthig ist; doch gibt er dem beschriebenen
Apparate mit den beiden Gehaͤusen den Vorzug.
Fig. 23 zeigt
eine Modification dieses Theiles der Erfindung. Hier wird naͤmlich dem
Windfange die Luft um seine Achse herum durch die Roͤhren f, f zugefuͤhrt, an deren Enden, um dem Windfange
mehr Kraft zu geben, die Platten g, g angebracht sind.
Die verdorbene Luft wird in diesem Falle von allen Theilen des Umfanges des
Windfanges fortgetrieben und auf solche Weise in die atmosphaͤrische Luft
gestoßen. Derlei Apparate eignen sich hauptsaͤchlich fuͤr solche Orte,
wo es nicht darauf ankommt, daß die verdorbene Luft bis auf eine gewisse Entfernung
fortgetrieben wird; dagegen verdienen die zuerst beschriebenen Apparate auf Schiffen
und uͤberhaupt an allen Orten, an denen die verdorbene Luft ganz und bis auf
eine bedeutende Streke entfernt werden soll, den Vorzug.
Den zweiten Apparat, naͤmlich die doppeltwirkenden Geblaͤse, ersieht
man aus dem Grundrisse, Fig. 24, aus welchem die
gegenseitige Stellung der Ein- und Austrittsventile hervorgeht. In Fig. 25 sieht
man an diesem Apparate eine zu dessen Betrieb dienende Kurbelbewegung angebracht.
Eine der Luftkammern saugt hier durch das Zufuͤhrungsrohr die verdorbene Luft
an sich, waͤhrend die andere die Luft, welche vorher in sie gesaugt worden
war, ausstoͤßt. Die Wechselbewegung ist das Werk der Kurbel. Um die
Communication zwischen den beiden Luftkammern zu verhuͤten, ist zwischen
ihnen die Scheidewand c angebracht. Am Grunde dieser
Scheidewand befinden sich zwei oder mehrere, nach Innen sich oͤffnende
Zutrittsventile d, e, welche mit den beiden Kammern a, b communiciren. f, g
dagegen sind Austrittsventile, welche sich nach Außen zu oͤffnen. Wenn dieser
Apparat in Bewegung gesezt wird, so wird die verdorbene Luft bei den Ventilen d oder e in die Kammer a oder b gezogen; und wird
die Bewegung mittelst der Kurbel umgekehrt, so wird die schlechte Luft bald aus der
einen, bald aus der anderen der Kammern bei den Ventilen f oder g ausgetrieben.
Der dritte Apparat, naͤmlich das Rad mit den schief gegen die Achse gestellten
Fluͤgeln erhellt aus dem Durchschnitte Fig. 26, wo man auch die
Zufuͤhrungsroͤhre und das Gehaͤuse, in welchem das Rad
horizontal aufgezogen ist, sieht. Man kann diesen Apparat, je nachdem man die
Bewegung umkehrt, saugend oder treibend wirken lassen. Er eignet sich wegen seiner
Bequemlichkeit und Wohlfeilheit hauptsaͤchlich fuͤr solche Orte, an
denen kein großer Kraftaufwand erforderlich ist.
Tafeln