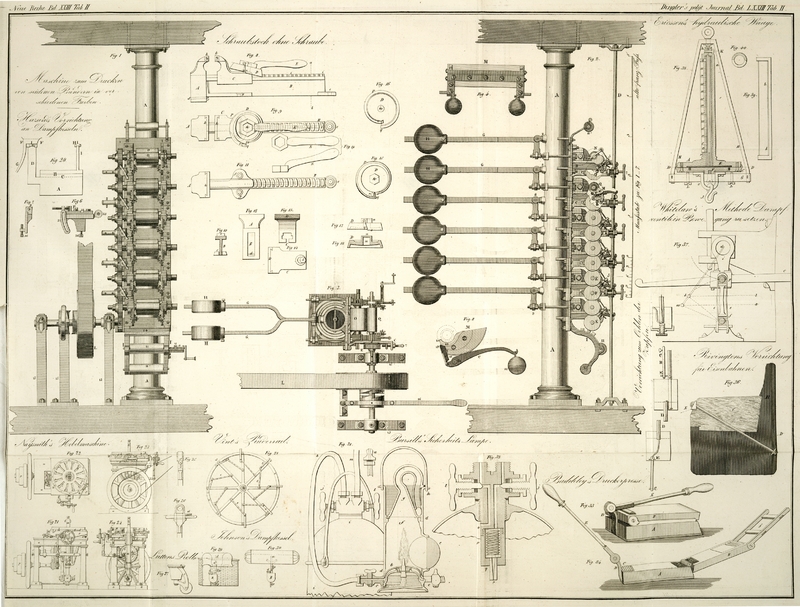| Titel: | Ueber eine neue hydraulische Waage. Von Hrn. CapitänI. Ericsson. |
| Fundstelle: | Band 73, Jahrgang 1839, Nr. XXIV., S. 97 |
| Download: | XML |
XXIV.
Ueber eine neue hydraulische Waage. Von Hrn.
CapitaͤnI.
Ericsson.
Aus den Transactions of the Society of arts im Mechanics' Magazine, No. 820.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Ericsson, uͤber eine hydraulische Waage.
Das Modell des zum Wägen bestimmten Instrumentes, welches ich hiemit der Gesellschaft
vorlege, ward schon vor mehr denn einem Jahre von mir verfertigt. Ich habe dasselbe
bei verschiedenen Temperaturen probirt, und bei diesen Versuchen stets gleiche
Resultate erhalten. Ich finde mich um so mehr zu dessen Vorlage veranlaßt, als es
sich, wie mir scheint, ganz besonders für Doks und Magazine, sowie auch für den
Gebrauch der Fuhrleute eignet.
Die Hauptaufgabe, welche ich mir bei der Anfertigung meines Instrumentes sezte, war
bei dem gewöhnlichen Abwägen, bei dem die Unzen nicht gezählt werden, die Gewichte
entbehrlich zu machen. Seine Haupteigenschaften sind folgende:
1) es ist keiner Reibung ausgesezt, weßhalb seine Angabe unter Zunahme der Gewichte
nicht an Genauigkeit einbüßen.
2) seine Theile haben eine beinahe unbemerkbare Bewegung, und sind daher der Abnuzung
nur in sehr geringem Grade ausgesezt.
3) das Gewicht kann im Momente, wo der zu wägende Gegenstand aufgehängt wird,
abgelesen werden.
4) wenn man das Instrument an den gewöhnlichen Hebezeugen aufhängt, so läßt sich das
Gewicht der Waaren etc. schon beim Auf- oder Abladen mit Genauigkeit
bestimmen.
Fig. 38 zeigt
einen Durchschnitt des Modelles meiner Vorrichtung. A
ist eine seichte umgekehrte Büchse aus Gußeisen, welche mit einem hohlen Schafte a ausgestattet ist. In diesen lezteren ist eine mit Gyps
gefütterte Glasröhre B eingesezt. An dieser Büchse A ist mit Zwischenlegung eines Stükes Kautschukzeuges,
welches einen wasserdichten Verschluß zu bilden hat, eine gußeiserne Platte C, in der sich ein weiter Ausschnitt befindet,
festgemacht. E ist eine kleine, in der Büchse A enthaltene Quantität Queksilber, welche auf dem
Kautschukzeuge D aufruht. Dieser Zeug wird von einer
Platte oder einem Kolben F getragen, und dieser ist
selbst wieder mittelst einer Schraube an dem unteren Querbalken G befestigt, welcher an den beiden Stangen H, H und dem Drehbolzen H,
der bei h zum Theil in den Schaft a, a so eingesezt ist, daß er sich darin schieben kann, aufgehängt ist.
I ist ein Bügel, welcher, ohne den Querbalken G zu berühren, an der unteren Seite der Platte C festgemacht ist, und in dessen Mitte sich ein Haken
befindet, an den der zu wägende Gegenstand gehängt wird. K ist ein kleiner Sperrhahn, welcher abgesperrt werden kann, wenn man das
Instrument nicht braucht, und der das Entweichen des Queksilbers, im Falle das
Instrument bewegt wird oder zufällig in horizontale Stellung geräth, verhindert. Von
dem Umfange des Schaftes a, a ist etwas mehr als der
vierte Theil weggeschnitten, damit man das Emporsteigen des Queksilbers beobachten
kann. An die eine Seite des Ausschnittes ist die Scala geschraubt. Obschon die
Glasröhre zu beinahe 3/4 durch den Schaft des Instrumentes geschüzt ist, so ist doch
noch für eine weitere Sicherung desselben, wenn man sich seiner nicht bedient,
gesorgt. Es wird nämlich, bevor man die Scala an den Schaft schraubt, über diesen
eine Röhre geschoben, welche man in Fig. 39 und 40 sieht.
Verschiebt man diese Röhre nach der einen Richtung, so wird die Glasröhre durch
ihren seitlichen Ausschnitt hindurch sichtbar; schiebt man sie hingegen wieder
zurük, bis ihr Rand b, b an die Scala anzuliegen kommt,
so ist die Glasröhre gänzlich eingeschlossen.
Die Platte F mit dem auf ihr befindlichen Queksilber wird
von den Stangen und dem Bolzen H getragen. Das Gewicht
des Schaftes a, a mit allen seinen Theilen, die Platten
A und C, der Bügel I mit dem Haken J schwimmen
hienach beständig auf dem Queksilber, welches folglich in der Röhre emporsteigt, bis
es ihnen das Gleichgewicht hält. Von diesem Punkte an beginnt die auf der Scala
befindliche Numerirung. Sämmtliche zu wägende Gegenstände werden mittelst des Hakens
J von der Platte A
getragen, und daher wird diese um so viel mehr auf das Queksilber drüken und
lezteres um so viel in der Röhre emportreiben, daß es der angehängten Last das
Gleichgewicht hält. Geeignet dürfte es seyn, in dem Balken G zwei Stell- oder Sicherheitsschrauben anzubringen, und die Enden
derselben so weit hinaufreichen zu lassen, daß die Platte C nicht so weit herabsinken kann, daß das Queksilber dadurch aus der Röhre
B überfließen könnte, im Falle dem Instrumente ein
Gewicht angehängt würde, welches über dessen Bereich hinaus ginge.
Die Gränzen, innerhalb welcher dieses Instrument als Waage dienen kann, sind durch
den Durchmesser des Kolbens und der Büchse, sowie durch die Länge der Glasröhre
bedingt. Ein Kolben und eine Büchse von 16 Zoll Durchmesser mit einer Röhre von 3
Fuß wirb z.B. für ein Gewicht von 3600 Pfd. ausreichen. Die größte Bewegung des
Kolbens wird an einem Instrumente von dieser Größe nur den hundertsten Theil eines
Zolles betragen. Der Wechsel in der Temperatur wird natürlich einen Wechsel im
specifischen Gewichte des Queksilbers bedingen; allein dieß ist von keinem Einflüsse
auf die Genauigkeit der
Angaben des Instrumentes; denn obschon sich das Queksilber in einem größeren Maaße
ausdehnt als das Material, aus dem die Büchse und der Kolben bestehen, so kann dieß
die Angaben des Instrumentes doch nur in directem Verhältnisse der Expansibilität
influenciren. Der geringe Irrthum, der in den Angaben obwalten wird, läßt sich
vollkommen corrigiren, wenn man die Scala nur an ihrem unteren Ende fixirt und ihr
oben für die Temperaturveränderungen freien Spielraum läßt. Zu bemerken ist, daß die
Glasröhre für alle Fälle 3/16 Zoll Weite bekommen, und daß der Raum zwischen dem
Umfange des Kolbens und der Büchse gleichfalls diese Dimension nie übersteigen soll,
wie groß auch das Instrument immer angefertigt werden mag.
Tafeln