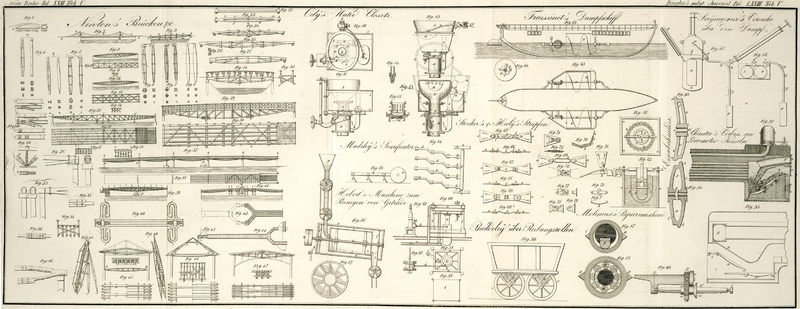| Titel: | Verbesserungen an den Water-Closets, worauf sich John Ody, am Strand in der Grafschaft Middlesex, am 13. Mai 1835 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 73, Jahrgang 1839, Nr. LXXX., S. 354 |
| Download: | XML |
LXXX.
Verbesserungen an den Water-Closets,
worauf sich John Ody,
am Strand in der Grafschaft Middlesex, am 13. Mai
1835 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Jul. 1835, S.
228.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Ueber Ody's verbesserte Water-Closets.
Das von mir verbesserte Wasser-Closet ist mit einem Wasserbehälter
ausgestattet, der das sogenannte Beken des Closets umgibt, und aus dem das Wasser
durch mehrere kleine Oeffnungen, die um den unteren Theil oder den sogenannten Hals
des Bekens herum angebracht sind, in das Innere des Bekens gelangt. Im Grunde des
Halses des Bekens befindet sich das gewöhnliche Auslaßventil. Das Beken ist demnach
gleichsam in das in dem Wasserbehälter befindliche Wasser versenkt, so zwar, daß das
Wasser in dem einen eben so hoch steht, wie in dem anderen. Wenn das Auslaßventil
auf die an den Water-Closets übliche Weise geöffnet wird, um den Inhalt des
Bekens auszuleeren, so strömt das in dem Wasserbehälter befindliche Wasser durch die
erwähnten Oeffnungen in das Beken, so daß der Ausfluß nicht bloß durch den Inhalt
des Bekens selbst, sondern auch durch den ganzen Inhalt des Wasserbehälters
befördert und beschleunigt wird, und man einer vollkommenen Entleerung des Bekens
versichert seyn kann. Wenn durch das Ausfließen des Wassers aus dem Wasserbehälter
der Wasserstand in demselben sinkt, so sinkt zugleich mit diesem auch ein Schwimmer,
und hiedurch wird der Sperrhahn einer Röhre geöffnet, die von einem höher gelegenen
Wasserreservoir herabsteigt, und durch welche mit Gewalt ein Wasserstrahl in den
hinteren und oberen Theil des Bekens einströmt. Innerhalb des Bekens ist vor der
Eintrittsmündung dieser Röhre auf die übliche Weise eine Platte angebracht, welche
den Wasserstrahl innerhalb des Bekens so vertheilt, daß dieses ringsum von dem
Wasser abgespült wird, bevor lezteres an dem Auslaßventile entweicht. Wann das
Auslaßventil am unteren Theile des Balkens geschlossen worden, so daß das in der
Zuflußröhre herbeiströmende Wasser nicht mehr bei ihm entweichen kann, so währt der
Wasserzufluß dennoch eine kurze Zeit über fort, damit sich das Wasser sowohl in dem
Beken selbst, als auch vermöge der in dem unteren Theile des Bekens befindlichen
Löcher in dem Wasserbehälter bis zu einer gewissen Höhe hinauf ansammle. In dem
Maaße, als das Wasser in dem Beken und in dem dieses Beken umgebenden Wasserbehälter
steigt, steigt auch der erwähnte Schwimmer, wo dann in Folge der Verbindung, in der
dieser mit dem
Sperrhahne der Zuflußröhre steht, dieser Hahn geschlossen und das Wasser sowohl im
Beken als im Wasserbehälter auf der gewünschten Höhe erhalten wird.
In Fig. 50
sieht man meinen Apparat in einer horizontalen Ansicht oder von Oben betrachtet.
Fig. 51
ist ein Fronteaufriß desselben; Fig. 52 ein Endeaufriß;
Fig. 53
ein senkrechter Längendurchschnitt.
Das Beken A, A, B, B kann entweder aus gebranntem Thon
oder auch aus Metall bestehen; sein unteres Ende oder sein Hals reicht nicht ganz
bis zum Rande der Mündung hinab, die mittelst des Auslaßventiles D geschlossen oder geöffnet wird; sondern es ist dafür
rings um das untere Ende des Halses B herum ein
ringförmiger Raum 1 gelassen. Durch diesen Raum kann das Wasser aus dem Behälter
2,2,3,3, der den unteren Theil des Bekens von Außen umgibt, aus- oder in
denselben eintreten. Der Behälter communicirt mit dem Beken durch eine Reihe von
Oeffnungen, welche aus Längenspalten, die in eine den Bekenhals umgebenden
cylindrischen Scheide 4,4 geschnitten sind, bestehen. An dieser Scheide ist das
Beken mit einem Kranze, der außen um den Hals B, B
läuft, und der auf einem entsprechenden, an dem oberen Ende der Scheide befindlichen
Kranz zu liegen kommt, befestigt, und zwar mit Hülfe von Schrauben und kleinen
Schraubenmuttern. Mittelst der Scheide 4,4 wird das Beken innerhalb des Behälters
2,3 in der ihm zukommenden Stellung erhalten, während zugleich unter der Mündung des
Bekenhalses bei 1,1 für das in dem Behälter 2,3 befindliche Wasser freier Durchgang
gelassen ist. Die am Boden des Wasserbehälters 2,3 angebrachte Scheide 5 paßt mit
ihrer Außenseite in einen kreisrunden Ring 6,6, welcher um die Mündung des
Auslaßventiles D herum einen vorspringenden Rand bildet.
Das Ventil selbst befindet sich in der metallenen Kammer E,
E, deren mit Schrauben befestigter Dekel F, F
die für das Auslaßventil bestimmte Oeffnung, um die herum die Leiste 6,6 läuft,
enthält. Die Kammer E, E, F, F dient allen über ihr
befindlichen Theilen des Apparates als Fundament, und endigt sich nach Unten in
einen kreisrunden, mit einem Kranze versehenen Hals G,
womit der Apparat am Boden des Gemaches, in welchem das Water-Closet
untergebracht werden soll, befestigt wird. Das Auslaßventil D ist an einer Spindel d aufgezogen, welche
durch eine Scheide, die zwischen dem Dekel F und dem
Kranze der Kammer E, E angebracht ist, sezt, und über
dieselbe hinaus ragt. An dem äußeren Ende dieser Spindel d ist ein kurzer, in Fig. 50 und 51
ersichtlicher Hebel befestigt, und in diesem Hebel befindet sich eine Fuge, die zur
Aufnahme eines Zapfens e, welcher an dem belasteten
Hebel H, f, L
festgemacht ist,
bestimmt ist. Zur Bewegung dieses Hebels H, f, L, dient
eine gerade Stange K, an deren oberem Ende ein zum
Aufziehen bestimmter Griff g angebracht ist. Zieht man
diesen Griff empor, so bewegt sich der Zapfen e des
Hebels H, f, L in der Fuge des kurzen Hebels h auf solche Weise, daß dadurch das Auslaßventil nach
Abwärts gedreht und geöffnet wird, wie man es in Fig. 53 sieht. In dem
Wasserbehälter 2,3 steigt eine Abflußröhre 8, 8, k, k,
deren oberer Theil 8,8 mit einem Schraubengewinde in dem Boden des Behälters
festgemacht ist, empor. Der untere Theil k dieser Röhre,
welcher durch dasselbe Schraubengewinde mit dem oberen Theile in Verbindung steht,
hat da, wo er in die Kammer E übergeht, eine heberartige
Biegung, damit in der Röhre 8, k eine zur Verhütung des
Aufsteigens von üblen Gerüchen hinreichende Wassermenge unterhalten wird. Die obere
Mündung der Abflußröhre 8,8 muß genau auf derselben Höhe stehen, bis zu welcher
hinauf das Wasser im Behälter 2,3, und mithin auch im Beken selbst reichen soll, wie
dieß durch punktirte Linien angedeutet ist. Alles Wasser, welches noch zufließt wenn
es einmal diese Höhe erreicht hat, wird durch die Röhre 8,8 wieder abfließen, so daß
diese Röhre demnach die Abflußrohre, welche an den
Ventil-Water-Closets gewöhnlich mit dem Beken A, A in Verbindung zu stehen pflegt, ersezt. M
ist die innerhalb des Bekens A an dem oberen und
hinteren Theile desselben befestigte Platte, durch welche das zufließende Wasser im
Beken herum verbreitet wird. Die Röhre N, die das Wasser
von einem höher gelegenen Reservoir herleitet, steht mit dem Beken durch einen
Sperrhahn 9 in Verbindung. An dem Drehzapfen dieses lezteren befindet sich ein
kleiner Hebelarm 11, und mit dem Ende dieses lezteren ist ein hohler Schwimmer 12
verbunden, der den Sperrhahn 9 öffnet, und der Wasser in das Beken A, A einfließen läßt, so oft das Wasser im Behälter 2,3
sinkt, und umgekehrt. Die Röhre N läßt sich durch eine
Schraube, wie sie zu dem sogenannten Bindegefüge (union
joint) gehört, mit dem Hahne 9 verbinden. Die Verbindung des Hahnes mit dem
Beken läßt sich bewerkstelligen, indem man ihn in eine Scheide P schraubt, welche außen an das Beken A, A gekittet, und an diesem mit denselben Schrauben
befestigt ist, welche zur Befestigung der Platte M an
der inneren Wand des Bekens dienen.
Mit einer leichten Modification des Bekens und des dasselbe umgebenden
Wasserbehälters läßt sich meine verbesserte Art von Water-Closets leicht auch
für Urinir-Closets in Gebäuden, in denen größere Zusammenkünste gehalten
werden, einrichten. In diesem Falle muß der obere Rand oder der obere offene Theil
des Bekens A, A ungefähr um 15 Zoll und an dem hinteren
Theile um noch mehr höher hinauf reichen, so daß der vordere Theil ungefähr um 9
Zoll niederer liegt, als der hintere, wie dieß in Fig. 53 durch punktirte
Linien bezeichnet ist. Der untere Theil A und der Hals
B des Bekens kann übrigens die in der Zeichnung
angegebene Stellung beibehalten. Will man Urinir-Closets nach meinem Systeme
bauen, so entspricht es der Reinlichkeit besser, wenn man den Wasserbehälter
gleichfalls aus Thon verfertigen läßt, was leicht thunlich ist, wenn man die Winkel
desselben abrundet.
Tafeln