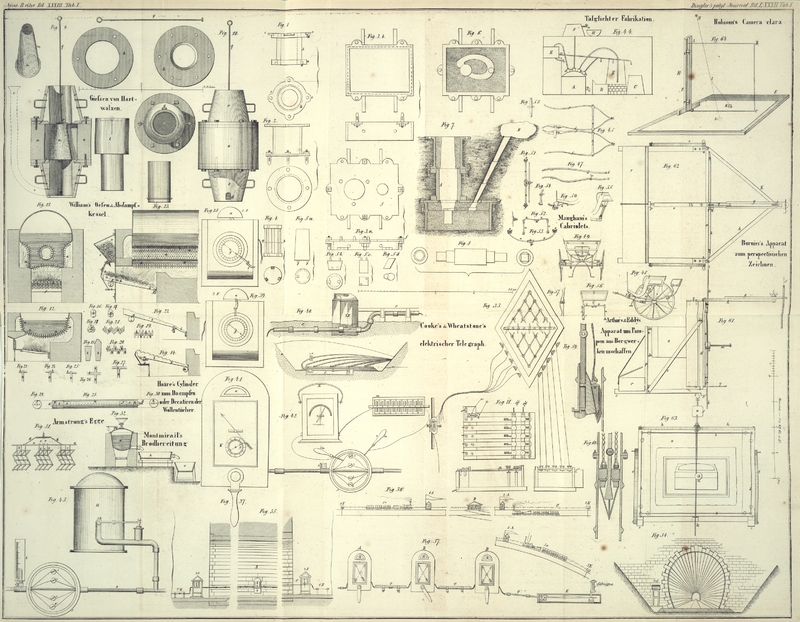| Titel: | Ueber verbesserte Talglichter-Fabrication; von F. Tritschler. jun. |
| Fundstelle: | Band 82, Jahrgang 1841, Nr. XIII., S. 44 |
| Download: | XML |
XIII.
Ueber verbesserte Talglichter-Fabrication;
von F. Tritschler. jun.
Auszug aus dem Correspondenzblatt des königl. würtemb.
landwirthschaftlichen Vereins.
Mit einer Abbildung auf Tab. I.
Tritschler's Talglichter-Fabrication.
Es sind nun 16 Jahre, daß ich mein Gewerbe als Seifensieder bei meinem Vater in
Kirchheim (Würtemberg) erlernte. Im Jahre 1828 ging ich nach Frankreich. Ich hatte
dort Gelegenheit, in den ersten Seifen- und Lichterfabriken von Straßburg,
Nancy, Paris, Lyon und Marseille zu arbeiten. Nach 3 Jahren ging ich nach Haus und
suchte hier mein Erlerntes in Anwendung zu bringen. Nach vielem Probiren erreichte
ich den Zwek, etwas Nüzliches zu Stande zu bringen, denn etwas Schönes haben wir schon längst, nämlich die Stearinlichter, aber diese
sind zu theuer, als daß sie mit Nuzen im Allgemeinen angewendet werden könnten. Mein
Zwek ging daher dahin, ein wohlfeiles Talglicht
hervorzubringen, das die Stearinlichter entbehrlich macht.
Meine Einrichtung ist aus Fig. 44 ersichtlich. Sie
besteht:
1) aus dem Dampfkessel
A, welcher 16 Imi hält und von dem aus vier Röhren von
2'' im Durchmesser in die Gefäße laufen, mit welchen ich arbeite. Jede dieser Röhren
hat einen messingenen Hahn dicht auf dem Kessel angebracht, und der untere Hahn ist
da, um das Wasser im Kessel auslaufen lassen zu können.
2) aus der Schmelzstande
B, worin das Unschlitt geschmolzen und geläutert wird.
Dieselbe ist 4 1/2 Fuß hoch und hat oben 2 1/2, unten 3' im Durchmesser. Die ganze
Stande ist mit Blei ausgeschlagen, was wegen der Anwendung von Schwefelsäure beim
Schmelzen nöthig ist. Auch das Dampfrohr, welches von Oben in der Mitte der Stande
bis auf 4'' auf deren Boden lauft, ist von Blei.
3) aus der Stande
C, welche rechts neben der Schmelzstande aufgestellt ist
und ungefähr 8 bis 9 Cntr. geschmolzenes Unschlitt faßt. Dieselbe ist ebenfalls
unten weiter als oben und dient zur einstweiligen Aufbewahrung des geschmolzenen
Unschlitts, bis die Schmelzstande zum Läutern wieder zugerichtet ist.
4) aus der Stande
D, welche links an der Schmelzstande steht und ungefähr
8 Imi hält. Sie dient zur Aufnahme des Sazes vom Schmelzen, welcher durch einen
Zapfen an der Schmelzstande hier eingelassen werden kann.
5) aus dem Vorwärmer
E, welcher sich 3' oberhalb des Dampfkessels befindet
und aus einem hölzernen Gefäß besteht, das 7–8 Imi Wasser hält, welches man
mittelst eines Pumpbrunnens hineinbringt. Dasselbe kann durch ein Rohr vom
Dampfkessel erwärmt werden; durch ein anderes Rohr dagegen, das am Vorwärmer
angebracht ist, kann das Wasser des lezteren in alle drei Standen B, C, D mittelst Hahnen gelassen werden.
6) aus dem Tunkkessel
F, welcher ein Stokwerk höher in der Lichterstube sich
befindet und aus einer hölzernen Stande besteht, in welche ein kupferner Kessel
genagelt ist, der mit Blei ausgeschlagen wurde und etwa 3 Cntr. geschmolzenen Talg
faßt. Der Dampf, welcher diesen Kessel bloß von Außen erwärmt, geht vom Dampfkessel
aus senkrecht durch ein kupfernes Rohr in die Mitte des Bodens der Stande, füllt so
den Raum zwischen der Stande und dem kupfernen Kessel aus und wird von da mittelst
eines Hahnes in den eisernen Kessel H geleitet.
7) aus der Kühlbütte, welche in der Seifensiederei neben
dem Siedekessel steht und etwa 6 Eimer faßt. In diese läuft gleichfalls ein
kupfernes Rohr, das am Ende in zwei Röhren sich vertheilt, damit die Stande, welche
oval ist, gleicher geheizt werden kann.
8) aus dem sogenannten Salzlaugebehälter, in welchen das
Wasser von den drei Standen B, C, D, so wie von dem
Dampfkessel A durch einen Canal abgelassen werden kann.
Von hier aus wird die ganze Flüssigkeit, verbunden mit den fleischigen Theilen des
Unschlitts, als Dünger benuzt. Dieses vortreffliche
Dungmittel kann ich nicht genug, namentlich den Seifensiedern auf dem Lande,
empfehlen.
Meine Verfahrungsart ist nun folgende.
I. Durch Dampf mit Schwefelsäure Talg zu
schmelzen.
Sobald das Wasser im Dampfkessel A siedet, was längstens
innerhalb einer Stunde der Fall ist, bringt man das gestoßene rohe Unschlitt in die
Schmelzstande B und sezt je einem Centner 5/4 Pfd. Säure
zu, so wie solche im Handel vorkommt, nämlich von 60–66°, welche mit
dem 20fachen Wasser vermischt wird. Ich seze gewöhnlich 6 Cntr. Unschlitt an und
nehme dazu 7–8 Pfd. Schwefelsäure in 2 (4?) Imi Wasser gemischt. Ist nun
Alles bei einander, so läßt man 1 1/2–2 Stunden lang Dampf einströmen und
rührt von Zeit zu Zeit ein wenig um, so daß die Säure auf die Zellengewebe gleichen
Eindruk machen kann, also das Unschlitt gleichmäßig schmilzt.
II. Das geschmolzene Unschlitt von der
Säure zu befreien.
Zuerst läßt man das geschmolzene Unschlitt eine halbe Stunde in der Schmelzstande B sizen, hernach schöpft man dasselbe bis auf das Wasser
in die Stande C, läßt das Wasser sammt dem Unschlittsaz
in die Stande D ab und reinigt die Schmelzstande.
Hierauf wird in die Schmelzstande 8 Imi Wasser eingelassen, und sobald dieses warm
ist, bringt man den geschmolzenen Talg dazu, rührt das Ganze 10 Minuten lang um und
läßt es bis zum Siedpunkt heiß werden. Nun bringt man auf den
Centner einen Schoppen 5gradige Kalilauge und 1 Pfd. Kochsalz, rührt das
Ganze wieder kurze Zeit um und läßt es 4–5 Stunden stehen. Gewöhnlich richtet
man es, daß das Unschlitt über Nacht stehen bleibt.
Hiebei ist das gehörige Maaß von Kalilauge besonders zu beachten. Sobald nämlich nur
das Mindeste mehr Kali genommen wird, als zur Tilgung der Säure nöthig ist, bildet
sich ein kaum bemerklicher Seifenleim und Lichter aus solchem Unschlitt mit freiem
Kali sind wegen ihres Wassergehalts durchaus unbrauchbar. Wird zu wenig Kali
genommen, so enthält das Unschlitt noch freie Säure und, wenn Lichter von solchem
Unschlitt auch anfangs gut brennen, so werden sie doch, wenn sie 3–4 Wochen
aufbewahrt sind, so ablaufen, daß sie ganz untauglich sind. Erst, wenn man das so
geschmolzene Unschlitt wieder von seiner Säure zu befreien versteht, kann man
dasselbe zum Lichtermachen anwenden. Es behaupten zwar Viele, daß man solches
Unschlitt auch nicht zur Seife brauchen könne, – aber dieß ist unrichtig,
denn ich habe schon mehrere hundert Centner Unschlitt davon saponificirt und es ist
mir noch kein Hindermß dabei in den Weg gekommen. Jedoch bei den Lichtern stimme ich
ein. Es ist unmöglich, ein Unschlitt, das Säure enthält, zum Lichtermachen
anzuwenden, sondern die Säure muß vollständig entfernt seyn.
III. Das säurefreie Unschlitt vom Wasser
zu befreien.
Es ist öfters der Fall, daß man Unschlitt verarbeitet, so lange es noch auf dem
Wasser sizt; ich kann dieß jedoch nicht billigen, denn es ist selten, daß solches
Unschlitt kein Wasser enthält. Man bringe deßwegen das geläuterte Unschlitt in den
Kessel F, in welchen der Dampf nicht einströmt, und
erwärme es hier, bis es ganz hell ist. So geht man ganz sicher und kann für seine
Waare garantiren.
IV. Den Saz, den man beim Schmelzen und
Läutern erhält, zu behandeln, so daß er auch zu Lichtern verwendet werden
kann.
Das Wasser, welches man nach dem Schmelzen in die Stande D läßt, muß man jedesmal erkalten lassen, und man findet dann auf der
Oberfläche einen 1/2–1'' diken Rand von Unschlitt, welchen man mit einem
Messer abschabt und hernach abwascht, um solches zum Lichterunschlitt gebrauchen zu
können. Ferner findet man unter diesem Rand eine braune Masse, welche auch noch
etwas Unschlitt enthält und auf dem Wasser schwimmt. Diese bringt man in ein dazu
bestimmtes Gefäß, in welchem diese Ueberreste gesammelt werden, bis es hinreicht,
die Schmelzstande damit zu füllen. Ist nun so viel gesammelt, so läßt man die Masse
mit 7–8 Imi Wasser vermischt 12–18 Stunden gemäßigt sieden; hierauf
läßt man Alles noch 7–8 Stunden ruhig stehen, worauf man schönes, Helles
Unschlitt auf der Oberfläche des Wassers stehen sieht, welches man, wie das erstere,
eben so gut zu Lichtern verwenden kann; nur muß man es noch von der Säure
scheiden.
Die Vortheile, welche mein Verfahren darbietet, bestehen
nun in Folgendem.
1) Man kann nach meiner Verfahrungsart innerhalb 48 Stunden eine eben so weiße
Talgkerze bereiten, als man nach der bisherigen Weise in 3 Monaten durch das Lagern
erhält.
2) Wenn man auf die gewöhnliche Art gute und helle Lagerlichter machen will, so muß
man immer das schönste, frischeste Unschlitt herauslesen, kann nur 2/3 davon
gebrauchen, während ein Drittel, das in Ausschnitt und Broken besteht, unbrauchbar
ist, und kann Schafunschlitt oder ganz mageres Ochsen- und Rinderunschlitt
gar nicht anwenden. Bei meiner Verfahrungsart aber kann alles Unschlitt, wenn es nur
nicht verdorben ist, angewendet werden, und troz dem müssen meine Lichter noch
Heller und so lang brennen, als die besten Lagerlichter.
3) Man braucht bei meiner Behandlung nach genauer Berechnung die Hälfte weniger Holz
und beim Schmelzen und Läutern des Unschlitts die Hälfte weniger Arbeit und
Zeit.
4) Man erhält 5 Proc. mehr Unschlitt.
5) Es kann durch Dampf das Unschlitt mehr denn 10mal erwärmt werden, ohne daß es
seine Farbe verändert, welche, wenn man über freiem Feuer arbeitet, schon beim
erstenmal verdorben werden kann.Man vergl. den Bericht über Taulet's Apparat zum
Ausschmelzen des Talges mittelst Dampf im polyt. Journal Bd. LXXVIII. S. 318.
Tafeln