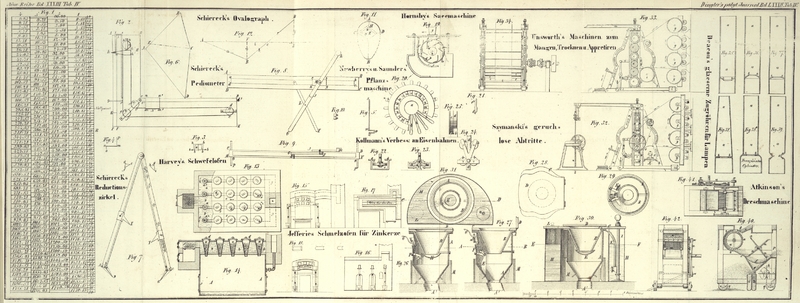| Titel: | Verbesserungen in der Gewinnung des Schwefels aus Schwefelkies, worauf sich James Harvey, am Bazing-place, Waterloo road, in der Grafschaft Surrey, am 8. Jul. 1840 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 82, Jahrgang 1841, Nr. LXV., S. 273 |
| Download: | XML |
LXV.
Verbesserungen in der Gewinnung des Schwefels aus
Schwefelkies, worauf sich James
Harvey, am Bazing-place, Waterloo road, in der Grafschaft Surrey,
am 8. Jul. 1840 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts. Sept. 1841, S.
115.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Harvey's Darstellung des Schwefels aus Schwefelkies.
Diese Verbesserungen in der Gewinnung des Schwefels aus Schwefelkies bestehen in
einer vervollkommneten Procedur und einer neuen Ofenconstruction, mit deren Hülfe
der Schwefel auf eine raschere und ökonomischere Weise als in den Oefen gewöhnlicher
Bauart aus Schwefelkies u.s.w. gewonnen werden kann. Die schwefelhaltigen Stoffe
kommen in kegelförmige Tiegel, welche in den Feuercanal eines Ofens eingesezt, durch
Kohks, Holzkohle oder Torf erhizt und während der Operation auf einem regelmäßigen
Temperaturgrad erhalten werden. Die Intensität der Ofenhize sollte so beschaffen
seyn, daß sie den Schwefel aus dem Erze sublimirt, ohne das Erz zu calciniren oder
zusammenzubaken, was bei allzu intensiver Hize der Fall seyn würde.
Fig. 13
stellt den verbesserten Ofen im Grundriß dar, wobei einige Theile weggelassen sind,
um gewisse darunter befindliche Theile im Durchschnitt zu zeigen; Fig. 14 ist ein durch den
Feuercanal, die Tiegel und den Schornstein geführter senkrechter Längendurchschnitt
des Ofens. Die kegelförmigen Tiegel a, a, a bestehen aus
Eisen, feuerfestem Thon, oder einem sonstigen geeigneten Material; sie sind in die
Feuercanäle b, b des Ofens eingesezt, indem sie in
kreisrunden, in die vierekigen Baksteine c, c, c
geschnittenen Oeffnungen ausruhen; diese Baksteine bilden den obern Theil oder die
Deke der Feuercanäle. Die unteren Enden der Tiegel ragen durch andere kreisförmige,
in denjenigen Baksteinen befindliche Oeffnungen heraus, welche den Boden der
Feuercanäle und die Deke der Condensationskammer bilden, wie Fig. 14 zeigt. Die Seiten
der Feuercanäle sind aus Baksteinen gebaut, oder aus solchen Ziegeln, wie sie als Wände
zwischen den kegelförmigen Tiegeln aufgeführt sind. Der ganze Ofen ist mit einem
starken Mantel aus Baksteinen oder Mauersteinen umgeben. Die oberen Enden der Tiegel
a, a, a sind durch Dekel d,
d, d verschlossen, ihre unteren Enden dagegen sind mit einer durchlöcherten
Platte oder einem Roste e, e, e versehen, welcher das im
Tiegel befindliche Material trägt, dem Schwefel jedoch gestattet, in dampfförmigem
Zustande zu entweichen.
Nachdem das Brennmaterial in dem Ofen bei f angezündet
worden ist, nimmt die Flamme, wie die Pfeile in Fig. 13 andeuten,
zunächst ihren Weg längs des Mittlern Feuercanals, die Seiten der konischen Tiegel
bespielend. An dem Ende des Canals in der Nähe des Schornsteins anlangend, biegt
sich die Flamme um die beiden Endtiegel a¹, a¹ und tritt rechts und links in die beiden
Seitencanäle. Nun kehrt die Hize diesen Canälen entlang nach der Vorderwand zurük,
biegt sich um die Tiegel a², a² und entweicht endlich bei g, g in den Schornstein.
Um diesen verbesserten Proceß gehörig zu leiten, müssen die Tiegel mit einer
hinreichenden Quantität von Schwefelkies oder andern schwefelhaltigen Stoffen
gefüllt werden. Man zerbricht das Material in ungefähr faustgroße Stüke. Die auf das
Erz in den Tiegeln einwirkende Hize treibt nun den Schwefel in Dampfform heraus.
Dieser findet, da er aufwärts nicht entweichen kann, durch die durchlöcherte Platte
oder den Rost e, e am Boden eines jeden Tiegels einen
Ausweg in die darunter befindliche Kammer A, A. Leztere
kann aus Schieferplatten, Eisen oder einem andern passenden Material bestehen, und
ihr Boden dürfte mit einer wenige Zoll tiefen Wasserschichte bedekt seyn. Das Wasser
zieht die Schwefeldämpfe an und veranlaßt dieselben, an dem unteren Theile des
Behälters in Gestalt von Schwefelblumen sich zu verdichten.
Wenn die Trennung des Schwefels vom Erze vollständig erfolgt ist, so läßt man den
Ofen abkühlen, leert darauf die Tiegel und füllt sie wieder. Dabei können die Tiegel
entweder an ihrer Stelle bleiben, oder durch einen eigens hiezu vorgerichteten Krahn
aus ihren Lagern gehoben werden. Die Dekel d, d der
Tiegel dürfen nicht luftdicht, sondern nur so dicht schließen, daß sie eine geringe
Quantität atmosphärischer Luft zulassen, das Entweichen einer bedeutenden Quantität
Dämpfe aber verhüten. Der Zug durch die Tiegel wird durch die aus der
Condensationskammer führende, mit einem Hahn oder Ventil versehene Röhre i regulirt. Mit Hülfe dieser Röhre wird ein ganz
schwacher Luftstrom durch die Tiegel und die Condensationskammer unterhalten. Der
Zwek dieses Luftstroms ist, die Trennung des Schwefels von dem Eisen im Schwefelkies,
oder die abwärtsgehende Sublimation dieses Productes zu befördern. Der an obiger
Rohre befindliche Hahn muß so regulirt werden, daß er den Zug mäßigt und die
Verbrennung des Schwefels verhütet. Der condensirte reine Schwefel wird durch die
Thüren j, j aus der Kammer geschafft. Die am Boden der
Cisterne befindliche Flüssigkeit kann man gleichfalls entfernen und auf irgend eine
geeignete Weise in Schwefelsäure verwandeln.
Tafeln