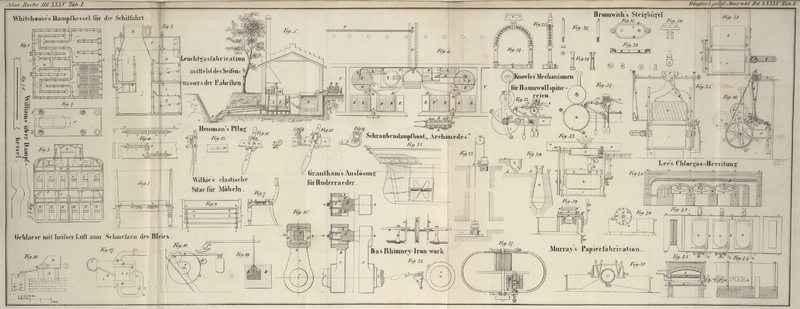| Titel: | Ueber Leuchtgasfabrication mittelst des Seifenwassers der Fabriken; von Hrn. Houzeau-Muiron. |
| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. XI., S. 25 |
| Download: | XML |
XI.
Ueber Leuchtgasfabrication mittelst des
Seifenwassers der Fabriken; von Hrn. Houzeau-Muiron.
Aus den Annales de Chimie et de Physique. Febr. 1842,
S. 250.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Houzeau-Muiron, uͤber Leuchtgasfabrication mittelst
des Seifenwassers der Fabrikation.
Das Seifenwasser, welches zum Entfetten der Wollentuche gedient hat, sammelt man
sogleich, nachdem es mit dem Fett und den Unreinigkeiten der Gewebe gesättigt worden
ist. Man benuzt hiezu hölzerne Fässer, welche 100 Liter fassen (die zum Entfetten
dienende Seife hat meistens Kali zur Basis).
Fuhrleute durchfahren täglich mehrmals die Stadt (Rheims) mit Wagen, welche zehn
Fässer (jedes von einem Hektoliter) aufnehmen können, um das Seifenwasser der
Fabriken zu sammeln. Jeder von einem Pferd gezogene Wagen liefert täglich 60 bis 80 Hektoliter
in die Gasanstalt. In dem Hofe derselben angekommen, halten die Wagen vor einer
Oeffnung A, Fig. 5, welche mit dem
Innern des zur Behandlung der Seifenwasser bestimmten Gebäudes communicirt. Der zum
Transport des Seifenwassers dienende Wagen ist mit zwei Trögen aus Weißblech (Fig. 5 und 6) versehen,
die in ein Rohr endigen, welches man mit einer in den Behälter für das Seifenwasser
einmündenden Rinne C verbindet. Auf diese Weise lassen
sich die Fässer schnell und ohne Mühe ausleeren.
Sobald der Behälter D mit Seifenwasser gefüllt ist (er
faßt beiläufig 140 Hektoliter), gießt man 70 Kilogr. concentrirte Schwefelsäure,
welche zuvor mit ihrem doppelten Gewichte Wasser verdünnt wurde, hinein. Wo die
Salzsäure wohlfeil ist, kann man auch diese benuzen; man muß von ihr doppelt so
viel, nämlich 140 Kilogr. anwenden. Nach dem Eingießen der Säure rührt man die
Flüssigkeit rasch um, bis die Zersezung vollständig ist. Bald darauf bildet sich ein
schmuziggrauer Schaum, wenn das Seifenwasser vom Entfetten ungefärbter Wolle
herrührt; 12 Stunden nach dieser Operation im Sommer oder 18 Stunden darauf im
Winter ist die Zersezung hinreichend vorgeschritten, um 8/10 des Wassers ablaufen
lassen zu können. Lezteres ist klar, etwas gelblich und enthält beiläufig 1 Proc.
schwefelsaures Kali; wenn man es benuzen wollte, müßte man es entweder in einem
Gradirhause verdampfen oder auf trokene, der Luft ausgesezte Erde ausgießen, welche
man auslaugen würde, nachdem sie genug mit Salz geschwängert ist.
In dem Maaße, als das klare Wasser abläuft, sinkt die auf ihm schwimmende Fettmasse
auf den Boden des Behälters; lezterer ist unten mit einer Bleiröhre versehen, welche
außerhalb so hoch aufgebogen ist, daß ihre Spize über die Fettmasse-Säule
hinaufreicht, so daß in keinem Falle Fetttheile mit dem Wasser fortgerissen werden
können.
Sogleich nach dem Ablassen des entfetteten Wassers wird der Behälter mit einer neuen
Quantität Seifenwasser gefüllt; die Fettmasse von der vorhergehenden Operation
steigt dann auf die Oberfläche. Man öffnet nun eine Klappe E, welche mit einer großen Kufe F communicirt.
Die Tiefe dieser Klappe entspricht der Höhe der Fettmasse. Um das Auslaufen der
lezteren zu befördern, führt man in der ganzen Länge des Behälters eine senkrechte
Scheidewand herum, welche das Fett an die Oeffnung der Klappe zusammendrängt. Bald
nach dem Abnehmen des Fettes säuert man neuerdings und fährt so täglich fort.
Das erhaltene Product ist ein Gemenge von unverändertem Oehl, fetten Säuren, thierischen
Stoffen und Wasser. In dieser Masse ist das Wasser gewissermaßen chemisch gebunden,
so daß es bei gewöhnlicher Temperatur nicht verdunstet, sondern nur durch
Verdampfung bis auf die lezten Antheile abgeschieden werden kann.
Um die Kosten des Abdampfens zu vermeiden, wobei sich überdieß die Oehle färben
würden, bringt man die Fettmasse mit ihrem acht- bis zehnfachen Gewicht
Wasser in eine große Kufe F, welche durch eine
Scheidewand G in zwei Theile getheilt ist. Die Masse
fällt in die erste Abtheilung, trennt sich von einem Antheil Wasser und steigt,
unter der Scheidewand durchgehend, in der großen Abtheilung der Kufe I in die Höhe. Man läßt durch den Hahn J das niedergeschlagene Wasser auslaufen; die
Absonderung des Wassers wird sehr befördert, wenn man durch die Röhre K Dampf einströmen läßt, welcher die ganze Masse erhizt.
Man nimmt dann den oberen Theil der Fettmasse heraus und bringt ihn in einen höheren
Behälter, welcher ebenfalls durch Dampf erhizt ist. Ein gewisser Antheil Wasser
sondert sich noch ab; um das Oehl aber vollständig zu entwässern, läßt man die Masse
aus dem Behälter L in einen kupfernen Kessel auslaufen;
bei raschem Sieden und beständigem Umrühren verdampfen die lezten Antheile Wasser.
Unmittelbar darauf wird das Product in kupferne Behälter gegossen; es enthält
20–25 Proc. Unreinigkeiten, welche es trüben und färben; um diese
abzusondern, versezt man es mit 2 Proc. concentrirter Schwefelsäure und rührt stark
um; zwei Tage darauf sammelt sich das klare Oehl auf der Oberfläche und die
Unreinigkeiten haben sich niedergeschlagen. Man nimmt das Oehl vorsichtig ab, den
Rükstand aber, welcher ein Gemisch von Oehl und fremdartigen Körpern ist, gießt man
in leinene Filter, welche in einer geheizten Stube stehen. So gewinnt man den
größten Theil des in den Niederschlägen enthaltenen Oehls.
Der Rükstand von den vorhergehenden Operationen ist schwarz und sehr dik; er läßt
sich vortheilhaft zur Leuchtgasbereitung benuzen. Da es schwierig wäre, diese Art
Fett mit Regelmäßigkeit in die Retorte zu leiten, so macht man es mittelst des bei
einer vorhergehenden Operation gewonnenen empyreumatischen Oehls flüssig; jeder Tag
liefert so viel Theer, als man braucht, um das Fett am folgenden Tage flüssig zu
machen.
Das durch Zersezung dieser Masse erhaltene Gas wird mit Kalkwasser gereinigt;
lezteres enthält dann Cyancalcium, daher man es mit schwefelsaurem Eisen versezt, um
Berlinerblau zu gewinnen; der entstehende schwarze Niederschlag wird mit Salzsäure
gewaschen, wobei ein dunkelblauer Rükstand bleibt.
Dieses Gas besizt eine bedeutende Leuchtkraft, denn ein Kubikfuß gibt eine Stunde lang ein Licht
gleich dem einer Carcel'schen Lampe, welche 48 Gramme
Oehl stündlich verbrennt; um das Licht einer gewöhnlichen Werkstattlampe zu
erhalten, betragen also die Kosten des Gases nur beiläufig 4 Centimes stündlich, da
der Kubikfuß auf 6 Centimes zu stehen kommt.
Ich mußte viele Versuche anstellen, bis es mir gelang, die fremdartigen Substanzen
vollständig von dem Oehl abzusondern, so daß lezteres in den Handel gebracht werden
konnte; es mußte aber zugleich der Rükstand selbst benuzt werden können: deßhalb war
ich genöthigt, eine Methode das Gas zu transportiren, welche einfach, wohlfeil und
wenig gefährlich ist, zu schaffen.
Nach diesem Verfahren wird das Gas in einem cylindrischen Recipienten, welcher aus
einem elastischen Gewebe besteht, gesammelt; indem man den oberen und unteren Boden
desselben gegen einander drükt, zwingt man das darin enthaltene Gas zu entweichen
und sich in den Behälter des Consumenten zu begeben; der Wagen, welcher den
elastischen Recipienten führt, ist deßhalb mit einer biegsamen Röhre versehen,
welche man durch ein anzuschraubendes Rohr mit dem im Hause des Consumenten
befindlichen Gasbehälter verbindet. Wenn der Wagen in die Gasfabrik zurükgekehrt
ist, füllt man ihn neuerdings, nachdem man dem Gasometer der Fabrik einen Theil
seines Gegengewichts abgenommen hat, worauf das Gas rasch ausströmt und den
Recipienten auf dem Wagen schnell anfüllt.Ein solcher Apparat ist im polyt. Journal Bd. LXXIV. S. 272 beschrieben und abgebildet worden; über des
Verfassers Leuchtgasbereitung wurden bereits im polyt. Journal Bd. LIX. S. 156 u. Bd. LXI. S. 479 Notizen
mitgetheilt.A. d. R.
Nur auf diese Art war es möglich, den verschiedenen, in Rheims zerstreuten Fabriken
Gas zu liefern; da die Stadt über. 2800 Meter im Durchmesser hat, so hätte sich der
Aufwand für die Leitungsröhren nicht lohnen können.
Ich bin überzeugt, daß noch die Errichtung einer Anstalt für tragbares Gas nöthig
war, um den zur ersten Einrichtung behufs der Behandlung der Seifenwasser
erforderlichen Aufwand deken zu können; denn drei Fabrikanten, welche sich einige
Monate nach der Entstehung meiner Fabrik mit der Behandlung der Seifenwasser
beschäftigten, gaben dieselbe wieder auf, nachdem sie bedeutende Summen aufgewendet
hatten; und doch verkaufte man damals den Hektoliter Seifenwasser um 20 Centimes,
während er jezt 60 gilt.
Um das gereinigte Oehl zu benuzen, errichtete ich in meiner Fabrik eine
Seifensiederei. Es war mir nicht möglich mit diesem Oehl eine Kaliseife zu machen,
welche im Handel Beifall gefunden hätte und auch mit gereinigter Soda erzielte ich
kein viel besseres Resultat: die Seife war braun und wenig consistent. Als ich aber
dieses Oehl mit Laugen von roher Soda behandelte, erhielt ich ein gutes Resultat,
denn das im Oehl enthaltene öhl-talgsaure Eisen wird durch den in der Soda
enthaltenen Schwefel zersezt, die thierischen Stoffe schlagen sich mit dem
Schwefeleisen nieder und man bekommt eine Seife, wie sie im Handel gesucht
wird.Man vergleiche die von den HHrn. Zeller und Söhne
in Zürich mitgetheilte Methode, das zum Abkochen der Seide benuzte
Seifenwasser zur Gasbereitung zu verwenden (im polytechn. Journal Bd. LXXXII. S. 297).A. d. R.
Beschreibung der Abbildungen (Fig. 5 und 6).
A Oeffnung für die Röhren, welche das Seifenwasser
hereinleiten. – B, B Tröge aus Weißblech, in
welche man die Fässer ausleert. – C Rinne, welche
das vom Wagen laufende Seifenwasser aufnimmt und in die Behälter leitet. –
D, D, D, D hölzerne, in den Eken mit Blei belegte
Behälter zum Aufnehmen und Zersezen des Seifenwassers. – D', D', D', D' Scheidewände, um das Fett
zusammenzudrängen und gegen die Rinnen E, E, E, E zu
treiben. – E, E, E, E Klappen und Rinnen, um die
fetten Substanzen in die Kufen F, F zu leiten. –
F, F Kufen, welche mit einer Scheidewand G, G versehen sind; in ihnen wird der Fettmasse ein
Antheil des mitgerissenen Wassers entzogen. – G,
G Scheidewände, welche in den Kufen bis auf 30 Centimeter (11 Zoll) vom
Boden hinabreichen. – H, H, H, H Hähne zum
Abziehen des klaren, von Fett befreiten Wassers. – J,
J Hähne zum Abziehen des vom Fett abgesonderten Wassers. – K, K, K, K Röhren, welche den Dampf in die Kufen F, F und in die Behälter L,
L leiten. L, L Behälter, welche mit Dampf
geheizt werden, um die Trennung des Wassers von dem Fett zu veranlassen, ehe man
lezteres in den Kessel Q bringt. – M Dampfkessel. – N
unterirdischer Canal, in welchen die Entleerungsröhren der Behälter und Kufen
einmünden. – O Auslaßöffnung, welche das Wasser
durch den Canal P an das Ende der Fabrik leitet, wo sich
das Gradirhaus befindet. – P Canal. – Q kupferner Kessel; er ist mit einem Mantel versehen,
welcher in den Kamin endigt. – R kupferne
Behälter für das aus dem Kessel kommende Oehl. – S Kamin. – T Mantel. – V Seifensiederei.
Tafeln