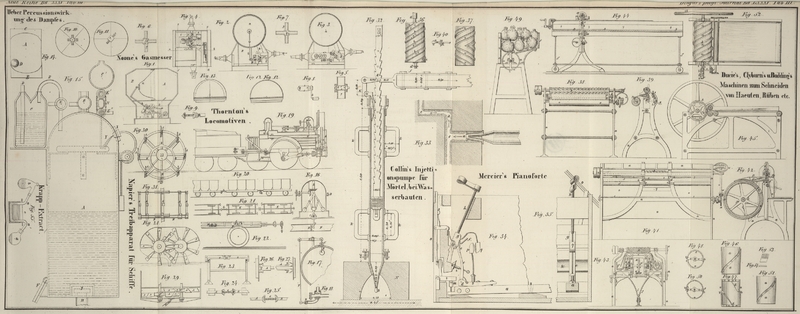| Titel: | Collin's Injectionspumpe zum Einpressen von Mörtel in schadhafte Stellen der Wasserbauwerke. |
| Fundstelle: | Band 85, Jahrgang 1842, Nr. XLIII., S. 177 |
| Download: | XML |
XLIII.
Collin's
Injectionspumpe zum Einpressen von Moͤrtel in schadhafte Stellen der
Wasserbauwerke.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Collin's Injectionspumpe zum Einpressen von Moͤrtel
etc.
Die Methode, Risse in Wasserbauwerken dadurch zu repariren, daß man in die offen
gewordenen Risse zur Verbindung der Steine Mörtel injicirt, rührt von Bérigny her und wurde an einer Schleuße im Hafen
von Dieppe 1802 zum erstenmal angewendet. Er beschrieb dieselbe in einer Schrift:
Mémoire sur un procédé d'injection,
par Charles
Bérigny
inspecteur général des ponts et
chaussées. Paris 1832.
Die Pumpe, welche Bérigny zum Injiciren von
aufgelöstem hydraulischem Mörtel anwendete, bestand aus einem hölzernen Drukrohre
von 0,08 bis 0,1 Meter Weite, mit metallenem Mundstük und hölzernem Kolben. Eine
1818 im Hafen von Rochefort angewendete Pumpe hatte 0,16 M. Weite und ihr Kolben
wurde durch einen kleinen Ramm vorwärts getrieben. – Raynal hat sich am Canal du Midi desselben Verfahrens bedient (s. Annales des ponts etc. 1837, I, S. 50). Er hatte eine
Pumpe mit Stiefel von Erlenholz von 0,70 M. Länge und 0,06 M. Weite, mit einem
Kolben von Eichenholz; der leztere wurde mit einem großen Hammer eingetrieben; es
wurde halbflüssiger Wassermörtel eingepreßt und der Erfolg war ganz
zufriedenstellend. 1832 wurden durch Brière de
Moudétour in der Schleuße von Royaumont Wasserzugänge auf die
angegebene Art durch Injectionspumpen von 0,2 M. Weite, die ebenfalls mit dem Ramme
bewegt wurden, verstopft. Mary wendete das Verfahren 1820
an der Schleuße zu St. Simon und 1827 an der Schleuße von Hüningen an; er hatte
Pumpen von 0,1 M. Weite.
Sämmtliche bisher angeführte Anwendungen haben das Charakteristische, daß der Mörtel
bei denselben durch Stoß eingepreßt wurde; der Widerstand hiebei richtet sich nach
der Weite der auszufüllenden Oeffnungen, der Steifigkeit der einzupressenden Masse
und wird besonders noch durch die Incompressibilität des in den Oeffnungen bereits
wohnenden Wassers hervorgebracht.
Bei einem Reservoir zu Grosbois im Canal de Bourgogne wurde statt der stoßweisen
Wirkung der Drukpumpe die stete gleichmäßige vorgezogen, weil durch ganzflüssigen
Mörtel nicht sehr weite Oeffnungen eines Spaltes auszufüllen waren, welcher sich auf
22 M. Höhe in einer Ufermauer zeigte, und von welchem man glaubte, daß er in der Form, wo er bemerkt
wurde, zur Ruhe gekommen sey. Es wurde die in Fig. 32 abgebildete Pumpe
hier angewendet, welche aus einem gußeisernen Stiefel von 1,09 M. Länge bei 0,078 M.
Weite mit konischem angeschraubtem Mundstük besteht, das 0,01 M. Weite hat. Der
Kolben hat Hanfliederung zwischen zwei Leder- und zwei Metallscheiben, welche
gehörig zusammengeschraubt werden können. Beim Füllen kann die untere Oeffnung durch
einen Pfropf b geschlossen werden. Beim Injiciren ist
die Pumpe in eine Blechdüse eingesezt, die gehörig verwahrt in die Oeffnung
eingebracht ist. Die Befestigung derselben zeigt Fig. 33. Ueber dem Kolben
erhebt sich eine Kolbenstange d, welche auf beiden
Seiten mit Zähnen versehen ist; auf der einen Seite wird sie durch die Treibklinke
des Hebels f von beiläufig 2 M. Länge, auf der anderen
durch eine Sperrfeder ergriffen und theils am Rükgange verhindert, theils in
Berührung mit dem Drukhebel erhalten. Der Ansaz K
enthält den Stüzpunkt für den Drukhebel, so wie die Sperrklinke. k, k sind Handhaben zum Regieren der Pumpe; N ist eine Holzunterlage, um die Pumpe aufzusezen, bevor
sie gebraucht wird. Die Arbeit entsprach vollkommen dem Erfolge. Um die Pumpe
gehörig rein zu erhalten, wird sie nach gemachtem Gebrauche, bevor sie von Neuem
gefüllt wird, jedesmal vorsichtig mit Wasser ausgespült. (Aus den Annales des ponts et
chaussées ) Jun. 1840, im polyt. Centralblatt 1842, Nr.
35.)
Tafeln