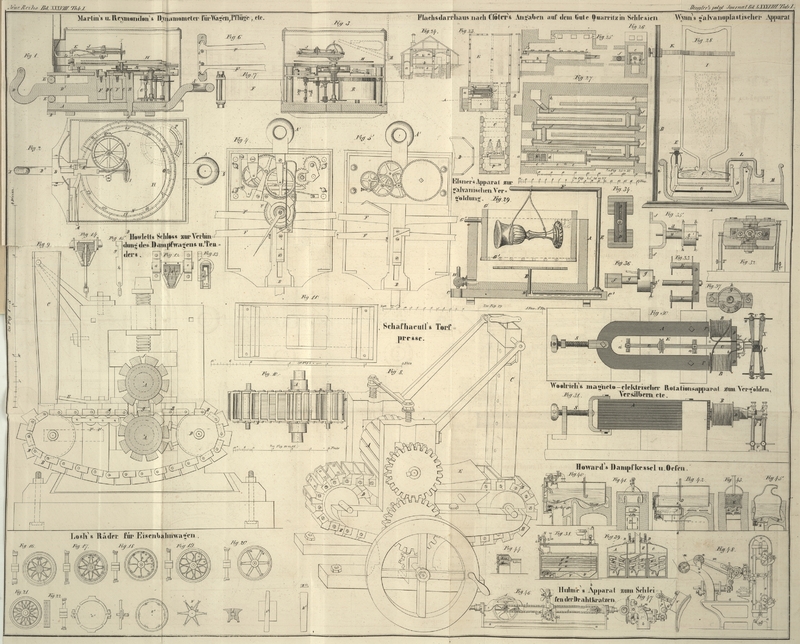| Titel: | Verbesserungen an Apparaten zum Schleifen und Schärfen der Drahtkrazen, worauf sich Joseph Hulme, Ingenieur in Manchester, am 20. Sept. 1841 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. V., S. 12 |
| Download: | XML |
V.
Verbesserungen an Apparaten zum Schleifen und
Schaͤrfen der Drahtkrazen, worauf sich Joseph Hulme, Ingenieur in Manchester, am 20. Sept. 1841 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts. Febr. 1843, S.
26.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Hulme's Verbesserungen an Apparaten zum Schleifen und Schärfen der
Drahtkrazen.
Vorliegende Verbesserungen beziehen sich auf eine Maschine, welche die Bestimmung
hat, die Drahtspizen der um die Cylinder gelegten Krazenblätter – sie mögen
neu oder gebraucht und durch den Gebrauch abgenüzt und ungleich seyn – zu
bearbeiten, um sämmtliche Zähne oder Drahthäkchen in eine gleichförmige Ebene zu
bringen und ihnen zugleich denjenigen Grad der Schärfe zu geben, welcher zum
vollkommenen Krämpeln der Baumwolle und anderer Faserstoffe nöthig ist.
Fig. 46
stellt einen Frontaufriß und Fig. 47 eine
Seiten- oder Endansicht des Apparates in Anwendung auf cylindrische Flächen
dar.
a, a, a ist das gußeiserne Maschinengestell. Die
Seitenarme b, b desselben sind durch die Querschiene c, c mit einander verbunden. In diesen Armen ist eine
Welle d, d gelagert, an der ein kleines Winkelgetriebe
e festgekeilt ist, welches in ein Winkelrad f greift. Lezteres sizt an einem Zapfen g, der in einem verschiebbaren und im Gestell c adjustirbaren Lager ruht, und eine Kettenrolle h trägt; eine ähnliche Rolle i dreht sich um den Zapfen k. Um diese Rollen
läuft eine endlose Kette l, l. Ein bewegliches Glied m verbindet diese Kette mit einem an dem hinteren Theile
des Schlittens n, n befindlichen Zapfen. Dieser
Schlitten läßt sich auf der festen Unterlage a, a hin
und her bewegen und ist mit den nach allen Richtungen beweglichen Theilen o, p, q versehen, welche den Schleifblok r tragen, wonach der leztere jede Lage anzunehmen im
Stande ist.
Die Maschine ist auf folgende Weise wirksam. Nachdem der Schleifapparat der
Vorderseite einer Krazmaschine gegenüber parallel zur Hauptcylinderwelle angeordnet
und der Blök r mit einer Schmirgelfläche bekleidet und
mit einem Krazcylinder, wie Fig. 47 zeigt, in
Berührung gebracht worden ist, sezt man die an dem Ende der Welle d befindliche Treibrolle in Gang, welche in Folge ihrer Notation den
Schlitten n mit seinem Schleifblok von einem Ende des
Cylinders zum anderen regelmäßig hin- und herführt. Da nun der Cylinder sich
zugleich um seine Achse dreht, so erhält man auf diese Weise eine vollkommen ebene
Fläche und kann den Krazen jeden beliebigen Grad der Schärfe ertheilen.
Fig. 48
stellt den beschriebenen Apparat in abgeänderter Form dar, in welcher er sich zum
Schleifen flacher Krazenblätter oder der Dekelkrazen eignet. Die Stelle des obigen
Schleifklozes vertritt hier ein rotirender Schleifcylinder. Auf dem Maschinengestell
a, a, a ruht ein Lager b,
b, welches wie bei der vorhergehenden Maschine hin- und hergleitet
und den nach allen Richtungen beweglichen Führer b, c, d
trägt, in welchem der Schmirgelcylinder e gelagert ist.
Das zu schleifende Dekelkrazblatt f wird mittelst
Stellschrauben in dem Rahmen g, g befestigt, welcher um
den Zapfen h auf und nieder beweglich ist. Auf dem
Gestell a, a befindet sich eine vollkommen horizontal
gestellte ebene Tafel i, i. Auf diese Tafel wird das
Krazenblatt vor dem Schleifen gelegt, um es nachher dem Schleifcylinder in
paralleler Lage darbieten zu können. Hierauf läßt man den Rahmen g, g auf das Krazenblatt herab, befestigt lezteres in
demselben mit Hülfe der Stellschrauben und hebt den Rahmen wieder in die Höhe. Ein
Haken l, welchen man in die am Rahmen angebrachte
Hervorragung k einfallen läßt, hält den Rahmen mit
seinem Krazenblatt in dieser Lage fest.
Die Riemen und Rollen m und n
ertheilen dem Schleifcylinder die rotirende Bewegung, und die Operation des
Schleifens beginnt jezt. Zur Auf- und Niederbewegung des Krazenblattes, so
daß seine ganze Oberfläche gleichförmig der Einwirkung des Schleifcylinders
dargeboten wird, dient eine sogenannte Parallelbewegung o,
o, d.h. ein Rahmen, welchem die an der Welle q
befindliche Kurbel p die erforderliche auf- und
niedergehende Bewegung ertheilt. Eine andere Parallelbewegung schiebt mit Hülfe der
excentrischen Scheiben r, r und der Ovale s, s das Krazenblatt in horizontaler Richtung
ein- und auswärts.
Tafeln