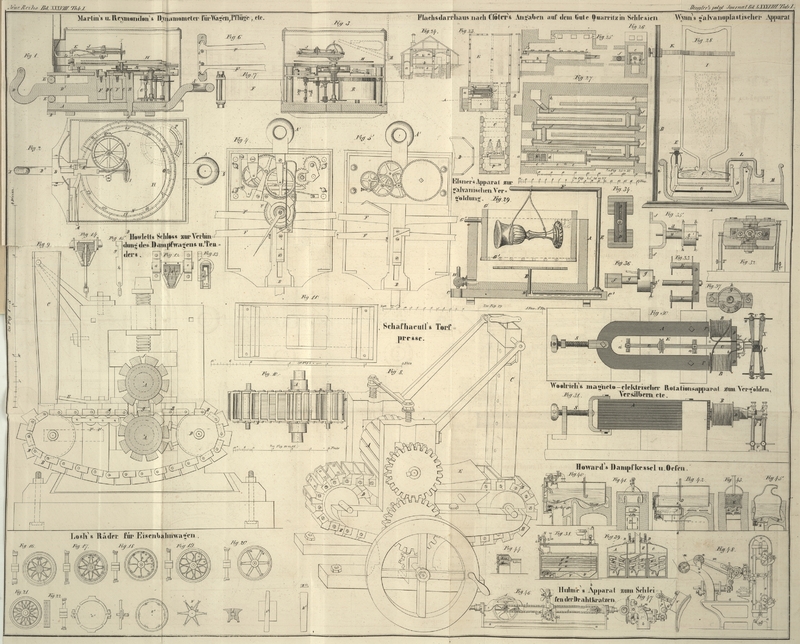| Titel: | W. Wynn's galvanoplastischer Apparat. |
| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. VIII., S. 29 |
| Download: | XML |
VIII.
W. Wynn's galvanoplastischer
Apparat.
Aus dem Mechanics' Magazine. Jan. 1843, S.
54.
Mit einer Abbildung auf Tab. I.
Wynn's galvanoplastischer Apparat.
Der Verfasser hat folgenden galvanoplastischen Apparat construirt, welcher bei
wohlfeiler und einfacher Construction eine constante Wirkung äußert. Fig. 28 zeigt denselben
im Durchschnitt.
A ist eine Holztafel von 12 Quadratzoll Oberfläche mit
einer darin befestigten Säule B. C ist ein irdenes
Gefäß; D ein hölzerner Nahmen, welcher auf drei, etwa 1
Zoll langen, Füßen ruht; in diesen Nahmen ist ein ungefähr 1/4 Zoll diker Gypsboden
eingegossen; E ist eine Klemmschraube, am Rande des
Rahmens D befestigt; durch ihre Oeffnung gehen die
Kupferdrähte der Batteriepole und werden durch Anziehen der Schraube in metallischem
Contact gehalten; F ist die Zinkplatte und G der Gegenstand, auf welchen das Kupfer sich
niederschlagen soll. H ist eine Untertasse oder sonst
ein concaves Gefäß von Erde oder Glas, mit einem Loch in der Mitte von 3/4 Zoll
Durchmesser; dasselbe muß leicht in den Holzrahmen D
hineingehen und ruht mit der concaven Seite nach Unten auf drei über der Zinkplatte
F, an D befestigten
Holzpflökchen; I ist eine Flasche, welche von dem Ring
K gehalten wird und mit ihrem nach Unten gekehrten
Hals über dem Loch in der Tasse H steht; L ist ein aus einem Stük Glasröhre gebogener Heber; an
der Seite der Tasse H wird ein Stük herausgenommen,
damit dieser Heber hindurch gestekt werden kann; M ist
ein die überlaufende Flüssigkeit aufnehmender Topf. Die punktirten krummen Linien
auf beiden Seiten von D zeigen die Lage eines 3 bis 4
Zoll breiten, rings herum gehenden Stükes Musselin, dessen eine Leiste (Rand) mit
einer Schnur in der oben um den Rand von D laufenden
Kerbe fest herumgebunden wird; in seine andere Leiste ist ein kleines Stük Fischbein eingenäht und man läßt
sie über die Seite von C hinüberhängen, so daß zwischen
der Außenseite von D und der Innenseite von C ringsherum eine Art Sak gebildet wird.
Das Verfahren nun ist folgendes: man bringt den
Gegenstand, auf welchen sich Kupfer ablagern soll, und die Zinkplatte auf ihre
Pläze, füllt sodann das Gefäß C bis zur punktirten Linie
hinauf mit einer gesättigten Auflösung von Kupfervitriol an und legt einige
Krystalle von solchem in den Musselinsak, um die sich erschöpfende Flüssigkeit immer
wieder zu sättigen. Dann füllt man D bis zu derselben
Höhe mit einer Mischung von 1 Theil Schwefelsäure und 30 Th. Wasser an; den Heber
füllt man mit derselben Mischung und bringt ihn an seinen Plaz; nun stürzt man über
den Zink die Tasse und das vorher mit verdünnter Schwefelsäure angefüllte Reservoir
(die Flasche) I. Das beim Zink sich entwikelnde
Wasserstoffgas wird unter der Tasse aufgefangen und steigt in die Flasche I hinauf, wofür angesäuertes Wasser heruntersinkt und
die Stelle der erschöpften Flüssigkeit in D einnimmt,
welche durch den Heber nach M überfließt. Die Flasche
I ist nach einiger Zeit mit Wasserstoffgas
angefüllt, welches man bis zu dessen Gebrauch in einen passenden Recipienten
überfüllt.
Aus dem Obigen geht hervor, daß das Eigenthümliche dieses Apparats das Reservoir ist,
welches für die erschöpfte saure Flüssigkeit frische liefert, so wie auch die
Kupferlösung beständig gesättigt erhalten und das bisher vernachlässigte
Wasserstoffgas gewonnen wird, welches seit der Entdekung des Löthverfahrens mittelst
Luftwasserstoffgas häufiger benuzt werden kann.
Tafeln