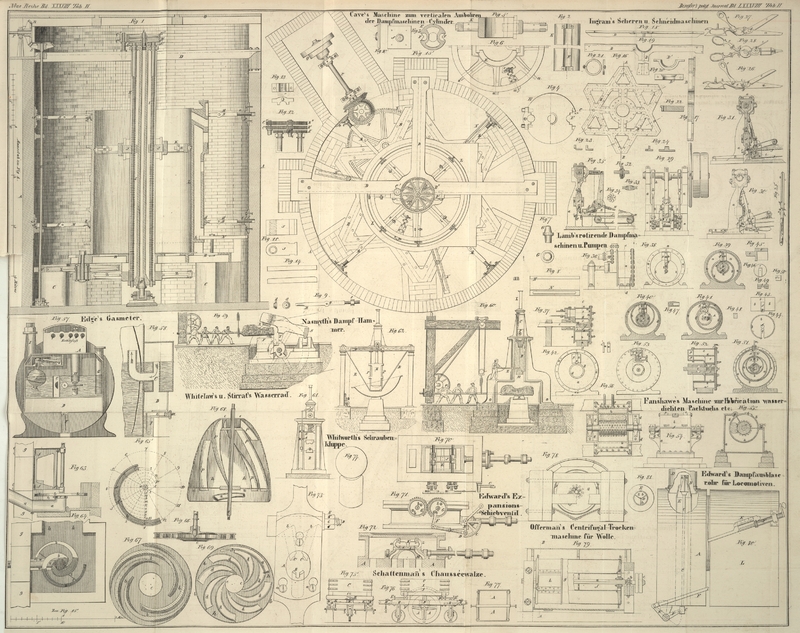| Titel: | Verbesserungen an Whitelaw's und Stirrat's Wasserrade. |
| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. XXV., S. 106 |
| Download: | XML |
XXV.
Verbesserungen an Whitelaw's und Stirrat's Wasserrade.Man vergl. polytechn. Journal Bd. LXXX. S.
92.
Aus dem Mechanics' Magazine. Nov. 1842, S.
418.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Whitelaw's und Stirrat's verbessertes Wasserrad.
Die Figuren 63
und 64
stellen einen Aufriß und Grundriß dieses hydraulischen Apparates in seinem
gegenwärtigen sehr verbesserten Zustande dar. Die Maschine arbeitet bekanntlich
vermittelst des Drukes und der Rükwirkung einer Wassersäule. Die Hauptröhre a, a führt das Treibwasser aus einem höher gelegenen
Reservoir in die Arme der Maschine. Vom Centrum c des
Rades tritt das Wasser in die hohlen Arme b, b, b, b und
entweicht durch die Ausgußröhren d, d. Die rotirende
Bewegung der Arme theilt sich der Maschinenwelle e, e
mit und kann Vermittelst eines an dieser Welle befestigten Rades, Getriebes oder
einer Rolle auf irgend einen durch das Wasserrad zu treibenden Mechanismus
übertragen werden. f, f, f, f ist ein breites, in dem
Mauerwerk befestigtes Seitengestell, in welchem die Radwelle gelagert ist; h, h das Abzugsgerinne. Da die Arme eine rotirende
Bewegung besizen, während die Röhre a, a an das
Mauerwerk befestigt ist, so müssen geeignete Vorkehrungen getroffen seyn, um das
Entweichen des Wassers an der Vereinigungsstelle der Hauptröhre mit den rotirenden
Armen zu verhüten. Eine diesen Zwek erfüllende Anordnung ist in Fig. 63 sichtbar. Sie
besteht aus einem die untere Seite der Centralöffnung c
umgebenden Ringe i, i und aus einem Theile k, k, welcher an der Stelle, wo er in den ausgebohrten
oberen Theil der Röhre a, a paßt, cylindrisch abgedreht
ist. Der Theil k, k besizt eine in der Nähe des unteren
Endes rings um seine Außenseite laufende Rinne, welche mit Zwirn ganz vollgewikelt
ist, um die Entweichung des Wassers zwischen der Röhre und dem cylindrischen Theile
von k, k zu verhüten. Außerdem besizt der Theil k, k eine Flantsche, und in den Raum zwischen dieser
Flantsche und dem oberen Theil der Hauptröhre ist Kabelgarn gewikelt, um den oberen
Theil von k, k mit dem unteren Theil des Ringes i, i in Berührung zu erhalten. Hieraus geht klar hervor,
daß, wenn der Ring i, i und der Theil k, k genau abgedreht und an ihrer Verbindungsstelle
aufeinander geschliffen sind, diese Theile einen wasserdichten Verschluß bilden
müssen; l, l sind Rippen oder Stege zur Unterstüzung der
Arme.
Die Krümmung und Anordnung der Arme wird auf folgende Weise bestimmt. Es sey 1, 4, 9,
Fig. 65,
ein Kreis von demselben Durchmesser, wie der durch die Mitte der Ausgußröhren zu
beschreibende Kreis; dieser Kreis sey in zwölf gleiche Theile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, deßgleichen der Halbmesser 1 w in
zwölf gleiche Theile a, c, e, g, i, k, m, o, q, s, u
getheilt. Von jedem Theilungspunkte des Kreises ziehe man eine gerade Linie nach dem
Mittelpunkte w, und von dem Theilungspunkte a des Halbmessers a aus
beschreibe man aus w einen Kreisbogen bis zum Punkte b des Halbmessers 2 w. Bon
demselben Mittelpunkte w aus beschreibe man einen
Kreisbogen durch den zweiten Punkt c bis zum Punkte d des Halbmessers 3 w. Auf
diese Weise fahre man fort, concentrische Bögen von den Theilungspunkten des
Halbmessers 1 w zu beschreiben, und lasse jeden Bogen in
einem Halbmesser sich endigen, welcher unmittelbar auf denjenigen Halbmesser folgt,
in dem sich der vorhergehende Bogen geendigt hatte. Zieht man nun durch die so
erhaltenen Durchschnittpunkte 1, b, d, f, h, j, l, n, p, r,
t, u, w eine Curve, so bildet diese die mittlere Krümmung des Arms. Nach
Herstellung der Curve 1, d, l, r, w lassen sich beliebig
viele Punkte in den die Seiten des Arms bildenden Curven auf folgende Weise
erhalten. Von w als Mittelpunkt aus beschreibe man so
viele concentrische, durch die krumme Linie 1, d, l, r,
w gehende Kreisbögen, daß sie eine hinreichende Anzahl der verlangten
Punkte liefern. Hierauf nehme man mit dem Zirkel einen Abstand gleich der vierfachen
Weite des äußeren Endes der Ausgußröhre und trage diesen Abstand an jeden solchen
concentrischen Bogen, indem man doppelt mißt, nämlich auf jeder Seite der Curve 1,
d, l, r, w einmal, von dem Durchschnittspunkte des
Bogens mit der Curve
aus. Die zu beiden Seiten der Curve 1, d, l, r, w
markirten Punkte bilden die beiden Seiten des hohlen Wasserradarms. Diesemnach wird
die Breite des dem mittleren Punkte v gegenüberliegenden
Arms gefunden, indem man durch diesen Punkt den Kreisbogen x beschreibt und von v nach x auf der einen Seite der durch die Mitte des Arms
gehenden Curve, und von v nach dem gegenüberliegenden
Punkt auf der andern Seite dieser Curve eine Entfernung gleich der vierfachen Weite
des Ausgußrohres abmißt; auf dieselbe Weise wird die Breite des Arms an jeder andern
Stelle ermittelt. Wenn der Arm auf die so eben angegebene Weise construirt wird, so
fällt sowohl seine Tiefe, als auch die Tiefe des Ausgußstükes ganz gleichförmig
aus.
Bewegt sich die Maschine so schnell, daß das aus derselben tretende Wasser nicht Zeit
hat durch einen Raum gleich der Tiefe des Arms zu fallen, ehe der nächste Arm
ankommt, so wird das aus dem einen Arme tretende Wasser von dem andern Arme
getroffen und dadurch der Gang der Maschine etwas verzögert. Ist die Geschwindigkeit
der Maschine langsamer als die des Wassers, so kann dieser Mangelhaftigkeit in den
meisten Fällen ganz einfach dadurch abgeholfen werden, daß man die äußersten Enden
der Ausgußröhren ein wenig auswärts biegt, um das dem einen Arme entströmende Wasser
aus dem Bereiche des andern zu bringen. Die Weite der Ausgußröhren in Vergleich mit
derjenigen der Arme wird durch die Geschwindigkeit der Maschine nach der
Geschwindigkeit des Treibwassers regulirt. Wenn die Geschwindigkeit der Maschine der
Geschwindigkeit des Wassers gleich ist, so sollte die Weite an dem äußeren Ende
eines jeden Mündungsstükes ungefähr dem dritten Theile der Länge derjenigen Sehne
gleich seyn, welche zu dem die Breite des Armes bestimmenden Bogen gehört. Die so
eben beschriebene Maschine sollte sich ungefähr 1/3 langsamer als das Wasser
bewegen; und wenn die Geschwindigkeit der Maschine ungefähr 3/4 der Geschwindigkeit
des Wassers beträgt, so sollte die Sehne, welche zu den die Breite des Armes
bestimmenden Bögen gehört, 2 1/2mal länger als die Weite des Ausgußrohres seyn.
Das jezige Wasserrad hat vor dem früheren den Vorzug, daß es auf eine wirksamere
Weise verhütet, daß das Wasser mit den Armen herumgeführt werde. Angenommen nämlich,
die Mitte der Ausgußröhren bewege sich mit derselben Geschwindigkeit, wie das ihnen
entströmende Wasser, so wird unter Beobachtung der oben erwähnten Constructionsweise
die Weite jeder Ausgußröhre ungefähr 1/6 der Armweite betragen. Ein Arm von der in
Fig. 65
dargestellten Art enthält ungefähr eben so viel Wasser, wie ein gerader von dem Mittelpunkte aus nach
dem Ausgußrohre hingehender Arm, dessen seiner ganzen Länge nach sich
gleichbleibender Querschnitt einen sechsmal größeren Flächeninhalt als derjenige des
Ausgußrohres besizt. Unter diesen Verhältnissen wird ein gerader Arm bei einer
Umdrehung ungefähr die ihn füllende Wassermenge abliefern, wobei sich das Wasser
sechsmal langsamer durch den Arm als durch das Ausgußrohr bewegt und unter der
Annahme, daß sich der Halbmesser zum Kreisumfang und eben so die Armlänge zum Umfang
des von seinem Ausgußrohre beschriebenen Kreises ungefähr wie 1 : 6 verhalte. Da
jedoch der räumliche Inhalt des krummen Armes derselbe ist wie der des geraden
Armes, so wird das den ersteren füllende Wasser die während einer Umdrehung der
Maschine erforderliche Quantität bilden. Hieraus erhellt, daß das Wasser, welches
den Mittelpunkt w verläßt, während der Arm in der Fig. 65
dargestellten Lage ist, nach einer Umdrehung dieses Arms sich am Anfange 1 des
Ausgußrohres befinden wird. Die querschnittlichen Flächeninhalte des Arms stehen in
einem solchen Verhältniß zur Curve 1, d, l, r, w, daß,
wenn irgend ein Punkt p des Arms an der Stelle o des Halbmessers w 1
ankommt, das Wasser, welches den Mittelpunkt verließ, als der Arm die in der Figur
angegebene Lage hatte, gleichfalls bei o angelangt seyn
wird. Demnach fließt das Wasser, wenn der Apparat in Bewegung ist, von dem
Mittelpunkte desselben aus in einer geraden oder beinahe geraden Linie der
Ausmündung zu.
Die in den Figuren
63, 64 und 65 dargestellten Arme besizen ihrer ganzen Länge nach gleiche Tiefe und
ihr Querschnitt hat an jeder Stelle die rectanguläre Gestalt. Dieser Querschnitt
kann indessen begreiflicher Weise auch kreisrund oder quadratisch gestaltet seyn,
wenn er nur in den correspondirenden Abständen vom Mittelpunkte w mit dem rectangulären Querschnitt gleichen
Flächeninhalt hat.
Für den Fall, daß die Maschine im Hinterwasser arbeiten soll, empfehlen die
Patentträger die in den Figuren 66 und 67
dargestellte Modification.
Hier sind zwischen zwei kreisrunden, unter einem Abstand gleich der Tiefe der Arme
eingesezten Scheiben, krumme Scheidewände eingesezt, welche die Seiten der Arme
bilden, und Ausgußstüke zwischen den Scheiben befestigt. Die Hauptwelle ist in der
Mitte der obern Scheibe befestigt und Oeffnungen für das Wasser befinden sich in dem
Centrum der untern Scheibe. Wenn die Arme oder Wasserräume eine gewisse Weite
übersteigen, so endigen sich die innern Enden der krummen Scheidewände, ehe sie die
Centralöffnung erreichen, in eine Schärfe. Zwischen den innern Enden der
Scheidungsstüke und der Centralöffnung sollte die obere und untere Scheibe so
gestaltet seyn, daß das
Wasser von dieser Oeffnung aus nach den innern Enden der Arme an jedem Punkte seines
Weges mit gleicher oder beinahe gleicher Geschwindigkeit fließt. Dieser Zwek wird
dadurch erreicht, daß man von der Centralöffnung aus, gegen das innere Ende der Arme
zu, die Tiefe des zwischen der obern und untern Scheibe enthaltenen Raumes
vermindert.
a, a ist ein Theil der Hauptwelle und c die Centralöffnung für das Wasser; die Wasserwege sind
mit b, b bezeichnet.
Eine andere Maschine, welche sich von der erstem wesentlich unterscheidet, ist in den
Figuren
68 und 69 dargestellt. Hier ist a, a die Hauptröhre,
welche das Wasser von dem Reservoir b, b herleitet; c, c ist der rotirende Theil des Apparates. Dieser Theil
ist an dem obern Ende b, b, wo das Wasser einfließt,
offen und besizt auch am untern Ende eine Oeffnung, durch welche das verwendete
Wasser abfließen kann. Im Innern des Apparates sind die Blätter oder Schienen d, d befestigt, welche sich in spiralförmiger Richtung
von oben bis unten ziehen, und da die Treibwelle e, e
mit diesen Schienen fest verbunden ist, so wird sie durch die Einwirkung des Wassers
auf die Spiralschienen in Rotation gesezt. Beide Enden dieser Welle drehen sich auf
die gewöhnliche Art in Lagern.
Tafeln