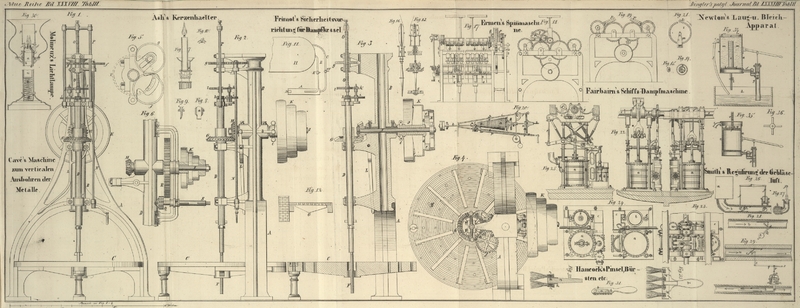| Titel: | Apparat zum Reinigen und Färben der Wolle, so wie zum Laugen, Waschen und Bleichen der baumwollenen Garne und Gewebe, worauf sich William Newton, Civilingenieur im Chancery-lane, Grafschaft Middlesex, am 21. Decbr. 1841 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 88, Jahrgang 1843, Nr. XLIX., S. 194 |
| Download: | XML |
XLIX.
Apparat zum Reinigen und Faͤrben der
Wolle, so wie zum Laugen, Waschen und Bleichen der baumwollenen Garne und Gewebe, worauf
sich William Newton,
Civilingenieur im Chancery-lane, Grafschaft Middlesex, am 21. Decbr. 1841 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts, April 1843, S.
201.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Newton's Apparat zum Reinigen und Färben der Wolle und zum Laugen
etc. baumwollener Stoffe.
Diese dem Patentträger von einem Ausländer mitgetheilte Erfindung ist ein Apparat,
mittelst dessen das Laugen, Waschen und Färben der Wolle, Baumwolle und anderer
Faserstoffe auf eine bessere und wirksamere Weise als nach den gewöhnlichen
Verfahrungsweisen bewerkstelligt werden kann.
Der Apparat besteht aus einem geschlossenen Behälter, der die Stoffe enthält, welche
ausgewaschen, gebleicht oder gefärbt werden sollen; in Verbindung damit ist ein
anderes Gefäß, welches nach Umständen Lauge, Wasser oder Färbeflüssigkeit enthält.
Fig. 34
ist ein senkrechter Durchschnitt dieses Apparats. a, a
ist ein cylindrischer Behälter aus Eisen oder Holz; derselbe muß so stark seyn, daß
er einen Druk von 1–2 Atmosphären auszuhalten vermag; inwendig belegt oder
überzieht man ihn mit einem Material, welches sich nicht oxydiren, auch die zu
behandelnden Waaren weder zu färben noch zu beschädigen vermag; b ist ein im unteren Theil des Behälters angebrachter
falscher Boden, welcher mit Löchern versehen ist, um die Flüssigkeit
hindurchzulassen; c ist der Dekel, womit die obere
Oeffnung oder das Mannsloch des Behälters geschlossen wird. Derselbe ist mit zwei
Oehsen versehen, in welche Keile d, d getrieben werden,
um den Dekel fest auf den Rand des Behälters oder der Kufe aufzudrüken. In der Mitte
der Kufe ist ein Rohr e, welches auf dem falschen Boden
aufsteht, senkrecht angebracht; es ist am Boden offen, oben geschlossen und
ringsherum eine ziemliche Streke hinab mit Löchern versehen, damit die Flüssigkeit
die rings um dasselbe in die Kufe eingelegte Waare in Strahlen durchdringen kann.
Ein Rohr f liefert die Flüssigkeit der Kufe a vermittelst einer Drukpumpe g, durch welche sie aus dem Reservoir h in den
unteren Theil der Kufe a getrieben wird. In dem
Reservoir, welches auch ein offener Kessel seyn kann, wird die Flüssigkeit
nöthigenfalls auf den erforderlichen Grad erhizt. Im oberen Theil der Kufe ist ein
Hahn i eingestekt, um die Flüssigkeit abzuziehen,
nachdem sie durch die Waare hinaufgetrieben worden ist. An diesem Hahn wird ein
biegsames Rohr j angebracht, um die Flüssigkeit in das
Reservoir zurükzubringen, nachdem sie durch den Apparat circulirt hat. Im Boden der
Kufe a ist ein mit einem Hahn versehenes Rohr l angebracht, um die Kufe nach der Operation entleeren
zu können. Die Wolle oder andere Waare, welche gereinigt werden soll, muß in die
Kufe a dicht eingelegt werden und wenn man dann die
Pumpe g in Thätigkeit sezt, wird die Flüssigkeit durch
sie hindurchgetrieben.
In manchen Fällen ist es vortheilhafter, eine geschlossene Kufe a anzuwenden, wie sie in Fig. 35 im senkrechten
Durchschnitt abgebildet ist. Dieselbe ist mit einem durchlöcherten Kolben p versehen, welcher an dem QuerhauptFig.
36 ist die obere Ansicht des Querhaupts.
q angebracht ist und dessen Stellung in der Kufe
mittelst der Schraube r regulirt wird. Dieser Apparat
wird nämlich benuzt, wenn man findet, daß das senkrechte Rohr in der Mitte der Kufe
die Flüssigkeit zu leicht durchläßt, so daß sie auf die Waare nicht gehörig
einwirkt. Durch Drehen der Schraube r drükt man das
Querhaupt und den Kolben auf die Waare so weit nieder, daß dieselbe gehörig
comprimirt wird. Die übrigen Theile des Apparats sind dieselben wie vorher; f ist nämlich die Speisungsröhre, um die alkalische oder
andere Flüssigkeit in die Kufe a einzuführen; g ist die doppelt wirkende Pumpe; das Reservoir, welches
die anzuwendende Flüssigkeit enthält, ist in der Zeichnung nicht abgebildet. i ist das Austrittsrohr, durch welches die Flüssigkeit,
nachdem sie durch den Kolben passirte, entweicht; an diesem Rohr kann man einen
Schlauch anbringen, um die Flüssigkeit wieder in das Reservoir oder irgend ein Gefäß
zu leiten. Die Schraube r muß stark genug seyn, um der
Waare in der Kufe den gehörigen Druk geben zu können.
Um Wolle zu entschweißen, welche in der Kufe a, Fig. 35
eingedrükt ist, schüttet man die gebräuchliche alkalische Flüssigkeit in das
Reservoir. Die Pumpe g treibt dieselbe dann durch die
Speisungsröhre f in den unteren Theil der Kufe a. Die Flüssigkeit steigt durch den falschen Boden in
die Kufe, dringt durch die darin enthaltene Waare, passirt dann den durchlöcherten
Kolben und entweicht endlich durch das Austrittsrohr oder den Hahn i. Sie kann dann durch ein Rohr in das Reservoir
zurükgeleitet, daraus wieder in die Kufe gepumpt und so eine beständige Circulation
derselben unterhalten werden. Der nämliche Apparat dient auch zum Laugen, Waschen
und Bleichen baumwollener Garne und Gewebe mittelst der geeigneten Flüssigkeiten.
Durch die so unterhaltene Strömung der Flüssigkeit von Unten nach Oben wird das
Auswaschen der Wolle oder sonstigen Waare auf eine zwekmäßigere Weise als nach der
bisherigen Methode bewirkt, indem die Flüssigkeit, nachdem sie Fette oder Farbstoffe
aufgelöst hat, beständig aufwärts getrieben wird und also nicht wieder in die Waare
eindringen kann; natürlich wird dadurch die Waare rasch und vollständig
gereinigt.
Zum Färben von Wolle, welche vorher entschweißt und gewaschen wurde, benuzt man
denselben Apparat, indem man statt Lauge ein Färbebad von der gehörigen Stärke
anwendet, welches im Reservoir durch Dampf oder über freiem Feuer erhizt wird.
Nachdem die Wolle auf die beschriebene Weise gewaschen worden ist, bringt man sie in
den Apparat Fig.
35 und dreht die Schraube r, so daß der Kolben
dicht auf das Material niedergedrükt wird; man treibt dann mittelst der Pumpe die
Farbstoff-Auflösung so oft durch die Wolle, bis sie ganz damit gesättigt ist.
Dann kann das Entleerungsrohr geöffnet und die vollständig gefärbte Wolle aus dem
Apparat genommen werden. Auf dieselbe Art wird die Wolle vorher mit einer Beize
getränkt, wenn die zu erzielende Farbe eine solche erheischt.
Tafeln