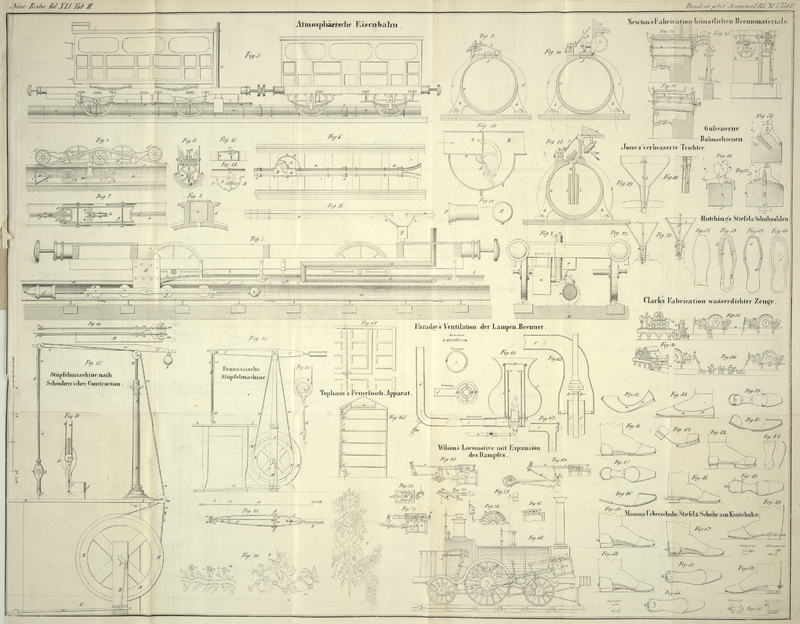| Titel: | Ueber die Stüpfelmaschine; von Fr. Kohl, Lehrer an der Gewerbschule zu Plauen. |
| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. XXXIV., S. 129 |
| Download: | XML |
XXXIV.
Ueber die Stuͤpfelmaschine; von Fr. Kohl, Lehrer an der
Gewerbschule zu Plauen.
Aus dem Gewerbeblatt fuͤr Sachsen, 1843, Nr.
54.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Kohl, über die Stüpfelmaschine.
Die unter diesem Namen seit länger als einem Jahr hier als Hülfsmaschine für den
Vordruk baumwollener Stikereiwaaren in Gebrauch befindliche Vorrichtung ist in
Frankreich und in der Schweiz bereits seit einigen Jahren für die dortige Stikerei
benuzt worden, und hat den Zwek, die Contouren einer gemachten Musterzeichnung, wie
solche der Formenstecher gewöhnlich erhält, mit einer feinen Nadel so zu
durchstechen, daß dieselben ganz nahe liegende Löcher erhalten. Eine solche
durchlöcherte Zeichnung wird dann als Chablone zum Vordruk auf die Weise benuzt, daß
dieselbe auf den Mull, Batist etc. aufgelegt, ein mit einem Farbstoff, z. B. Indigo
verseztes feines Harzpulver (Dammarharz) mittelst eines weichen Filzwischers troken
durch die Chablone gerieben und hierauf das an der Waare hängende Pulver durch eine
heiße Plättgloke oder wohl noch vortheilhafter und sicherer durch einen
Heißwasserapparat angeschmolzen wird.
Ein so auf die Waare gebrachter Vordruk zeigt sich vor dem Fixiren des Harzpulvers
darauf vergleichsweise wie Fig. 20. nach dem
Anschmelzen des lezteren erscheinen die vorher durch Punkte gebildeten Contouren
mehr oder minder als Linien ohne Unterbrechung.
Es soll nun zunächst die fragliche Maschine selbst, und zwar in ihrer einfachsten
Form, so wie solche der Mechaniker Hr. Schönherr hier
mehrfach ausgeführt hat, näher beschrieben werden.
In Fig. 17,
18 und
19 ist
A, A eine hölzerne fest
zu schraubende Säule; sie besizt oberhalb eine cylindrische Aushöhlung, welche den
Stab B aufnimmt; auf dessen oberem Ende ist der
Balancier C, C durch Zapfen
so verbunden, daß ihm Drehungsbewegung in senkrechter Ebene verstattet wird, während
der im hohlen Cylinder drehbare, so wie höher und tiefer und mittelst Preßschraube
festzustellende Stab B sowohl Horizontalbewegung, als
auch ein Höher- und Tieferstellen des Balanciers zuläßt. Dieser Balancier
dient zur Führung des wesentlichsten, die Arbeit ausübenden Theiles der in den
Schnuren a, a hängenden
Kapsel D. In der lezteren befindet sich eine kleine
zugleich als Kurbelscheibe dienende Schnurscheibe b; sie
bildet mit der am Schwungrade M verbundenen
Schnurscheibe N, Fig. 19, den durch die
Leitrollen m, m, n, n und o, o unterstüzten Schnurlauf
a, a, a, a, a, wie
solcher aus dem Fig. 18 in doppelter Größe gezeichneten Durchschnitte der Kapsel D, so wie aus dem Grundrisse des Balanciers und
Schwungrades M, Fig. 19, deutlicher zu
ersehen ist. Das Verhältniß der Durchmesser der beiden Schnurscheiben b und N ist in der Zeichnung
wie 1 zu 18 angenommen, woraus folgt, daß die an der Kurbelstange c, oberhalb in einer Gabel eingezapfte, unterhalb aber
die Nadel e haltende Stange d bei einer Umdrehung des Schwungrades 18 Hübe und somit die Nadel eben so
viele Stiche machen wird.
Die Nadel bewegt sich in einer sie ganz genau umschließenden und in die hölzerne
Kapsel eingeschraubten Stahlhülse f, aus der sie bei
ihrer herabwärtsgehenden Bewegung etwa ¾ bis 1 Linie hervortritt; es kann
jedoch diese Hülse beliebig höher oder tiefer gestellt und somit das Hervortreten
der Nadel vermehrt oder vermindert werden.
Endlich ist das vordere Ende des Balanciers mit dem Kopfe der Kapsel noch durch einen
Metallstab E verbunden, welcher ebensowohl die Spannung
des Schnurlaufes bewirken, als auch die auf die Kurbelscheibe b oder Kapsel D überhaupt geäußerten
Erschütterungen möglichst vermindern soll. Von dem Momente, welches die Gewichte der
Kapsel D und Stange E auf
den vorderen Arm des Balanciers ausüben, wird ein beliebiger Theil durch das am
hintern Arm hängende und verstellbare Gewicht F
aufgehoben. Als Unterlage für die zu durchstechende Zeichnung kann wohl Tuch, Filz,
Leder etc. dienen, doch wird die Chablone ungleich schärfer, wenn die Tischplatte
z, z aus Hirnholz
besteht, oder damit fournirt ist. Im lezteren Falle wird namentlich der Aufwurf auf
der Rükseite der Chablone vermindert und es wird dann der noch bleibende geringe
Aufwurf durch Bimsstein vollends abgerieben. Das Schwungrad M, welches durch den Tritt G vermittelst der
Kurbelstange H und Kurbel J
bewegt wird, kann ein Gewicht von 25–30 Pfd. erhalten.
Der Gang der Maschine ist nun leicht begreiflich. Indem der Arbeiter mit dem Fuße den
Tritt G bewegt, führt er mit der Hand die Kapsel als
durchlöchernden Zeichnenstift auf den Conturen der Musterzeichnung herum. Bei
schwierigeren Partien der Zeichnung, bei denen die Nadel nur langsamer geführt
werden kann, läßt sich deren Geschwindigkeit durch angemessene Bewegung des Trittes
bequem modificiren. Nach Verhältniß der Zeichnung und Uebung kann die Nadel
15–30 Stiche in der Secunde machen.
Wenn das gewichtige Schwungrad (mit geringem Kurbelhub) einerseits, der Stab E aber, welcher vortheilhaft noch stärker genommen
werden kann, andererseits zu ruhiger Führung und Verminderung des auf die Nadel
geäußerten Pulsirens beitragen, so ist ein centrischer und leichter Gang der Rollen
an sich schon vorauszusezen, weßhalb in lezterer Beziehung die Zapfen in kupfernen
oder messingenen Futtern oder noch besser in Spizen laufen müssen.
Wenn mehrere Dessinateurs das Schwungrad und den Stab E
gegen die erstere Ausführung verstärkten, wie es die gegebene Beschreibung bereits
berüksichtigte, so hat sich dieses nach vielfachem Gebrauche als zwekmäßig
bewährt.
Es kann daher von der eben beschriebenen Schönherr'schen
Stüpfelmaschine noch bemerkt werden, daß sie sich neben der Einfachheit auch durch
Billigkeit empfiehlt. Der Preis ist circa 20 Thlr.
Der hiesige Dessinateur Hr. E. Heubner, bei dem sich eine
Schönherr'sche Maschine seit vorigem Jahre in
ununterbrochenem Gange befindet, lernte im vergangenen Sommer auch die derartigen
Maschinen in Paris kennen, und wir können durch dessen Gefälligkeit nachfolgende
Beschreibung der französischen Stüpfelmaschine, so wie einige allgemeinere
Bemerkungen zufügen.
Die übereinstimmenden Theile sind hier wie bei der obigen Maschine und in den
zusammengehörigen Ansichten ebenfalls gleichnamig bezeichnet.
Fig. 21, 22 und 23. In dem
Gestelle A, A ruht der aus
zwei Theilen bestehende hölzerne Balancier C, C, so wie das Schwungrad M
mit der verbundenen Schnurscheibe N.
Am vorderen Ende des Balanciers befindet sich ein in dessen verbindenden Querstüken
drehbares Stük g, welches am hinteren Ende durch eine
Schraubenmutter gehalten wird, vorn aber als Gabel i,
i geformt ist, Fig. 23. Der Metallstab
E ist um die durch die Gabel gehenden Zapfen drehbar
und es ist leicht zu übersehen, wie durch die dreifache Bewegung, nämlich durch die
des Balanciers, des Zapfens g und des in der Gabel
eingezapften Metallstabes E, der an dessen unterem Ende
befestigte Theil D nach allen Richtungen auf der
Zeichnentafel Z, Z geführt
werden kann. D ist ein Metallrahmen, welcher ähnliche
Theile wie die hölzerne Kapsel D der vorigen Figuren
enthält, und zwar die Schnurscheibe b′, die
excentrische Scheibe b mit der Stangenverbindung c und d und theilweise die
Hülse f; leztere ist kürzer als bei der vorher
beschriebenen Maschine, so daß die Nadel e beim Aufhube
nur wenig hineintritt, sondern vielmehr frei geht. Die Bewegung wird hier durch
einen von der Schnurscheibe N aus zweifach fortgesezten
Schnurlauf a, a, a, a, a bewirkt, indem die inmitten des Balanciers befindlichen Doppelrollen m, m′, n, n′, die
Fortsezungen bilden, so zwar daß N, m den ersten, m, n′ den zweiten und n′ b den dritten Schnurlauf darstellen. Die
Rollen m, m′, n, n′ und b′ laufen des leichteren Ganges wegen mit Spizen
ihrer stählernen Achsen in entsprechenden Lagern. G, I und
H bezeichnen ebenfalls Tritt, Kurbel und Kurbelstange.
Der unterhalb am Rahmen D sizende kleine Griff h dient zur bequemeren Führung des ersteren auf der
Zeichnung und ist mittelst einer Schraube stellbar. Das am hinteren Theile des
Balanciers verstellbare Gegengewicht F hat gleichen Zwek
wie bei der Schönherr'schen Maschine.
Betrachtet man die beiden beschriebenen Maschinen vergleichsweise gegen einander, so
bietet jede einige Vorzüge vor der andern. So führen wir nur beispielsweise an, daß
die die Nadel umschließende Hülse bei der Schönherr'schen
Maschine sich vortheilhaft zeigt, indem die Nadel sicherer geht, und nicht so leicht
abbrechen kann, auch das Auge weniger angegriffen wird, als bei der an der
französischen Maschine größtentheils freigehenden Nadel; andererseits möchte die an
der lezteren Maschine angewendete excentrische Scheibe, deren Achse in zwei
Zapfenlagern ruht, einen sanfteren Gang erzielen lassen.
Wir glauben, daß die gemachten Beschreibungen hinreichen dürften, die wesentlichste
Einrichtung dieser Maschine, so wie deren Handhabung vollständig zu erkennen, und
fügen schließlich noch über das anzuwendende Chablonenpapier, so wie über das
bereits erwähnte Harzpulver einige Bemerkungen zu.
Zu Chablonenpapier eignet sich eine dünne aber gutgeleimte Sorte am besten. Je
schwächer das Papier ist, desto feiner wird das Durchlöchern erfolgen, doch hat dieß
seine Gränzen, indem zu schwaches Papier beim Durchreiben des Farbpulvers leichter
knitterig wird.
Obwohl wir glauben, die oben angeführten Bestandtheile des Harzpulvers als richtig
bezeichnet zu haben, so sehen wir uns doch genöthigt, einer weiteren Angabe darüber,
ob es die alleinigen sind, so wie über das Verhältniß dieser Bestandtheile, uns zu
enthalten, weil solche nicht mit Bestimmtheit erfolgen könnte, halten auch dafür,
daß ein umsichtiger Dessinateur hierin nicht zu große Schwierigkeit finden wird. Da
die Haupteigenschaften eines solchen Farbpulvers die seyn müssen: sich leicht
durchreiben zu lassen, ohne dabei klebrig zu werden und die Löcherchen zu
verstopfen, sodann am Zeuge leicht anschmelzbar zu seyn, und sich durch die Bleiche
vollständig entfernen zu lassen, so kommt es nur auf eine Reihe von Versuchen an, um
ein Pulver, welches diese Eigenschaften besizt, darzustellen.
Uebrigens ist diese Farbe aus Paris zu beziehen von Barthelemy, ainé, Fabricant de Broderies, Paris, Rue Paradies No. 41.
Tafeln