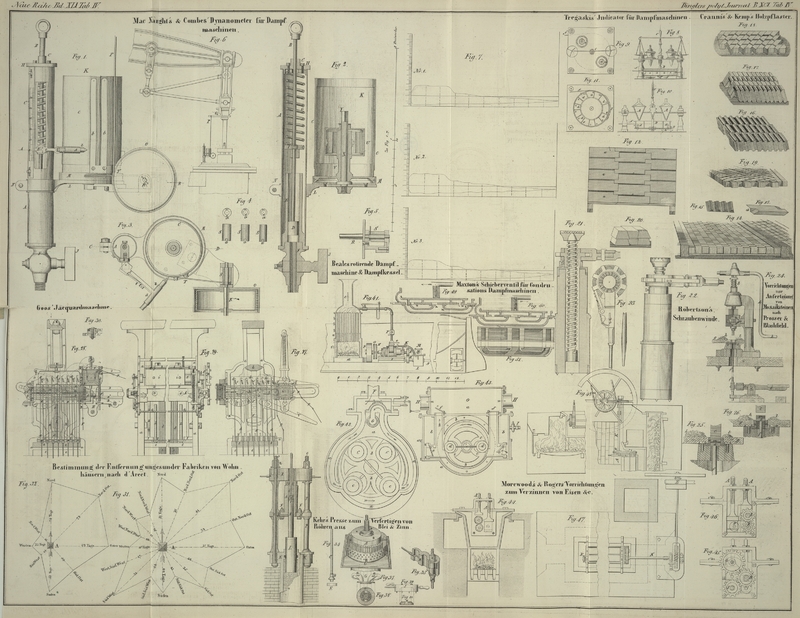| Titel: | Crannis' und Kemp's Holzpflaster. |
| Fundstelle: | Band 91, Jahrgang 1844, Nr. LXXV., S. 285 |
| Download: | XML |
LXXV.
Crannis' und Kemp's Holzpflaster.
Aus dem Mechanics' Magazine. Okt. 1843, S.
261.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Crannis' und Kemp's Holzpflaster.
Fig. 12 stellt
den Grundriß eines Unterbaues dar, welcher sich besonders vortheilhaft für Straßen
eignet, in denen das Pflaster häufig aufgerissen werden muß, um den Wasser-
oder Gasleitungen beikommen zu können. Zwei oder mehrere Bohlen b, b werden in geeigneten
Abständen von einander in der Richtung der Straßenlänge gelegt und an den Enden mit
einander verbunden. Quer über diese Bohlen wird eine Anzahl kürzerer Bohlen a, a, a gelegt, welche auf die Fig. 13 dargestellte
Weise an beiden Enden abgeschrägt sind. Zwischen den Seiten der Bohlen sind als
Abzug schmale Zwischenräume c, c, c, c gelassen,
welche durch die Leiste d gebildet werden. Die gegen die
Trottoirsteine sich lehnenden Querbohlen sind gerade abgeschnitten und können an die
äußeren Längenbohlen mittelst Bolzen befestigt werden. Wir verzapfen die
Längen- und Querbohlen an allen denjenigen Stellen mit einander, wo sich
zufällig Oeffnungen nach den Abzugscanälen oder Wasserleitungen vorfinden, aber auch
nur an solchen Stellen, denn jeder auf diesem Pflaster lastende Druk kann die Theile
nur fester mit einander verbinden. Soll dieser Unterbau an irgend einer Stelle
abgehoben werden, so hebt man zunächst eines der an das Trottoir gränzenden
Querstüke, die sich wegen der glatt abgeschnittenen Enden leicht herausnehmen
lassen, in die Höhe, worauf auch die übrigen leicht aus einander genommen werden
können.
Wir gehen nun zu der Beschreibung der verschiedenen Gattungen von Blöken, welche auf
diesen Unterbau zu liegen kommen. Fig. 14 zeigt die
perspectivische Ansicht eines Fahrweges, bestehend aus oblongen Blöken von zweierlei
Dimensionen sowohl in Beziehung auf Höhe als auf Dike. Sie werden, die Fasern in
senkrechter Lage, reihenweise neben einander gelegt, so daß in jeder Reihe hohe und
niedrige Blöke abwechseln, und daß jedesmal die hohen Blöke einer Reihe den
niedrigen Blöken der angränzenden Reihe gegenüber liegen. Durch diese Anordnung
entsteht eine Oberfläche ohne Einschnitte, mit einer gleichen Anzahl erhabener und
vertiefter Theile, von denen die ersteren den Pferden den nöthigen Fußhalt gewähren,
so daß sie weder vorwärts noch rükwärts, noch — was am häufigsten vorkommt
— seitwärts ausgleiten können.
Die Figuren 15
und 16
stellen eine Modification des vorhergehenden Systems dar, welche sich vorzüglich für
steile Abhänge eignet.
Hier bestehen die Blöke aus schiefen, oben und unten faȱettirten
Parallelogrammen und liegen in regelmäßigen transversalen Reihen, jedoch unter einem
starken Winkel rükwärts gegen den Boden geneigt. Die reihenweise Anordnung der Blöke
ist so getroffen, daß jedesmal die Vertiefung eines Blokes der einen Reihe dem
erhabenen Theile eines Blokes in der angränzenden Reihe gegenüber zu liegen kommt.
Auf diese Weise finden die Pferde, sie mögen bergan oder bergab steigen, in jeder
Richtung einen sicheren Fußhalt. Sind die Blöke an ihrer oberen Seite abgenüzt, so
kann man durch Umkehrung derselben eine neue Oberfläche herstellen.
Die Figuren
17, 18
und 19 sind
Varietäten, welche alle auf dem erwähnten Constructionsprincip beruhen. Sie begegnen
jenem Einwurf, daß das Holzpflaster den Pferden nicht den gehörigen Fußhalt gewährt,
auf eine Weise, welche nichts zu wünschen übrig läßt. Fig. 20 stellt eine von
den vorhergehenden verschiedene Blokform dar, mit der man ein ausnehmend starkes
Pflaster zu Stande bringen kann, welches übrigens an seiner Oberfläche noch mit
Einschnitten versehen werden muß. Jeder Blök besteht aus zwei Theilen von
pyramidalischer Form. Die in umgekehrter Lage mit einander vereinigten Blöke tragen
mittelst ihrer Hervorragungen einander gegenseitig.
Tafeln