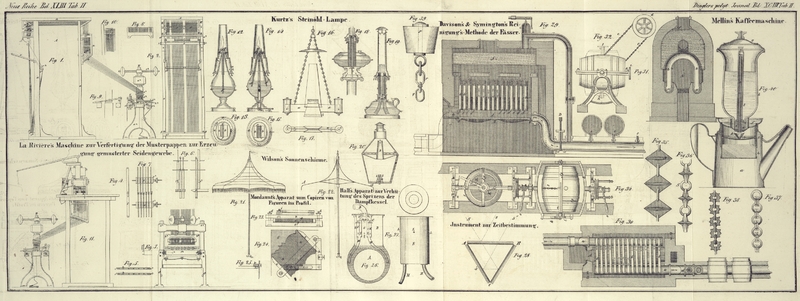| Titel: | Davison's und Symington's patentirte Reinigungsmethode der Fässer. |
| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. XXVIII., S. 82 |
| Download: | XML |
XXVIII.
Davison's und Symington's patentirte
Reinigungsmethode der Faͤsser.
Aus dem Mechanics' Magazine. Mai 1844, S.
337.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Davison's und Symington's, Reinigungsmethode der
Fässer.
Die bisher von den Brauern, Destillateuren und andern befolgte Methode, die Fässer zu
reinigen besteht darin, daß man Dampf von hoher Temperatur durch dieselben strömen
läßt. Allein dieser Methode lassen sich zwei gewichtige Einwürfe entgegenstellen:
erstens ist sie sehr kostspielig; in einigen unserer
größeren Brauereien belaufen sich die jährlichen Kosten der Fässerreinigung auf
viele tausend Pfd. St.; zweitens saugt das Holz von dem
Dampfe eine gewisse Quantität Feuchtigkeit ein, welche jene schwammigen
Unreinigkeiten, deren Wegschaffung eben der Zwek des Reinigungsprocesses ist, wieder
reproduciren helfen. Von diesen beiden Nachtheilen ist das neue Verfahren der HHrn.
Davison und Symington
vollkommen frei, indem es
verhältnißmäßig wohlfeil ist und rüksichtlich seiner Wirksamkeit nichts zu wünschen
übrig läßt.
Das Verfahren der HHrn. Davison und Symington besteht erstens darin, daß sie das
Holz zu den Fässern, während der Verfertigung der leztern und vor ihrer Vollendung,
von allen schädlichen färbenden oder riechenden Stoffen, mit denen dasselbe
imprägnirt seyn mag, befreien, indem sie es der Einwirkung rascher Strömungen von
erhizter Luft aussezen; zweitens darin, daß sie die Fässer nach ihrer Vollendung und während ihres
Gebrauchs von allem Schimmel und andern schwammigen Stoffen und Unreinigkeiten, die
sich an den inneren Flächen gesammelt haben, theils mit Hülfe einer Maschine
befreien, welche ohne die Böden herausnehmen zu müssen inwendig angebracht werden
kann, theils durch Ausschwenken, theils endlich dadurch, daß sie wieder rasche
Strömungen erhizter Luft durch die Fässer leiten.
I. Was die erstere dieser Methoden betrifft, so verfertigen die Patentträger die
Fässer nicht, wie dieß gewöhnlich geschieht aus Holz, welches durch langes Liegen an
freier Luft getroknet worden ist, und sich daher, ohne Blasen zu erhalten, schwer
biegen läßt, sondern sie verwandeln das Holz in frischem grünem Zustande mit großer
Leichtigkeit in blasenfreie Dauben von der verlangten Krümmung. Hierauf bilden sie
die Fässer, indem sie Dauben und Böden zusammensezen, dieselben mittelst temporärer
Befestigungsmittel binden, und für das nachher stattfindende Eingehen den nöthigen
Raum geben. Diese noch unvollendeten Fässer werden der Einwirkung eines
continuirlichen und raschen Stromes erhizter Luft ausgesezt, bis das Holz alle oder
nahe zu alle Theilchen seines natürlichen Saftes oder andere wässerige Theilchen,
mit denen es etwa imprägnirt worden ist, verdunstet hat. Nachdem dieß geschehen ist,
werden die Fässer auf die gewöhnliche Weise gebunden und vollendet.
Die Figuren
29, 30
und 31
stellen die Construction des Apparats zur Erzeugung der erwähnten heißen
Luftströmung dar und zwar Fig. 29 im
Längendurchschnitt, Fig. 30 im Grundriß und Fig. 31 im
Querdurchschnitt. A ist der Ofen; a, a, a sind horizontale längs der Seite des Ofens sich erstrekende
Röhren, und b, b, b hufeisenförmige Röhren, die mit den
ersteren in Verbindung stehen und von denselben aus senkrecht aufwärts gehen; c eine Oeffnung durch welche von einem Ventilatorgebläse
aus Luft in die horizontalen Röhren getrieben wird; d
eine Oeffnung, durch welche die erwärmte Luft aus den Röhren tritt; leztere Oeffnung
ist mit einem Schieber D versehen, um zu verhüten, daß
der Dampf in die Heizröhren b, b gelange; e, e, e Mündungen, durch welche die erhizte Luft in die Fässer strömt. Die
Strömung der heißen Luft muß rasch seyn; denn eine Wärme von nach so hoher
Temperatur bringt bei einer geringen Geschwindigkeit nicht den gehörigen Grad der
Verdampfung hervor.
II. Was die Reinigung bereits gebrauchter Fässer betrifft, so befolgen die
Patentträger nachstehendes Verfahren. Sie reinigen dieselben zuerst von allen
fremdartigen fixen Stoffen, z.B. Schimmel, Schwamm, die sich im Innern gesammelt und
angesezt haben mögen, und zwar mit Hülfe der Fig. 32 im Aufriß und
Fig. 34
im Grundriß dargestellten Maschine. a, a, a, a sind
Träger mit Lagern, in denen ein Rahmen b, b, b rotirt;
c, c ist eine Rolle, welche den Rahmen b in Rotation versezt; d
eine andere Rolle, welche die Bewegung vermittelst einer Kette e auf die Rolle e überträgt;
f, g ein innerer Rahmen, welcher sich in Lagern h, h, h des äußeren Rahmens b dreht und das zu reinigende Faß aufnimmt; i, i,
i ein an der Achse des inneren Rahmens f, g
befestigtes Sperrrad mit Federhebel und Sperrkegeln k, k: l,
l Hebel und Kette zur Befestigung des Fasses in seinem Rahmen; n, n eine geneigte Ebene, welche den Sperrkegel mit dem
Sperrrade in thätigen Eingriff bringt; o, o Handhabe zur
Kuppelung, um die Maschine in oder außer Eingriff zu bringen; p ein Fig. 39 in größerem Maaßstab abgebildeter, in das Spundloch passender
Zapfen, von dem eine Reihe in den Figuren 35, 36, 37 und 38 abgesondert
dargestellter Ketten ins Innere des Fasses hängen. An den Zapfen sind zunächst mit
Hülfe eines Ringes einige Zoll einer gewöhnlichen Kette q befestigt, die an einigen Stellen ein nach allen Richtungen bewegliches
Gelenk r besizt. Mit dieser Kette sind drei Stüke einer
breiteren, Fig.
35 und 36 in der Front- und Seitenansicht dargestellten Kette s, s, s verbunden, deren jedes ungefähr drei Fuß lang
ist, und an jedes dieser Stüke sind wieder drei ungefähr 12 Zoll lange schmälere
Kettenstüke t, t, t befestigt, die Fig. 37 und 38 in der
Front- und Seitenansicht dargestellt sind.
Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Nachdem das Faß in dem Rahmen f, g befestigt worden ist, wird der leztere durch die
oben bezeichnete mechanische Anordnung in Rotation gesezt. So oft das an der Achse
des Rahmens befestigte Sperrrad i, i mit seinem Hebel
den unteren Theil der Maschine erreicht, kommt der Hebel mit der geneigten Ebene in
Berührung, bringt dadurch den Sperrkegel mit dem Sperrrade in Eingriff und macht daß
sich das Faß um einen Zahn des Sperrrades zur Seite bewegt. Inzwischen befreien die
Ketten vermöge ihrer zahlreichen Eken und Spizen, welche sie den inneren Wänden des
Fasses darbieten, diese von allen daran haftenden fremden Substanzen. Nach dieser
Reinigungsprocedur können
die Ketten mit Hülfe des Zapfens, an den sie befestigt sind, leicht aus dem Fasse
herausgenommen werden. Sollen die Fässer mit Bier gefüllt werden, so sind sie vorher
mit einer kleinen Quantität Biers von derselben Sorte auszuspülen – ein
Verfahren, das bei Spiritusfässern nicht nöthig ist. Da das Holz der Fässer
verschiedene schädliche Stoffe eingeschlukt haben mag, welche die mechanische
Operation der Ketten nicht entfernen konnte, so sezt man die Fässer, um sie
vollständig zu reinigen, der Einwirkung eines heißen Luftstromes aus, indem man sie
mit ihren Spundlöchern über die Mündungen e, e des oben
beschriebenen Lufterhizungsapparates stellt, und die Korkstöpsel von den
Hahnenlöchern entfernt, damit die durch die Einwirkung des heißen Luftstromes
entwikelten Dämpfe frei entweichen können. Sollte zur vollständigen Reinigung der
Fässer von jedem wenn auch noch so geringen Anflug von Schwamm oder Schimmel eine
sehr hohe Temperatur für nothwendig befunden werden, so dürfte es von Nuzen seyn,
mit dem heißen Luftstrom zugleich eine geringe Quantität Dampf einströmen zu lassen.
Zu diesem Zwek ist über den Heizröhren ein Dampfkessel f
angeordnet, von dem eine durch ein Schieberventil 9 verschließbare Röhre 8 herabgeht
und sich mit der Leitungsröhre für die erhizte Luft vereinigt.
Die Abbildungen stellen nur zwei an der Maschine befestigte und in der Behandlung
begriffene Fässer dar. Die Maschine kann indessen leicht zur gleichzeitigen Aufnahme
einer größeren Anzahl von Fässern eingerichtet werden.
Tafeln