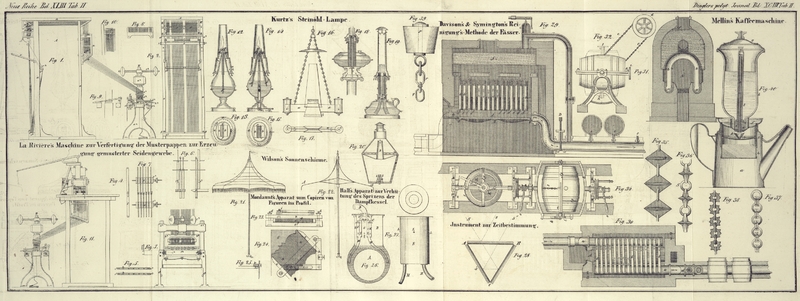| Titel: | Verbesserte Maschine zur Verfertigung der für die Darstellung gemusterter Seidengewebe dienlichen Musterpappen, worauf sich, einer Mittheilung zufolge, Marc la Riviere, zu London Fields, in der Grafschaft Middlesex, am 1. März 1842 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. XXIX., S. 85 |
| Download: | XML |
XXIX.
Verbesserte Maschine zur Verfertigung der
fuͤr die Darstellung gemusterter Seidengewebe dienlichen Musterpappen, worauf
sich, einer Mittheilung zufolge, Marc la Riviere, zu London Fields, in der Grafschaft Middlesex, am 1.
Maͤrz 1842 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Jun. 1844,
S. 321.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
la Riviere's Maschine zur Verfertigung der
Musterpappen.
Fig. 1 ist die
Seitenansicht des Apparates, um die Dessins für gemusterte oder façonirte
Gewebe oder Markirpunkte derselben auf die Musterpappen zu übertragen und
auszuschlagen. A ist der übertragende und B der ausschlagende Theil des Apparats.
Fig. 2 ist
eine Frontansicht von A;
Fig. 3 eine
Frontansicht von B.
In Fig. 1 ist
A und in Fig. 2, a, a, a, a das äußere Gestell;
b, c, d, e ist ein Kettenrahmen, welcher auf den
Tragleisten a², a² ruht, und nach Belieben eingesezt und abgenommen werden kann; c und e sind die Bretter
dieses Rahmens, die mit Löchern durchbohrt sind, durch welche oben und unten die
Kettenfäden gezogen werden. Diese Fäden werden vermittelst Knoten, die sich an ihren
Enden befinden, an das untere Brett und oben vermittelst Schlingen an eine Reihe von
Metallstäbchen f, f befestigt. An beiden Enden der
Leisten a², a²
sind Stifte g, g angebracht, welche in correspondirende
Löcher der Bretter c und e
passen und dieselben unveränderlich an ihrer Stelle erhalten; e, e sind hölzerne Schienen, die der Länge nach zwischen den verschiedenen
Reihen der Metallstäbe f, f angeordnet sind; e², e² zwei
Metallstangen, welche die Reihen der Stäbe mit ihren hölzernen Trennungsschienen
zwischen sich fassen; in Fig. 2 ist der größeren
Deutlichkeit wegen nur eine dieser Stangen, nämlich die hintere, angegeben; h, h Verbindungsschrauben, welche durch die Stangen e², e² und
durch die zwischen denselben befindlichen Holzschienen treten, und durch deren
Anziehen die Stäbe in verticaler Stellung unabhängig von jeder andern Stüze erhalten
werden können. Die Stäbchen f, f sind an ihren oberen
Enden mit Oehren versehen, womit sie in ein entsprechendes System darüber
befindlicher Stäbchen eingehakt werden. Auch diese Stäbchen sind ganz auf dieselbe
Weise, wie das erste System f, f abgetheilt und in eine
sichere Lage gebracht. Fig. 4 liefert die
abgesonderte Ansicht eines Paares solcher Metallstäbchen. Die vorderen zu beiden
Stabreihen gehörigen Metallstangen sind Fig. 5 besonders
dargestellt. Fig.
7 gibt eine abgesonderte Seitenansicht der Stäbchen nebst den
Verbindungsschrauben. An die oberen Enden der zweiten Stabreihe ist eine Reihe
Kettenfäden geknüpft, welche durch Löcher in dem geneigten Brett k oben quer über die Maschine geführt, durch ein anderes
geneigtes Brett abwärts geleitet und an ein System solider Metallstangen geknüpft
sind, die sich frei durch Löcher in den Brettern m, n
bewegen und sich in wurmförmige Federn m²
endigen. An diese Federn ist ein drittes System von Kettenfäden befestigt. Diese
Fäden sind durch den geneigten Metallrahmen o nach der
Ausschlagmaschine geleitet und daselbst an die nachher zu beschreibenden Stempel oder Stößer
q, q, q befestigt. Aus dem bisher Gesagten wird nun
erhellen, daß eben so viele Stempel als Kettenfäden vorhanden sind und daß die
lezteren mit Hülfe der durchlöcherten Bretter von einander getrennt gehalten werden,
während das Gewicht der soliden Metallstangen und die Elasticität der Federn dazu
dient, dieselben stets im geeigneten Grade der Spannung zu erhalten; außerdem wird
erhellen, daß beim Einwärtsziehen oder Auswärtsstoßen eines oder mehrerer
Kettenfäden die mit
denselben verbundenen Stempel aus ihrem Behälter in die Höhe gehen müssen.
Angenommen nun, auf dem beweglichen Kettenrahmen b, c, d,
e sey die Figur oder das Dessin auf die gewöhnliche Weise mittelst
Querfäden angeordnet, dieser Rahmen befinde sich an seiner Stelle am Apparat A, Fig. 1, und das zu
durchstoßende Pappblatt befinde sich unter den Stempeln. Ich fasse alsdann der Reihe
nach die beiden Enden der dem Dessin entsprechenden Eintragfäden und dränge diese
mit Hülfe des Hebels r heraus; dadurch werden die
entsprechenden Kettenfäden von den übrigen getrennt und die zu diesen Fäden
gehörigen Stempel gehoben, während die übrigen Stempel unten bleiben. Die zum Hebel
r gehörige Hauptstange r
ist lose und legt sich während der Operation in die Haken r³, r³, so daß sie bei jedem
Wechsel der Fäden herausgenommen und wieder hineingelegt werden kann. Um die
Operation des Aufnehmens der Schnüre oder Fäden zu erleichtern, werden die Enden der
Kette oben mit Hülfe der parallelen beweglichen und in den Haken t, t ruhenden Querstangen s,
s ein wenig angespannt.
Das Ausschlagen der Musterpappen geschieht in dem Theil B, Fig.
1 und 3. a², a², a² ist das Gestell der
Ausschlagmaschine; b², b² der Preßrahmen; c², c² die Schwungkugel nebst Schraube, durch deren
Umdrehung der Preßrahmen gehoben und gesenkt wird; d² ein Gehäuse, welches die Stempel oder Stößer umschließt; die
lezteren sind Fig.
6 abgesondert und in größerem Maaßstab dargestellt; e² ein Metallgestell, dessen obere geneigte Fläche mit Löchern
durchbohrt ist, durch welche die von dem Theile A des
Apparates herkommenden Kettenfäden gezogen sind; f², f³ zwei rotirende vierseitige
Prismen mit glatter Oberfläche, welche die auszuschlagenden Musterpappen der Reihe
nach unter die Stempel bringen und nachdem sie ausgeschlagen worden sind, von
denselben wieder entfernen; g², g² hervorspringende Arme, in denen diese Prismen
gelagert sind; h² eine Handhabe, mittelst welcher
das Prisma f³ in Thätigkeit gesezt wird; i², i³ kleine
an den Oberflächen der rotirenden Prismen angebrachte conische Spizen, welche in
correspondirende, in den Pappblättern befindliche Löcher treten, um denselben eine
genaue Führung zu geben; k² eine Unterlagsplatte
zur Aufnahme der Pappblätter; diese Platte ist mit Löchern durchbohrt, welche den
Stempeln genau entsprechen; l² ein Fig. 8
abgesondert und in größerem Maaßstabe dargestellter Kamm, welcher zwischen die
Stempel eingesezt wird, und für dessen Zähne in die Stempel Einschnitte l², Fig. 6, gemacht sind.
Die Wirkungsweise des Apparats ist nun folgende. Sämmtliche für ein gewisses Muster
auszuschlagende Pappblätter werden auf die bekannte Weise zu einer Kette mit
einander verbunden. Das erste Blatt wird auf das rotirende Prisma f²
gelegt und mittelst der conischen Spizen i², i² auf demselben befestigt. Der an dem Apparat
A befindliche Arbeiter stößt alsdann mit Hülfe der
Walze r die betreffenden Kettenfäden heraus, wodurch die
an den Enden derselben befestigten Stempel zu einer Höhe emporgezogen werden, welche
gerade hinreicht, um dieselben den Zähnen des Kamms Fig. 8 aus dem Weg zu
bringen. Der Kamm wird nun eingefügt, und seine Zähne fassen nur diejenigen Stempel,
welche unten bleiben, während sie die andern so lange herabzufallen hindern, bis der
Kamm wieder herausgezogen wird. Fig. 6 stellt die Stempel
in diesen beiden Stellungen dar. Eine dem Prisma f³ ertheilte halbe Drehung bringt das erste noch glatte Blatt unter die
Stempel. Jezt wird der Schwunghebel c² umgedreht
und der Preßrahmen b, b² auf das Stempelgehäuse
niedergedrükt, worauf die Durchlöcherung des Pappblatts genau auf die verlangte
Weise erfolgt. Hierauf wird die Handhabe h²
erhoben, bis sie mit dem andern Ende einen von den vier Ekstiften des Prisma's f³, wie Fig. 9 zeigt, ergreift,
dann wieder niedergedrükt, wodurch sie beiden Prismen zugleich eine Viertelsdrehung
ertheilt. Sobald dieß geschehen ist, verläßt die Handhabe diesen Ekstift, schlägt
aber, während sie in die Höhe geht, gegen den folgenden Ekstift, welcher, in die
Kerbe h, h einfallend, verhindert, daß sie zu weit in
die Höhe gehe. Um die schüttelnde Bewegung der Prismen zu verhüten, sind Federn v, v angebracht, durch welche während der Rotation die
Flächen w, w gegen die Prismen gedrükt werden. Die
Viertelsdrehung der Prismen bringt das durchlöcherte Blatt auf die obere Seite des
Prisma's f³, und ein anderes Blatt unter die
Stempel.
Der Kamm Fig. 8
wird nun zurükgezogen, eben so der Spannhebel r, worauf
die aus ihrem Gehäuse gehobenen Stempel augenbliklich wieder in ihre ursprüngliche
Ruhelage zurükkehren. Hierauf wiederholt sich die so eben beschriebene Operation in
gleicher Weise mit einem zweiten System von Kettenfäden und einem zweiten Pappblatt
u.s.f. Die Kette der durchlöcherten Pappblätter läuft um eine zwischen den Trägern
der Maschine angebrachte Rolle und legt sich in regelmäßiger Ordnung Blatt auf Blatt
auf den Boden. Wenn auf diese Weise sämmtliche Musterpappen ausgeschlagen sind, so
wird der Kettenrahmen aus seiner Stelle gehoben und auf die Seite geschafft, um ein
neues Muster oder Dessin aufzunehmen. Dieses Herausnehmen wird leicht auf folgende
Weise bewerkstelligt.
Die durch das Brett m gehenden soliden Metallstangen sind
oben mit Hälsen versehen, welche auf dem Brett ruhen, und das Brett, welches lose an
seiner Stelle befestigt ist, steht mit einem Hebel m, m, Fig. 10, in Verbindung,
mit dessen Hülfe es nach Belieben gehoben oder gesenkt werden kann. Hebt man daher
dieses Brett um 1 oder 2 Zoll, so gehen mit demselben auch die Stangen in die Höhe,
und die zweite Reihe der an diese befestigten Kettenfäden wird dadurch loker
gemacht, so daß, wenn auch der Kettenrahmen gehoben wird, die beiden über dem
lezteren befindlichen Stabreihen leicht losgehakt werden können, wobei nur Sorge zu
tragen ist, daß man beide Reihen vorher mittelst der erwähnten Verbindungsschrauben
befestigt. Um von den ausgeschlagenen Musterpappen eine beliebige Anzahl von Copien
zu erhalten, verbinde ich meine Durchschlagmaschine mit einem gewöhnlichen
Jacquardapparat auf die Fig. 11 dargestellte
Weise, welche keiner näheren Beschreibung bedarf.
Tafeln