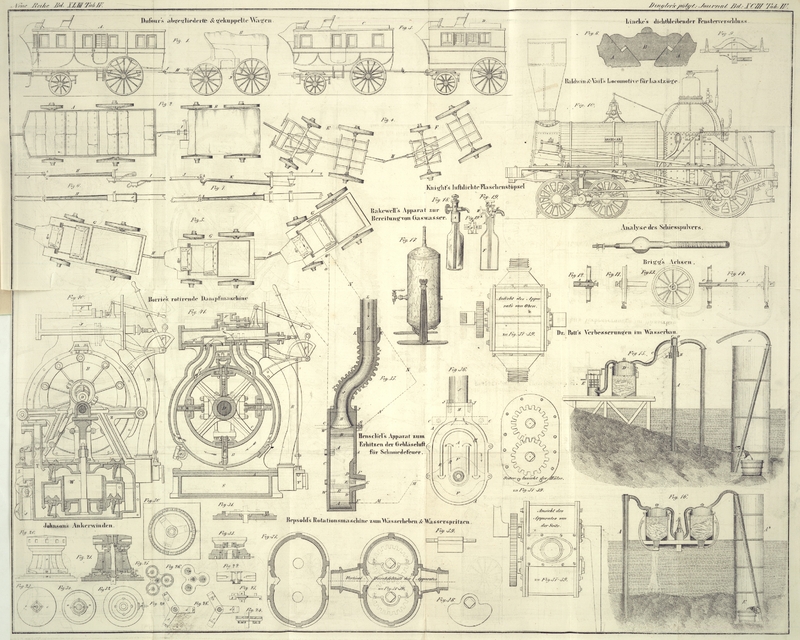| Titel: | P. Borries patentirte rotirende Dampfmaschine. |
| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. LXVI., S. 241 |
| Download: | XML |
LXVI.
P. Borries patentirte
rotirende Dampfmaschine.
Aus dem Civil Engineer and Architects' Journal. Mai 1844,
S. 155.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Borries rotirende Dampfmaschinen.
Fig. 40
stellt einen Querschnitt dieser Maschine durch die Mitte des Cylinders und Fig. 41 einen
Querschnitt durch die Mitte der Luftpumpe mit theilweiser Endansicht der übrigen
Maschinentheile dar.
A ist die Fundamentplatte, an welche sämmtliche Theile
der Maschine direct oder indirect befestigt sind; B ein
äußerer an die Fundamentplatte befestigter Cylinder; C
ein kleinerer Cylinder, der innerhalb des äußeren an einer Welle D rotirt, deren Mitte so weit über derjenigen des
äußeren Cylinders liegt, daß ihre Umfänge sich an dem oberen Punkte h¹ berühren können, und der Raum zwischen ihnen
auf diese Weise von h¹ bis zum tiefsten Punkte
h² allmählich zunimmt. Die Welle D tritt durch dampfdichte, an den Cylinderenden
angebrachte Stopfbüchsen und rotirt in Lagern an den Gestellen Z, Z, welche mit der Fundamentplatte und dem Cylinder
fest verbunden sind.
E, E sind zwei Schieberkolben (sliding pistons). Jeder derselben besteht aus zwei Armen, welche durch
vier über die Welle gehende Arme mit einander verbunden sind. Die Breite dieser
Kolben ist gleich derjenigen des äußeren Cylinders, und ihre summirte Länge ist
wegen der Excentricität des rotirenden Cylinders nothwendiger Weise etwas geringer
als der Durchmesser des äußeren Cylinders. Sie gleiten frei und rechtwinkelig zu
einander durch Oeffnungen in dem Umfange des rotirenden Cylinders. Diese gleitende
Bewegung der Schieberkolben wird durch den Druk eines ihrer Enden gegen die
aufsteigende Seite des äußeren Cylinders und die Excentricität des rotirenden
Cylinders veranlaßt. Da sich ihre Länge während eines Umlaufes stets ein wenig
ändert, so bringt man in Berüksichtigung dieser Differenz zwischen den beiden Diken
der Platten, woraus die Arme der Kolben bestehen, eine Metallliederung an. Diese
Liederung wird, wie aus der Betrachtung der Figuren 40 und 41 erhellt,
durch Federn gegen die Seiten und den Umfang des äußeren Cylinders gedrükt. Auch in
den Oeffnungen des inneren Cylinders, durch welche die Kolben gleiten, sind
metallische Liederungen angeordnet, welche durch Federn gegen die Kolbenflächen
gedrükt werden, und die
Entweichung des Dampfs in das Innere verhüten. Außerdem sind noch zwei stählerne
Rollen an der inneren Seite der Liederungen angebracht, welche durch Schrauben gegen
die flachen Seiten der Kolben gedrükt werden, um die gleitende Reibung der lezteren
zu vermindern. Der Erfinder hält jedoch diese Rollen nur bei großen Maschinen für
nothwendig. Der Kranz des inneren Cylinders ragt in metallisch geliederte an den
Cylinderenden angebrachte Büchsen, wodurch der Dampf gehindert wird, in das Innere
des inneren Cylinders zu dringen. Auch an der Berührungsstelle h¹ befindet sich eine geliederte Büchse, um den
Dampfzutritt nach der einen oder der andern Seite zu verhüten. Aus allem, was
bemerkt wurde, geht nun deutlich hervor, daß der Dampf nur gegen den zwischen dem
inneren und äußeren Cylinder hervorstehenden Theil der Schieberkolben wirkt.
Der aus dem Kessel durch die Dampfröhre F herbeiströmende
Dampf hat zuerst den Schieber G, welcher mit Hülfe der
Handhabe H in Thätigkeit gesezt wird, zu passiren.
Hierauf tritt er in die dampfdichte Büchse I, deren
Bodenfläche die vier Cylindereingänge K, L, M, N und die
Austrittöffnung Q enthält. Ein vermittelst der Handhabe
P bewegbarer Schieber O
liegt zum Behuf der Umkehrung der Bewegung über diesen Oeffnungen. An diesem
Schieber befinden sich zwei Oeffnungen O¹ und O². Bei der in der Abbildung dargestellten Lage
des Schiebers befindet sich die Oeffnung O²
gerade über dem Dampfcanal L. Der Canal N ist geschlossen und die beiden Canäle M und K stehen mit der
Ausmündung Q in Communication. Bei dieser Stellung des
Schiebers muß sich daher die Maschine nothwendig in der durch Pfeile angedeuteten
Richtung bewegen. Gibt man aber dem Schieber eine solche Stellung, daß die Oeffnung
O¹ über den Dampfcanal K tritt, während der Canal M geschlossen wird
und die Canäle M und L mit
der Ausmündung in Communication treten, so wirkt der Dampf an der entgegengesezten
Seite des Cylinders und die Bewegung der Maschine wird umgekehrt.
Die unteren Canäle M und N
dienen nur zur Ableitung des consumirten Dampfes; sie sind am Cylinder so tief
angeordnet, um die Wirkung des Vacuums auf die Kolben zu beschleunigen. In welcher
Richtung die Welle auch rotiren möge, der Dampf strömt immer durch einen der oberen
Canäle K oder L herbei, und
entweicht, nachdem er gewirkt hat, durch den gegenüberliegenden unteren und oberen
Canal. Alle diese Canäle sind da, wo sie sich in den Cylinder einmünden, mit Stegen
versehen, damit die Kolben frei über sie hinweggleiten können.
Aus der relativen Stellung beider Cylinder und dem von der Berührungsstelle h¹ bis zum tiefsten Punkte h² allmählich zunehmenden Abstande ihrer Peripherien folgt daß,
nach welcher Richtung auch die Maschine rotiren möge, die Fläche des der Wirkung des
Dampfs und des Vacuums ausgesezten Theils der Kolben stufenweise zunimmt, so daß
hier das Princip der Expansion ohne Expansionsventile und Räderwerk in seiner vollen
Bedeutung in Anwendung gebracht ist.
Aus der Maschine gelangt der Dampf durch die Röhre R in
den Condensator S. T ist das Injectionsschieberventil,
welches an dem unteren Ende der Austrittröhre angebracht ist, und das Wasser gegen
die Röhre leitet, so daß dieses auf den abwärts strömenden Dampf seine volle Wirkung
äußert. Dieses Ventil wird vermittelst eines Hebels und einer mit dem Handgriff U in Verbindung stehenden Stange bewegt.
V ist das Durchblasventil (blow-through valve) W die doppeltwirkende Luftpumpe. Die innere
Einrichtung ihrer Ventile ist aus Fig. 41 ersichtlich. Sie
besizt einen metallisch geliederten Kolben, welcher von der Hauptwelle aus durch
Kurbel und Lenkstange bewegt wird. Zwei an den Luftpumpendekel geschraubte Führungen
ertheilen der Kolbenstange die nöthige Parallelbewegung.
X ist die Warmwassercisterne. Die Pumpen werden von der
Hauptwelle aus durch ein Excentricum c in Thätigkeit
gesezt. Von diesem geht eine Stange nach den an der Welle d befestigten Hebeln e und f, welche durch Stangen mit den Pumpen g und h in Verbindung
stehen. Die Pumpe g dient zum Auspumpen des Lekwassers,
die Pumpe h zur Speisung der Dampfkessel. Die leztere
besizt einen an die Warmwassercisterne geschraubten Ventilkasten.
Tafeln