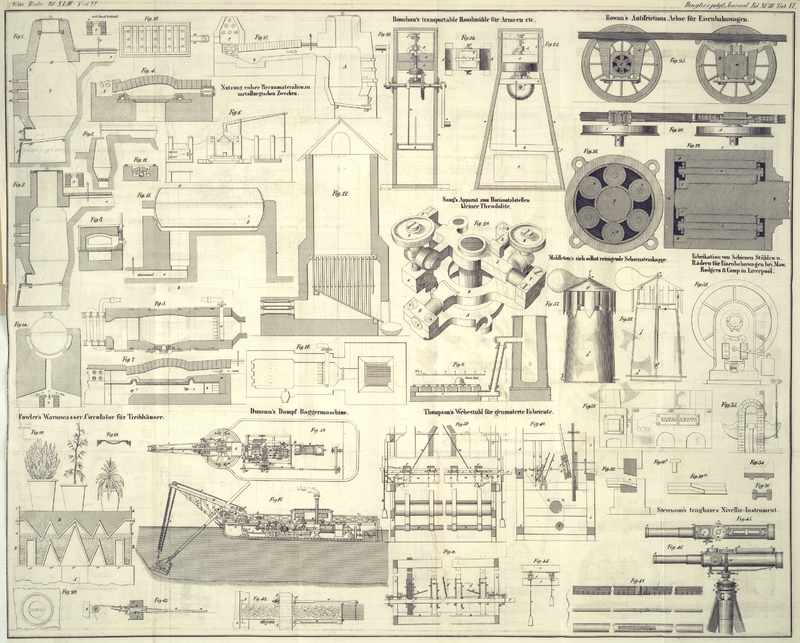| Titel: | Verbesserte Dampf-Baggermaschine, worauf sich John Duncan zu Westminster einer Mittheilung zufolge am 7. März 1842 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. CV., S. 404 |
| Download: | XML |
CV.
Verbesserte Dampf-Baggermaschine, worauf
sich John Duncan zu
Westminster einer Mittheilung zufolgeNämlich von dem amerikanischen Ingenieur Ottis,
welcher die im polytechnischen Journal Bd.
LXXXVIII S. 328 und 423
beschriebene Maschine zum Ausgraben der Erde erfand.A. d. R. am 7. Maͤrz 1842 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Mai 1844, S.
237.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Duncan's Dampf-Baggermaschine.
Diese zum Austiefen und Reinigen der Flüsse, Häfen und Seen bestimmte Maschine ist
mit dem Fahrzeuge, worauf sie steht, Fig. 17 im
Längendurchschnitt und Fig. 18 im Grundrisse
dargestellt. A ist der Dampfkessel. Dieser ist mit einer
Dampfkammer B versehen, um zu verhüten, daß das Wasser
durch die Röhren D, D in die Cylinder C, C herübergerissen werde. Die Röhren D, D sind mit einem Drosselventil E versehen. F, F sind die Querstangen, G, G die Verbindungsstangen und H,
H die Krummzapfen der Maschine. Jeder Cylinder besizt ein Excentricum nebst
Stange J. Die Krummzapfenwelle liegt in Lagern I und ist mit einem Schwungrade K versehen. Ein an der Krummzapfenwelle befestigtes Getriebe L greift in ein großes Stirnrad M, an dessen Welle die Haupttrommel N
befestigt ist. Die leztere Welle ist mit einem Sperrrade O und die Trommel N mit einem Frictionsrad
nebst Frictionsband versehen; lezteres steht mit einem Hebel Q in Verbindung. An dem andern Ende dieses Hebels ist ein kleinerer Hebel
R angebracht, um die Sperrhaken aus den Zähnen des
Sperrrades zu heben.
Das Räderwerk zum Wenden des Krahns ist an dem Ende der Krummzapfenwelle angeordnet
und besteht aus drei Winkelrädern T, T¹ und T². Das Rad T sizt an
dem Ende der Krummzapfenwelle fest, die beiden andern aber drehen sich lose auf der
langen Welle U, wenn sie nicht von der Klaue V ergriffen werden. Diese Klaue ist längs der Welle U verschiebbar und wird mit Hülfe der Stangen S, S, welche sich nach der hinteren Seite der Maschine
erstreken und sich in eine Handhabe S' endigen, mit dem
einen oder dem andern der beiden Winkelräder in Eingriff gebracht.
Das Ende der Welle U nächst dem Bug des Schiffes enthält
eine gußeiserne Rolle W, die durch einen endlosen Riemen
X mit einer ähnlichen Rolle Y verbunden ist. Auf die Mitte dieses Riemens drükt eine Rolle Z, die nach Belieben gehoben und niedergelassen werden
kann, um die Spannung des Riemens zu vergrößern. Mit der Rolle Y sizt an einer Achse das Winkelgetriebe a, Fig. 17, welches in das
große Winkelrad b greift. Dieses ist an dem unteren Ende
der hohlen Säule c befestigt, mit deren oberem Theile
der Krahn d vermittelst einer starken Metallhülse e verbunden ist. Die hohle Säule besteht aus
verschiedenen Theilen; erstens aus dem inneren hohlen Cylinder c, an dessen oberem Theile die zur Aufnahme des unteren
Krahnendes dienliche Hülse e angebracht ist, zweitens
aus einem äußeren, an das Dek befestigten Cylinder f.
Der innere Cylinder dreht sich frei auf dem oberen Theile des äußeren Cylinders in
horizontaler Richtung. Der untere Theil des äußeren Cylinders f ist von einem starken beweglichen Gestell g
umgeben, welches mit acht Frictionsrollen h versehen
ist, die auf einer kreisrunden, an das Dek befestigten Eisenbahn laufen. Das äußere
Ende des Krahns d ist durch Seitenstreben i verstärkt, die mit der Säule c und dem beweglichen Gestell g fest verbunden
sind. An dem hinteren Theile des Gestelles g ist ein mit
Eisen oder Blei gefüllter Behälter k angebracht, welcher
der Grabschaufel als Gegengewicht dient. Das äußere Ende des Krahns d und die Seitenstreben i
sind durch
Schraubenbolzen fest mit einander verbunden, und werden durch eine andere mittlere
Strebe l unterstüzt, die an ihrem unteren Ende mit einer
doppeltkonischen Rolle m versehen ist, welche auf der
rings um das halbkreisförmige Ende des Bootes sich erstrekenden Schiene n rollt. Die Strebe l selbst
wird durch senkrechte und schräge Stüzen o, so wie durch
einen vorn aus dem Boote hervorragenden Arm g des
beweglichen Gestells verstärkt. Die Grabschaufel p ist
mit dem Ende der langen Arme q durch die Bänder r verbunden; an der Kette s
hängt sie von dem Ende des Krahns herab. Die Kette s
läuft längs der oberen Seite des Krahns über eine Rolle t, und von da abwärts durch die Mitte des Cylinders über eine Rolle u, deren Lager selbst horizontal um einen Bolzen drehbar
sind, so daß sich die Rolle von selbst in die veränderliche Richtung der Zuglinie
stellt; von da begibt sich die Kette nach der Hauptwalze N.
An der Achse der Rolle t sizt ein Winkelgetriebe v, das in ein ähnliches an dem Ende der diagonalen Welle
w befindliches Getriebe greift. Das untere Ende
dieser Welle enthält wieder ein Winkelgetriebe, das in ein anderes an der
horizontalen Welle x befindliches greift. Lezteres
bewirkt diejenige Bewegung, welche die Schaufel in den Grund drükt. y ist die Frictionsscheibe, z der Bremskranz, welcher von der linken Hand des Maschinenwärters
beherrscht wird. Dieser ist demnach im Stande, die Schaufel mit beliebiger Kraft
eindringen zu lassen oder sie festzuhalten. Die Welle x
sezt mit Hülfe ihres Getriebes 1 ein Rad 2 in Umdrehung, an dessen Welle sich zwei
Getriebe 3 befinden, welche in Zahnstangen an der unteren Seite der Arme q der Schaufel greifen. An der Welle des Rades 2 und der
Getriebe 3 befindet sich ein dreiekiges Metallgestell 4, welches in jeder seiner
oberen Eken eine Walze 5 trägt, die den Zwek hat, die erwähnten Zahnstangen mit den
Getrieben 3 im Eingriff zu erhalten.
Wenn die Schaufel mit ihrer ausgegrabenen Last über das Niveau des Wassers und bis
zur geeigneten Höhe gehoben worden ist, so muß der Krahn mit der Schaufel gewendet
werden, bis die leztere unmittelbar über den Ausladungskahn zu liegen kommt. Diese
Operation wird mit Hülfe des großen Winkelrades b, des
Getriebes a, der langen Welle U und der Winkelgetriebe T, T¹, T² in Verbindung mit der Kuppelung V bewerkstelligt. Das Getriebe a befindet sich an der Achse der Rolle Y und
wird von der Rolle W aus vermittelst des Riemens X in Umdrehung gesezt. Durch seinen Eingriff in das
große Winkelrad b wird das leztere langsam um seine
Achse gedreht und mit ihm der Krahn d nach der einen
oder andern Richtung gewendet. Diese Bewegung des Krahns wird mit Hülfe einer Frictionsscheibe und
eines im Bereiche des Maschinenwärters befindlichen Bremskranzes 6 regulirt und
gehemmt.
Tafeln