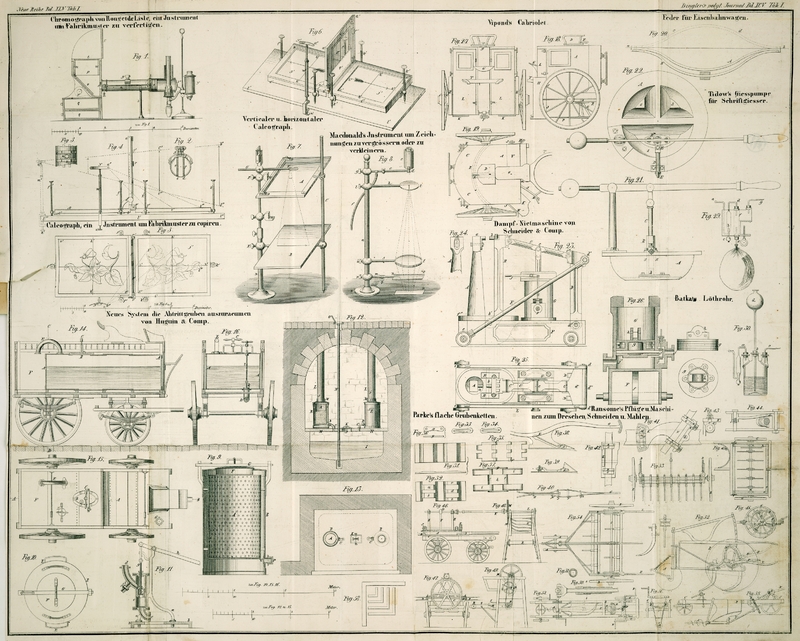| Titel: | Verbesserungen an Pflügen, so wie an Apparaten und Maschinen zum Dreschen, Schneiden und Mahlen für landwirthschaftliche Zweke, worauf sich Robert Ransome, Eisengießer zu Ipswich, Charles May, Eisengießer ebendaselbst, Arthur Biddel, Oekonom zu Playford, Suffolk, und William Worby zu Ipswich am 15. Julius 1843 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. VII., S. 9 |
| Download: | XML |
VII.
Verbesserungen an Pfluͤgen, so wie an
Apparaten und Maschinen zum Dreschen, Schneiden und Mahlen fuͤr
landwirthschaftliche Zweke, worauf sich Robert Ransome, Eisengießer zu Ipswich, Charles
May, Eisengießer ebendaselbst, Arthur Biddel, Oekonom zu Playford, Suffolk, und William Worby zu Ipswich am 15.
Julius 1843 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Okt.
1844, S. 193.
Mit Abbildungen auf Tab.
I
Ransome's Verbesserungen an Pflügen und an Maschinen zum Dreschen
etc.
Wir verfertigen die Pflugbäume aus zwei Eisenstüken, die an dem vordern Ende G mit einander vereinigt und bei H an den Körper oder das Gestell des Pflugs befestigt sind. Beide
Eisenstüke schließen einen zum Theil freien Raum ein und sind durch Querstäbe mit
einander verbunden. Fig. 38 stellt einen solchen Pflug im Aufrisse, Fig. 40 im Grundrisse
dar. Beide Theile sieht man bei G und H, H¹ mit einander vereinigt. Von H¹ bis I divergiren
die Theile des Baumes, und das Pfluggestell ist auf ihre hervorspringenden Theile
gegossen. Durch diese, so wie durch die Seiten des Baumes geht ein Bolzen I, wodurch große Stärke in Verbindung mit Leichtigkeit
erzielt ist. l¹, l² sind zwei andere Bolzen.
Fig. 38
stellt einen Pflug mit hinweggelassenem Formbrette dar. Fig. 39 ist eine untere
Ansicht dieses Pfluges. A, B ist der Vorsprung, woran
die Schar befestigt wird; leztere ist um einen Bolzen C
beweglich. Durch A, B geht ein Schliz D, in welchen ein an das Pfluggestell befestigtes
Metallstük sich legt; dieses Stük füllt den Schliz nicht vollständig aus, sondern
ist zu beiden Seiten abgerundet, so daß es eine kleine Seitenbewegung gestattet. Bei
E tritt eine Schraube durch einen Schliz in dem
Pfluggestell und durch den Hebel A, B. An dieser
Schraube befinden sich drei Muttern; eine derselben macht sie an irgend einer Stelle
des erwähnten Schlizes fest und regulirt dadurch das Eindringen der Schar; die
beiden andern fassen den Hebel zwischen sich und ändern, je nachdem sie gedreht
werden, die seitliche Neigung der Schar gegen das Pfluggestell.
Die Figuren
41, 42,
43 und
44
stellen die Befestigungsweise des Messers für einen Pflug mit doppeltem Baum dar.
K ist ein gußeiserner um die Achse L beweglicher Theil, welcher die Neigung des
Pflugmessers zum Baum ändert; O, O zwei Bolzen mit
Oehren, durch welche das Pflugmesser geht. Die Schrauben dieser Bolzen treten durch die in dem Theile
K befindlichen Schlize P,
P und ziehen mit Hülfe der Muttern das Messer gegen die Theile R, R. Die Schlize P, P
gestatten eine Seitenbewegung des Messers. S ist eine
durch beide Seiten des Baumes gehende Schraube und T
eine Mutter, welche zur Feststellung des Theils K
dient.
Die Figuren 45
und 45a
liefern einen Grundriß und eine Seitenansicht des Rechens, a ist die Achse, an welcher sich ein dreiekiges Stük b befindet; c, c, c sind
krumme auf das dreiekige Stük passende Zähne; d ist ein
an derselben Achse befindliches Rad mit drei Fangfedern; c ein Theil eines um f drehbaren Gestells,
welches das Lager der Achse a enthält. Dieses Gestell
ist bei f mit einem andern auf zwei Rädern G ruhenden Gestell verbunden, so daß die Spizen der
Zähne in beliebigem Abstande vom Boden arbeiten können.
Die Fangfeder stößt gegen einen Aufhälter h; wenn nun die
untere Zahnreihe voll ist, so wird die Fangfeder von einem Maschinenwärter
ausgelöst; dieser drükt den Hebel d' gegen den Kranz des
Rades d, welches sich alsdann in der Richtung des
Pfeiles vorwärts bewegt, bis die nächste Fangfeder gegen den Aufhälter stößt, worauf
eine andere Zahnreihe in Thätigkeit kommt u.s.w.
Fig. 46
stellt den Seitenaufriß und Fig. 47 den Endaufriß der
Pferdemühle oder des auf Rädern ruhenden Treibapparates unserer Dreschmaschine dar.
A ist ein gezahnter Ring oder ein Winkelrad ohne
Speichen, welches auf einer Platte B ruht; diese Platte
ist mit einer Rinne versehen, welche auf eine an der unteren Seite von A befindliche Hervorragung paßt. C ist ein Theil des hölzernen Wagengestells; D,
D sind an den Ring A befestigte Hülsen, in
welche die Enden der Hebel, woran die Pferde ziehen, gestekt werden. Das Rad A treibt bei seiner Umdrehung das Getriebe E, dessen Achse in der Platte B gelagert ist. An derselben Welle sizt ein Stirnrad F, welches im Innern des ringförmigen Rades A arbeitet und in ein Getriebe G greift, dessen Achse auf zwei an die Bodenplatte befestigten Trägern H, H gelagert ist. Ein an der Welle E frei rotirendes Frictionsrad I hat den Zwek, zu verhüten, daß sich das Rad A von der Bodenplatte erhebe. Die Welle K ist
vermittelst Universalgelenken mit der Welle L, Fig. 48,
verbunden. Fig.
48 stellt einen Endaufriß und Fig. 49 einen
Seitenaufriß der Dreschmaschine dar. Uebrigens kann durch obige Pferdemühle eben so
gut eine Häkselschneidmaschine oder irgend ein anderer landwirthschaftlicher Apparat
in Betrieb gesezt werden.
Die Welle L enthält ein Rad M, welches in ein an der Achse des Cylinders O
befindliches Getriebe N greift. An den Cylinder ist in schraubenförmig
geneigter Richtung eine Anzahl Schläger befestigt. Zuweilen richten wir die Schläger
parallel zur Achse und geben dann den Hervorragungen der Concavität P, gegen welche das Korn gerieben wird, eine geneigte
Lage gegen die Achse der Trommel. Q, Fig. 49, ist ein über die
Walzen R, R' geschlagenes endloses Nez, welches
vermittelst einer an der Welle L befindlichen und durch
einen Riemen mit R verbundenen Rolle in Bewegung gesezt
wird. Auf dieses Nez fällt das Stroh und Korn nach seinem Durchgang durch die
Maschine. S ist eine andere Rolle, an deren Achse sich
eine Rüttelvorrichtung T befindet, welche das Nez
während seiner Bewegung von R nach R' schüttelt, so daß das Korn durch die Maschen des
Nezes fällt, während das Stroh weitergeführt wird. Wir geben einem Drahtnez mit
ungefähr 1 Quadratzoll großen Maschen den Vorzug.
Die Figuren 50
und 51
stellen die Verbindungswelle K, Fig. 46, nach einem
größeren Maaßstabe im Durchschnitte dar. Sie besteht aus einer Metallröhre, worin
ein solides Metallstük hin und her verschiebbar ist, ohne sich jedoch darin drehen
zu können. Diese Anordnung gestattet, den Abstand zwischen der verarbeitenden
Maschine und dem Treibapparate je nach Umständen zu verändern und verhütet zugleich
die Uebertragung der Vibration von einem Theile der Maschine auf den andern.
Fig. 52 ist
die Seitenansicht;
Fig. 53 die
hintere Ansicht und
Fig. 54 der
Grundriß einer Egge, welche in ihren Haupttheilen der Egge von Biddel gleicht; unsere Verbesserungen an derselben bestehen darin, daß wir
das Gestell aus Gußeisen mit schmiedeisernen Verbindungsstangen verfertigen und an
die lezteren die Zinken befestigen, welche sich in perpendiculärer und seitlicher
Richtung adjustiren lassen. Wir hängen außerdem das Gestell an zwei Hebel, deren
Drehungsachse eine gerade Stange ist, welche zugleich die Achse der Trageräder
bildet. A, A stellt die Vorderräder des Apparates dar;
B, B die Hinterräder, welche das Hauptgewicht des
Gestells tragen; C die Achse der Räder B, B: D, D das gußeiserne Endgestell; E, E die Hebel zum Heben und Niederlassen des Gestells;
diese Hebel werden durch eine in den Einschnitten des gußeisernen Gestells wirkende
Fangfeder F in der erforderlichen Höhe erhalten; der
weiteren Sicherheit wegen fügen wir jedoch noch einen Bolzen bei, welcher durch das
zunächst unter dem Hebel befindliche Loch gestekt wird. An jedem Ende des Gestells
befindet sich ein gußeiserner mit Kerben versehener Rahmen nebst Hebel, um die Höhe
der Enden verändern
und das Gestell selbst gegen die Oberfläche des Bodens auf jede Weise neigen zu
können.
Fig. 55
stellt den Seitenaufriß,
Fig. 56 den
Endaufriß und
Fig. 57 den
Grundriß eines unter der Erde arbeitenden Pfluges (draining
or subsoil plough) dar. A ist die Schraube,
deren Windungen gegen die Spize hin kleiner werden; die Achse dieser Schraube ist,
wenn sie arbeitet, parallel zu dem Boden der einzuschneidenden Rinne (drain). B ist ein auf vier
Rädern C, C, C ruhendes Holzgestell. Die Achse der
Schraube ist durch ein Universalgelenk D mit der Welle
F verbunden, an der sich ein Rad G befindet, welches durch das an der Achse I sizende Getriebe umgedreht wird. Leztere Achse trägt
ein Winkelrad K, welches mit einem andern Winkelrade L in Eingriff steht, dessen Achse zwei Kurbeln N, N enthält; durch Umdrehung dieser Kurbeln wird
demnach die Schraube in Bewegung gesezt. Die Achse der Schraube geht bei M durch ein Eisenstük, das zu beiden Seiten ein Messer
enthält, dessen anderes Ende an das Holzgestell B
festgeschraubt ist. Beide Messer divergiren, wie Fig. 56 zeigt, so daß die
zu schneidende Rinne oben breiter als unten wird. Unmittelbar hinter den vorderen
Kanten der Messer befindet sich eine geneigte Ebene, welche das Erdreich aufnimmt,
das durch ein Formbrett seitwärts geschafft wird. Bei O
bemerkt man eine kleine Winde, mit deren Hülfe die Schraube und nach Herausnahme der
betreffenden Befestigungsbolzen auch die Messer in die Höhe gewunden werden können.
Nachdem ein Loch von geeigneter Tiefe in den Boden gegraben worden ist, sezt man die
Schraube mit Hülfe der Kurbeln N, N in Umdrehung;
während sie sich parallel zur Oberfläche in die Erde einbohrt, zieht sie die Messer
und die geneigte Ebene nach sich.
Tafeln