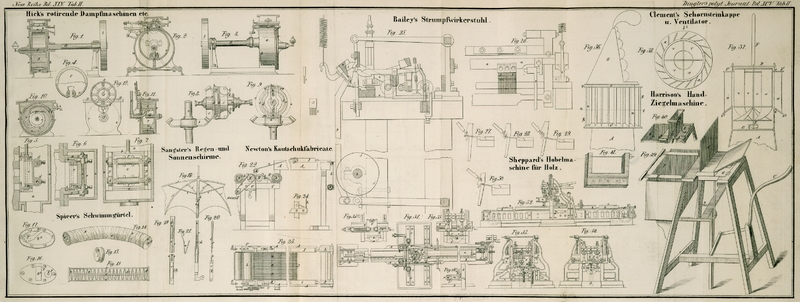| Titel: | Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen, und an Apparaten zum Heben und Messen des Wassers, worauf sich John Hick, Ingenieur zu Bolton-le-Moors in der Grafschaft Lancaster, am 5. Dec. 1843 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. XXIII., S. 81 |
| Download: | XML |
XXIII.
Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen, und
an Apparaten zum Heben und Messen des Wassers, worauf sich John Hick, Ingenieur zu
Bolton-le-Moors in der Grafschaft Lancaster, am 5. Dec. 1843 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts, Nov. 1844, S.
225.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Hick's Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen.
Vorliegende Verbesserungen beziehen sich
1) auf rotirende Dampfmaschinen im Allgemeinen;
2) auf die Construction der Schieberventile für Dampfmaschinen überhaupt, bei denen
die Reibung durch die unten zu beschreibenden Mittel bedeutend vermindert wird;
3) auf eine einfache Vorrichtung, um Dampfmaschinen mit Wellen und sonstigen
Mechanismen in oder außer Verbindung zu sezen;
4) auf Vorrichtungen zum Heben und Messen des Wassers.
Fig. 1 stellt
einen senkrechten Querschnitt, Fig. 2 einen senkrechten
Längendurchschnitt und Fig. 3 eine äußere Ansicht
der verbesserten rotirenden Dampfmaschine dar. Fig. 4 liefert einen
abgesonderten Durchschnitt des inneren Cylinders, um die Art der Kolbenliederung zu
erläutern. a, a ist ein genau ausgebohrter äußerer
Mantel oder Cylinder, der an einer Seite bei b
festgeschraubt oder festgegossen ist; c, c ein in diesem
Cylinder angeordneter kleinerer Cylinder, der mit einem Theil seiner Peripherie
stets mit dem äußeren Cylinder in Berührung ist, auch zu beiden Seiten genau an
denselben anschließt. Mit dem Cylinder c, c ist die
Treibwelle d verbunden. e, e
ist ein Dekel, der zur Untersuchung der inneren Theile nach Belieben abgenommen
werden kann; f ein Drehungspunkt, um den die Scheidewand
oder der Kolben g, g frei rotirt. Dieser Kolben besizt,
um die Entweichung des Dampfs zu verhüten, an seinem äußeren Ende eine
Metallliederung und an seinen Seiten eine allseitig bewegliche Liederung i, i. An dem oberen Theil des äußeren Cylinders a, a sind bei h, h,
Fig. 1,
Oeffnungen für den Ein- und Austritt des Dampfs angebracht. Jede dieser
Oeffnungen kann zur Bewegung der Treibwelle nach beiderlei Richtungen benüzt werden.
Die Umkehrung der Bewegung wird mit Hülfe des Schiebventils j
bewerkstelligt. Dieses
Ventil wird durch ein an der Welle d befestigtes
Excentricum in geeigneten Intervallen geöffnet und geschlossen. Die Wirkungsweise
ist folgende: der durch die Röhre k und die Oeffnung h herbeiströmende Dampf wirkt auf den in dem
excentrischen Raume zwischen den Mindern a und c befindlichen Theil des Kolbens g und treibt auf diese Weise den inneren Cylinder herum, bis der Kolben
die Austrittöffnung erreicht hat, worauf der Dampf durch das Ventil j abgesperrt wird, und so lange abgesperrt bleibt, bis
der Kolben an der Eintrittsöffnung vorübergegangen ist; das in dem Schwungrad
angehäufte Bewegungsmoment gestattet diese Absperrung.
Fig. 5 stellt
das verbesserte Schieberventil mit einem Theil des Dampfcylinders und der
Ventilbüchse im Längendurchschnitt, Fig. 6 im Querschnitt und
Fig. 7 in
der hinteren Ansicht dar. a, a ist die Büchse, b, b das Ventil selbst, welches mit einem losen Dekel
c versehen ist; an diesen sind mit Hülfe der
Spindeln e, e die Rollen d,
d befestigt, welche sich mit dem Ventil bewegen und auf hervorstehenden
glatt gehobelten Schienen g, g laufen, die parallel zu
der Fläche, worauf das Ventil gleitet, angeordnet sind, f,
f ist ein Ring, welcher gegen irgend eine elastische Liederung geschraubt
wird, um die Dampfentweichung zu verhüten. Demnach wird ein großer Theil des Druks
von der Ventilfläche genommen und auf die Rolle d, d
übertragen, und somit die Reibung vermindert. Dieses Ventil läßt sich bei
Dampfmaschinen jeder Gattung anwenden. Uebrigens läßt sich der erste und zweite
Theil der in Rede stehenden Verbesserungen nicht nur auf rotirende Dampfmaschinen,
sondern auch auf Pumpen, so wie auf Apparate zum Messen des Wassers anwenden.
Die Figuren 8
und 9 stellen
den verbesserten Treibapparat in Anwendung auf ein paar Winkelräder zum Betrieb
einer Mange dar. Ein an die Hauptwelle a festgekeiltes
Rad b greift in das Rad c,
welches an seiner Rükseite mit einer geeigneten Hervorragung d, ferner mit gewöhnlichen Frictionsbändern e
versehen ist, und lose auf der in Bewegung zu sezenden Querwelle f läuft. Anstatt der Bolzen die man gewöhnlich anwendet,
um die Frictionsbänder gegen den Blok an der Rükseite des Rades anzuziehen, sind
hier zwei Schrauben g, g mit rechts und links gewundenen
Gängen eingeführt, die in deren Mitte ein Getriebe h, h
enthalten. Diese Getriebe laufen zwischen zwei Baken, welche an den Treibarm j gegossen sind. Dieser an die Welle f festgekeilte Arm ist mit zwei gezahnten Quadranten k, k versehen, welche in zwei Zahnstangen l, l greifen. Das eine Ende jeder dieser Zahnstangen ist
an einen Muff m geschraubt, welcher auf geeigneten in
der Welle f eingelassenen Keilen gleitet, zugleich aber mit der lezteren
herumgeführt wird. Dieser verschiebbare Ring wird auf die gewöhnliche bei
Kuppelungen gebräuchliche Weise mittelst Hebeln hin- und hergerükt. Wenn die
Welle f und der Treibarm j
nebst den gezahnten Quadranten, dem Getriebe, den rechts und links gewundenen
Schrauben und Frictionsbändern stationär sind, so bewegen sich die Räder allein, und
der an die Zahnstangen l, l befestigte Muff m ragt, wie Fig. 8 zeigt, um die Länge
der Zahnstangen heraus. Schiebt man nun den Muff mit den Zahnstangen gegen den Arm
j hin, so theilt sich die Bewegung vermittelst der
Quadranten dem Getriebe und den rechts und links gewundenen Schrauben mit; dadurch
werden die Frictionsbänder angezogen und die mit dem Apparat in Verbindung stehende
Maschine kommt sanft und stufenweise in Bewegung, ohne jene unangenehmen und
schädlichen Stöße, welche bei gewöhnlichen Kuppelungen stattfinden. Vorliegendes
System eignet sich hauptsächlich für Mangen und Maschinen überhaupt, bei denen die
gewöhnlichen Bremskränze und Kuppelungen in Anwendung kommen.
Der vierte Theil der Verbesserungen betrifft einen Hydrometer oder eine Maschine zum
Messen und Registriren des durch Röhren fließenden Wassers. Fig. 10 stellt einen
senkrechten Durchschnitt, Fig. 11 einen Querschnitt
und Fig. 12
einen Frontaufriß des Apparats dar. Er besteht aus einem spiralförmigen Rade oder
einer hohlen Trommel a, mit Abtheilungen b, b, welche mit einer Centralkammer c communiciren. Die Trommel ist um einen an dem Gehäuse
e befestigten Zapfen d
drehbar. Durch eine Oeffnung, die an einer ihrer Seiten angebracht ist, tritt eine
Röhre f ins Innere, welche die zu messende Flüssigkeit
in den Apparat leitet. Das Gehäuse e besizt einen
wasserdicht aufgeschraubten Dekel g, und wird bis zur
Linie l, l mit Queksilber oder irgend einer andern
Flüssigkeit gefüllt, die specifisch schwerer als Wasser ist. Das Niveau der
Flüssigkeit liegt über der Centralöffnung in der Seite der rotirenden Trommel,
jedoch unter der Mündung der Röhre f. Ueber dem
Queksilberniveau l, l ist eine durch einen Hahn
verschließbare Austrittröhre h angebracht, jedoch von
geringerem Durchmesser als die Einströmungsröhre. Wird nun durch die Röhre f von einem höheren Niveau aus Wasser in die Maschine
geleitet, so füllt dasselbe den Raum über der Queksilberlinie l, l aus, und beim Oeffnen des Hahns h übt
dasselbe auf diejenige Kammer der rotirenden Trommel, deren innere Oeffnung mit der
Mündung der Eintrittsröhre f communicirt, während ihre
äußere Mündung unter Queksilber liegt, einen Druk aus. Die Trommel beginnt demnach
in der Richtung des Pfeils zu rotiren, und fährt damit so lange fort, bis sich die
innere Oeffnung der
nächstfolgenden Kammer über die Linie l, l erhebt. Da
jede Kammer der Reihe nach am Mittelpunkt mit der Eintrittsröhre f communicirt, so wird die Rotation der Trommel so lange
währen, als die Austrittsröhre offen ist. So lange die Austrittsröhre von geringerem
Kaliber als die Eintrittsröhre ist, kann begreiflicher Weise kein Wasser durch die
Maschine gehen, ohne die Rotation derselben zu veranlassen; und zwar steht die
Rotationsgeschwindigkeit in einem genauen Verhältniß zu derjenigen, womit das Wasser
aus der Ausmündungsröhre fließen kann. Sobald der Hahn h
geschlossen wird, hört auch die Rotation der Trommel auf, weil nun das einfließende
Wasser auf die inneren Seiten der Kammern keinen Druk mehr ausüben kann.
Das durch die Maschine strömende Wasser wird auf folgende Weise registrirt. Fig. 12 zeigt
diesen Theil des Apparats. Ein an der Trommel befestigtes Stirnrad 1 greift in ein
Rad 2, dessen Achse durch eine Stopfbüchse aus dem Gehäuse e hervorragt, und ein Getriebe 3 enthält, welches in das Rad 4 greift. Ein
an diesem Rad befestigter Zeiger deutet auf die Anzahl der Gallons, die auf dem
Zifferblatt 5 markirt sind.
Tafeln