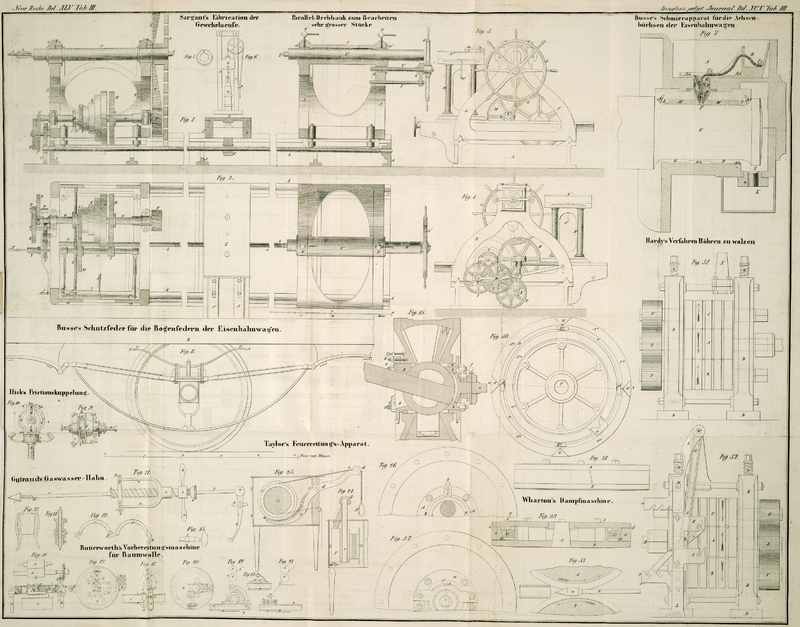| Titel: | J. Hardy's verbesserte Methode Röhren zu walzen. |
| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. L., S. 175 |
| Download: | XML |
L.
J. Hardy's verbesserte Methode Roͤhren zu
walzen.
Aus dem Mechanics' Magazine, Okt. 1844, S.
274.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Hardy's Methode Röhren zu walzen.
Fig. 31
stellt die Frontansicht und Fig. 32 die hintere
Ansicht eines Systems dreier dem vorliegenden Patente gemäß über einander
angeordneter Walzen A, B und C dar. D, D sind die gußeisernen Träger des
Gerüstes, mit messingenen Lagern, in welchen die Hälse oder Zapfen der Walzen ruhen;
a, a Stellschrauben, um diese Lager so zu
adjustiren, daß die Umfänge der Walzen stets in Berührung mit einander bleiben und
sich nicht von einander trennen können, wenn das glühende Eisen zwischen denselben
hindurchgeht. E, F, G sind drei an den Achsen der drei
Walzen befestigte Getriebe von gleicher Größe und Zähnezahl, durch deren Eingriff
die Walzen mit gleichen Geschwindigkeiten umgetrieben werden. Die Triebkraft kann
von dem Wasserrade oder der Dampfmaschine aus vermittelst einer Verbindungswelle H auf die mittlere Walze übertragen werden. Die an den
Umfängen der drei Walzen angeordneten Rinnen bieten an ihren Vereinigungsstellen
Oeffnungen von beinahe kreisförmiger Gestalt dar, zwischen denen das heiße Eisen
hindurchgeführt wird. Jede Walze besizt vier stufenweise kleiner werdende Rinnen.
Die beiden größten durch diese Rinnen gebildeten Oeffnungen dienen zum
Zusammenschweißen der Röhre mit einem Kern, und die beiden andern zur Verlängerung
derselben ohne Kern. Uebrigens bindet sich der Patentträger keineswegs an eine
bestimmte Anzahl von Rinnen oder Oeffnungen. I und K sind feste Aufhälter, welche in geeigneter Entfernung
hinter den Walzen angeordnet sind, um die hervorragenden kreisrunden Scheiben an dem
Ende des Kerns zu ergreifen, so daß der Kern bewegungslos bleibt, während das
glühende Eisen über das dike Ende desselben hinweggeführt wird. Die Aufhälter I und K sind an einen
aufrechten Träger L, L befestigt. Dieser wird durch
einen langen horizontalen Bolzen M festgehalten, welcher
sich, wie Fig.
32 zeigt, von einem der Träger D, D des
Maschinengerüstes nach dem oberen Ende des Trägers L
erstrekt. Der Abstand zwischen den Platten I, K und der
verticalen Centrallinie der Walzen richtet sich nach der Länge des Kerns und diese
muß die Länge der längsten durch das Walzwerk zu schweißenden Röhre übersteigen. Die
Kernstange N, Fig. 33, braucht nur von
den erwähnten Hältern I, K bis zu den Walzen zu reichen,
so daß, wenn die Erweiterung n am Ende des Kerns in eine
Oeffnung des Walzwerks gestekt wird, das andere Ende der Kernstange in der Kerbe einer der Platten
I, K ruht. Diese Kerben entsprechen den beiden
weitesten Oeffnungen zwischen den Walzen, wie Fig. 32 zeigt.
Tafeln