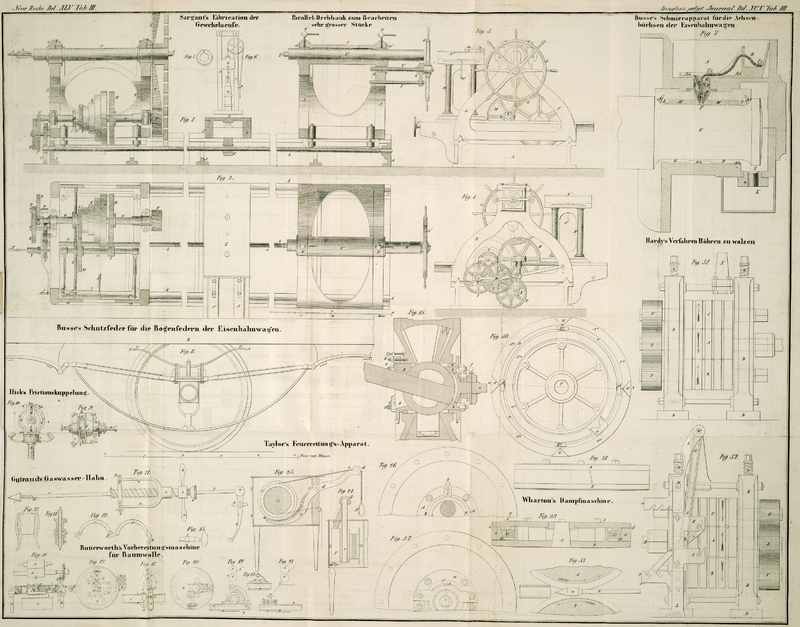| Titel: | Verbesserungen an Vorbereitungsmaschinen zum Spinnen der Baumwolle, worauf sich John Holland Butterworth, Baumwollspinner zu Rochdale in der Grafschaft Lancaster, am 20. März 1844 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. LII., S. 180 |
| Download: | XML |
LII.
Verbesserungen an Vorbereitungsmaschinen zum
Spinnen der Baumwolle, worauf sich John Holland Butterworth, Baumwollspinner zu Rochdale in der Grafschaft
Lancaster, am 20. Maͤrz 1844 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Nov.
1844, S. 282.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Butterworth's Verbesserungen an Vorbereitungsmaschinen zum Spinnen
der Baumwolle.
Den Gegenstand meiner Erfindung bildet ein rotirender Apparat, welcher über die
Mündung einer Kanne, so wie man diese zur Aufnahme der Baumwollenbänder anwendet,
gestellt wird. Dieser Apparat nimmt das Baumwollenvließ in dem Zustand auf, in
welchem dasselbe eine Krämpelmaschine verläßt, und legt es in Windungen in eine
Kanne, so daß, wenn ein solches gewundenes Vließ vom Boden der Kanne bis zum Apparat
reicht, derjenige Theil des Vließes, welcher nachher aus dem Apparat tritt, den
übrigen in der Kanne befindlichen gewundenen Theil drükt und verdichtet. Mit Hülfe
dieses neuen Apparats kann ein Baumwollenvließ in eine Kanne in Windungen gelegt und
ohne Strekung oder sonstige für die nachfolgenden Operationen nachtheilige
Veränderungen auf jeden beliebigen Grad verdichtet werden.
Fig. 16
stellt eine Frontansicht im Durchschnitt durch die Mitte meines rotirenden Apparats
dar. Dieser Apparat ist über der Mündung einer Kanne und unter einem Paare
Kalanderwalzen angeordnet; von den lezteren nimmt der Apparat das Vließ in Empfang
und legt es in die Kanne.
Fig. 17 ist
ein Grundriß des Apparats;
Fig. 18 eine
Seitenansicht von Fig. 17;
Fig. 19 die
Frontansicht einer andern Anordnung meines rotirenden Apparats;
Fig. 20 der
Grundriß des Fig.
19 dargestellten Apparats;
Fig. 21 die
Frontansicht einer andern Einrichtung;
Fig. 22 die
Endansicht beider Kalanderwalzen mit den Theilen des Fig. 21 dargestellten
Apparats. In sämmtlichen Figuren sind zur Bezeichnung der entsprechenden Theile
gleiche Buchstaben gewählt.
A, A,Fig. 16, sind
die Kalanderwalzen; b ist das Vließ oder lokere
Baumwollenband; c ein an der Achse der unteren
Kalanderwalze befestigtes Winkelrad, welches in ein zweites Winkelrad d greift. Das leztere Rad ist mit dem Stirnrad e an einer und derselben hohlen Achse f befestigt. B sind Stangen,
die sich von dem Loden des Zimmers aus erheben, und zwischen denen die Kannen C angeordnet sind. g ist ein
kurzer Metallcylinder, der an seiner äußeren Seite zwei hervorragende Büchsen
enthält, deren jede zur Aufnahme einer der Stangen B ein
Loch besizt. Die auf diese Stange geschraubten Büchsen halten den Cylinder g. An eine der Stangen B ist
auch ein Lager h geschraubt, welches die Achse i tragt, auf der die hohle Welle f läuft. An den Cylinder g ist ein Ring j befestigt, welcher eine Rinne und eine Anzahl Zähne
k besizt, die an seiner oberen Seite ein Winkelrad
bilden. An der unteren Leite der Scheibe D ist ein
kurzer Cylinder l befestigt, welcher in der erwähnten
Rinne des Ringes j spielt. Rings um den Cylinder l ist eine Anzahl Zähne gegossen, welche ein Stirnrad
bilden, das mit dem Stirnrad e in Eingriff steht. E ist eine kreisrunde Scheibe, an deren oberer Seite ein
kurzer Cylinder befestigt ist, welcher sich bis zur Scheibe D erstrekt, und beide Scheiben im geeigneten Abstand von einander erhält.
Der mittlere Theil dieser Scheibe E ist etwas vertieft,
um die Windungen des Vließes in der Kanne spiralförmig zu vertheilen, wenn sie hoch
genug heraufreichen. In der Scheibe E befindet sich eine
Oeffnung, durch welche das lokere Band in die Kanne gelangt. Die Scheibe E wird an die Scheibe D
geschraubt, so daß sie gemeinschaftlich rotiren. In Fig. 17 ist m eine kurze in dem Lager n
laufende Welle, an deren einem Ende sich ein Winkelrad o
befindet, welches in das feste Winkelrad k greift,
während ihr anderes Ende ein Stirnrad p enthält, welches
in das an der Achse der Walze q befestigte Stirnrad
greift. An dem andern Ende dieser Achse sizt das Stirnrad r fest, welches in das Stirnrad s greift.
Dieses ist an der Achse der andern Walzen befestigt. t,
u und v
sind Leitungswalzen.
Ein endloser Riemen z, Fig. 16, geht zum Theil
um die Walzen t und u und
ein anderer Riemen z zum Theil um die Walzen q und v. Die Riemen besizen
an ihrer äußeren Seite parallel zu den Walzen messingene Querstreifen. Die untere
Seite des oberen Riemens und die obere Seite des unteren Riemens bewegen sich in
Berührung mit einander; das lokere Baumwollenband tritt von den Walzen A durch den Trichter w
zwischen die Walzen q und t,
zwischen die endlosen Riemen und die Leitungswalzen v
und u und gelangt durch die Oeffnung der Scheibe E in die Kanne C. Die Lager
x der vier Walzen q, t,
v und u sind an der unteren Seite der Scheibe
D befestigt, und die Oberflächen der endlosen Riemen
bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit wie die Oberflächen der Walzen A. Aus der vorhergehenden Beschreibung erhellt, daß wenn
die Walzen A in Bewegung gesezt werden, die Scheibe D durch die Räder c, d, e
und l in Rotation gesezt wird, und daß vermittelst der
Räder k, o auch die Walzen q
und t, so wie die endlosen Riemen z, welche das Vließ von den Walzen A in
Empfang nehmen, um dasselbe in Windungen in die Kanne niederzulegen, in Bewegung
gesezt werden. Wenn die Windungen des Vließes die Scheibe E erreichen, so fahren die endlosen Riemen fort, noch mehr Vließ auf das
bereits in der Kanne befindliche zu legen, bis der ganze Inhalt der Kanne gehörig
comprimirt ist. Bei der Fig. 19 und 20
dargestellten Einrichtung tritt das lokere Band von den Walzen A zwischen eine Kugel und eine mit einer Rinne
versehenen Rolle und durch eine in den Scheiben D und
E befindliche Oeffnung in die Kanne.
Bei der Einrichtung Fig. 21 läuft das lokere Band b durch eine
trompetenförmige Oeffnung 2, welche über der Mitte des Apparats angeordnet ist,
durch eine zweite ähnliche Oeffnung w, durch zwei
Kalanderwalzen 3 und gelangt durch eine in den Scheiben D und E befindliche Oeffnung in die Kanne.
Fig. 22
ist eine Endansicht beider Kalanderwalzen und einiger in Fig. 21 sichtbaren Theile
des Apparats.
Tafeln