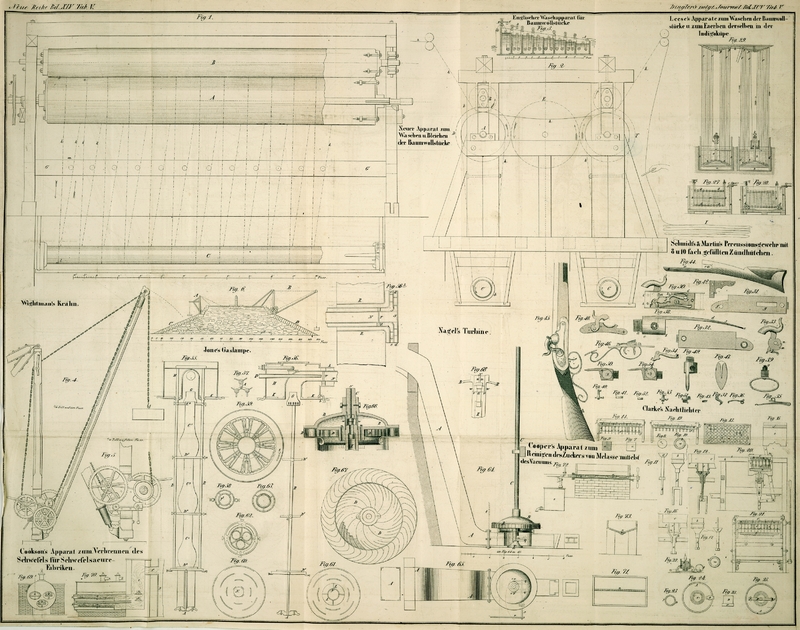| Titel: | Bemerkungen über die Vortheile des durch William Wightman im Jahr 1837 eingeführten Krahns mit beweglichem Schnabel, insbesondere in Anwendung auf Brüken- und Hafenbauten. |
| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. LXXXIV., S. 335 |
| Download: | XML |
LXXXIV.
Bemerkungen uͤber die Vortheile des durch
William Wightman im Jahr 1837 eingefuͤhrten Krahns mit
beweglichem Schnabel, insbesondere in Anwendung auf Bruͤken- und
Hafenbauten.
Aus dem Edinburgh new philosophical Journal, December
1844 – Januar 1845, S. 62.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Ueber Wightman's Krahn mit beweglichem Schnabel.
Es ist eine bekannte Sache, daß vor dem Jahr 1837 bei öffentlichen Bauten kein
anderer als der gewöhnliche Schnabelkrahn gebräuchlich war. Dieser differirte zwar
hie und da ein wenig hinsichtlich der Form und Anordnung des Mechanismus, ohne
jedoch von dem Princip abzuweichen.
Die kleine Skizze A, Fig. 6, mag einen
allgemeinen Begriff von der gebräuchlichen Einrichtung eines solchen Krahns geben.
Er war indessen selbst in seiner besten Form stets schwerfällig und das Heben und
Niederlassen der Lasten war immer mehr oder weniger mit Gefahr verbunden. Auch ist
zu bemerken, daß seine Fähigkeit bei Bauten Steine oder sonstiges Material zu heben,
bald erschöpft war, indem der Aufhängepunkt nur einen Kreis beschreiben konnte,
dessen Halbmesser der Länge des Querbaums gleichkam. Diesem Mangel konnte man nur
dadurch ein wenig abhelfen, daß man das schwebende Material mit der Hand aus seiner
perpendiculären Lage an den Ort seiner Bestimmung oder wenigstens so nahe als
möglich an denselben hinzog. Es muß demnach zugegeben werden, daß der gewöhnliche Schnabelkrahn eine
sehr unvollkommene Maschine war, da wo es sich darum handelte schwere Massen von
Baumaterialien an stets wechselnde Punkte zu schaffen; in manchen Fällen mußte
derselbe einen Tag um den andern an eine andere Stelle hingeschafft werden, was
große Kosten und Zeitverlust zur Folge hatte.
C, D, Fig. 6, stellt den
Querschnitt eines Theils des Granton-Damms; B
eine Skizze des verbesserten Krahns dar. Diesem Krahn, welcher die ungeheure
Böschung ganz beherrscht, gegenüber springt die Unzulänglichkeit des gewöhnlichen
Krahns, eine solche Arbeit mit Vortheil zu vollbringen, deutlich in die Augen.
Die meisten Brüken und Viaducte der Edinburgh-Glasgow Eisenbahn wurden unter
Beihülfe meines Krahns gebaut. Ich habe denselben mit Erfolg beim Schiffbau in
Anwendung gesehen, wo der Schnabel nicht weniger als 70 Fuß lang und im Stande war
einen schweren Balken nach jeder beliebigen Stelle eines großen Schiffs hinzubringen
und zugleich zur Aufnahme des Zimmerholzes einen weiten Umkreis des Felds
beherrschte.
Fig. 4 stellt
den verbesserten Krahn mit beweglichem Schnabel (movable
derrick-crane) in seinen richtigen Verhältnissen dar; da jedoch der
Mast und der Schnabel nach Umständen größer oder kleiner gewählt werden kann, so
läßt sich in Beziehung auf die Länge beider keine bestimmte Regel aufstellen. Ich
habe mich nie eines kleineren Mastes als eines solchen von 25 Fuß Höhe oder eines
Schnabels über 55 Fuß Länge bedient. Der Schnabel sollte vom Mast aus nie um einen
größeren Winkel als 65 Grad herabgelassen werden, indem sonst der Zug gegen die
Schnabelkette und die Streben des Masts zu groß ausfallen würde.
Der Durchmesser der Kette zum Heben oder Senken des Schnabels, die in der Regel aus
dem besten Kabeleisen angefertigt wird, beträgt 13/16 Zoll, während die eigentliche
Tragkette nur 11/16 Zoll Durchmesser hat; mit dieser hebt der Krahn innerhalb seines
ganzen Wirkungskreises ein Gewicht von vier Tonnen. Auf einen Umstand sollte man
indessen besonders Acht haben, nämlich die Maschine nie einem Arbeiter
anzuvertrauen, bevor sich derselbe mit der Einrichtung des Krahns etwas näher
bekannt gemacht hat; denn der geringste Irrthum, wenn der Arbeiter z.B. das Einlegen
der Sperrkegel in das Sperrrad vergessen sollte, nachdem die Kurbeln nach erfolgtem
Niederlassen des Schnabels mit dem Räderwerk außer Verbindung gesezt worden sind,
könnte sehr ernstliche Folgen haben; während auf der andern Seite mit einiger
Erfahrung und Aufmerksamkeit nichts sicherer ist, als dieser Krahn.
Fig. 5 liefert
die Seitenansicht des Krahns von der andern Seite aus betrachtet und in etwas
größerem Maaßstab als Fig. 4.
Tafeln