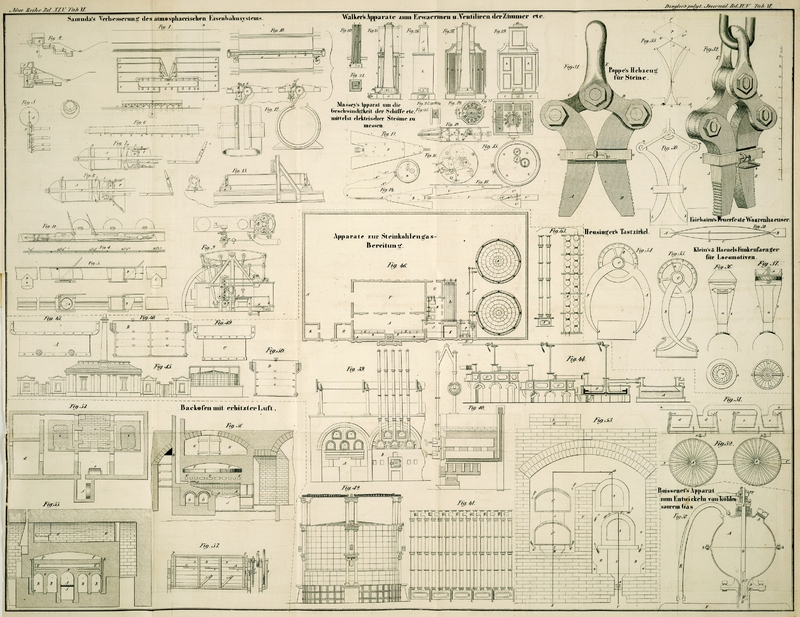| Titel: | Apparat, um die Geschwindigkeit von Schiffen, so wie auch die Stromgeschwindigkeit von Flüssen mit Hülfe elektrischer Strömungen zu ermitteln, worauf sich Edward Massey zu Clerkenwell, Grafschaft Middlesex, am 1. Jun. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. CVII., S. 429 |
| Download: | XML |
CVII.
Apparat, um die Geschwindigkeit von Schiffen, so
wie auch die Stromgeschwindigkeit von Fluͤssen mit Huͤlfe elektrischer
Stroͤmungen zu ermitteln, worauf sich Edward Massey zu Clerkenwell, Grafschaft
Middlesex, am 1. Jun. 1844 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Febr.
1845, S. 74.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Massey's Apparat, um die Geschwindigkeit von Schiffen zu
messen.
Die Zeichnung Fig.
14 stellt den Registrirapparat, Rotator und die Art wie sie mit einander
in Verbindung gesezt sind, dar. A ist ein Seil,
bestehend aus zwei Kupferdrähten, von denen jeder mit Baumwolle und einem
wasserdichten Firniß überzogen ist. Diese Drähte liegen neben einander und sind mit
Schnur überwikelt, um ihre unmittelbare Berührung zu verhüten; sie endigen sich in
dem unten zu beschreibenden Gestell B und sind so
angeordnet daß, wenn der Rotator C eine gewisse Anzahl
von Umdrehungen gemacht hat, ihre Enden mit Hülfe einer dünnen Messingplatte auf die
nachher näher zu bezeichnende Art vereinigt werden können. Nur derjenige Theil des
Seils A ist mit Schnur umwikelt, welcher ins Wasser
getaucht, eben so derjenige, welcher an die Seite des Schiffs befestigt ist. Nach
ihrem Eintritt in das Schiff trennen sich die Drähte; der eine A¹ geht direct nach dem einen Pole der Batterie,
der andere A² ist, anstatt unmittelbar nach dem
andern Pol sich zu erstreken, mit dem einen der Drähte verbunden, welche in dem
Registrirapparat D rings um die Magnete laufen; das
andere Ende des von dem Magnet in D kommenden Drahts
wird alsdann vermittelst des Drahts A³ mit dem
andern Pole der Batterie verbunden, womit die galvanische Kette geschlossen ist. Ich
bediene mich der sogenannten Daniell'schen Batterie mit
schwefelsaurem Kupfer, deßgleichen einer in welcher die verdünnte Schwefelsäure
durch Salzwasser ersezt wird. Die Batterie kann mit dem Register an irgend einer
geeigneten Stelle des
Schiffs aufgestellt werden, z.B. die Batterie auf dem Dek und das Register in der
Cajüte. Wenn nun der Contact an den Drahtenden durch die unten zu beschreibende
Messingplatte hergestellt ist, was von der Umdrehung des Rotators abhängt, so
verwandelt der elektrische Strom die weichen Eisenstüke, indem er sie umkreist, in
Magnete, der Anker wird angezogen und hebt dadurch die gezahnte Feder an dem Ende
des Hebels über einen andern Zahn des Sperrrades. Sobald der Contact durch
Hinwegziehen der Messingplatten von den Drahtenden aufgehoben ist, hört auch der
elektrische Strom auf, die Eisenstüke zu umkreisen, wodurch diese die Fähigkeit
verlieren den Anker anzuziehen; der Hebel wird sofort durch eine Feder zurükgezogen,
wodurch das Sperrrad und mittelst Räderwerks die Zeiger in Bewegung kommen.
Fig. 15
stellt eine äußere und
Fig. 16 eine
innere Ansicht des Registrirapparats dar. Derselbe besteht aus einem Magnet a, einem um c drehbaren
Hebel b, b und einem Sperrrade d. Der Magnet gleicht einem gewöhnlichen Elektromagnet und besteht
entweder aus einem in Hufeisenform umgebogenen weichen Eisenstük, oder aus zwei
Stüken, die neben einander angeordnet und an der oberen Seite durch eine flache
Eisenplatte e mit einander verbunden sind. Diese Stüke
sind mit isolirtem Kupferdraht umwunden, dessen Enden durch Elfenbeinscheiben gehen,
die an den Messingdekel befestigt und zur Aufnahme der Muttern f, f mit Schraubenwindungen versehen sind. Die
Verbindungs- oder Leitungsdrähte A², A³ sind an ihren Enden mit geeigneten Anordnungen
versehen, um sie sowohl mit der Batterie, als auch mit den Enden g, g des nach dem Magnet in dem Registrirapparat sich
erstrekenden Drahts in Verbindung sezen zu können. An den Hebel b ist eine gezahnte Feder h
befestigt, welche in die Zähne des Sperrrads d greift.
Der Hebel ist einer hin- und hergehenden Bewegung fähig und hat das Bestreben
dem Zug nach der einen Richtung nachzugeben, wenn die weichen Eisenstüke, in Magnete
verwandelt, den Anker k anziehen; dagegen wirkt
beständig die leichte Feder l auf denselben, welche in
Wirksamkeit tritt, sobald die Eisenstüke ihre magnetische Anziehungskraft verlieren;
im lezteren Fall wirkt die gezahnte Feder h auf die
Zähne des Sperrrads, und sezt dasselbe in Bewegung, wogegen im ersteren Fall die
Feder nur über die Zähne des Sperrrads hinweggleitet; der Sperrkegel m verhütet eine rükgängige Bewegung des Sperrrads. n ist eine Schraube, mit deren Hülfe man den Spielraum
des Hebels regulirt.
Es ist jezt noch zu beschreiben, auf welche Weise das Sperrrad seine Bewegung den
übrigen Rädern und ihren Zeigern mittheilt. Durch die Umdrehung des Rotators wird ein Contact
hergestellt, so oft das Schiff 1/60 Meile zurükgelegt hat. Da nun das Sperrrad in 60
Zähne eingetheilt ist, so zeigt eine Umdrehung desselben an, daß eine Meile
zurükgelegt ist. Die Achse des Sperrrads d enthält ein
Getriebe von 8 Zähnen, welches in ein Rad von 80 Zähnen greift und an der Achse
dieses Rades befindet sich ein Rad von 40 Zähnen und ein Getriebe von 8 Zähnen; das
Rad von 40 Zähnen greift in ein anderes Rad von 40 Zähnen und das Getriebe von 8
Zähnen in ein Rad von 80 Zähnen. An der Achse des Sperrrades, an der Achse des
zweiten Rades von 40 Zähnen und an der des lezten Rades von 80 Zähnen befindet sich
ein Zeiger. Das Zifferblatt, worauf der erste Zeiger läuft ist in 60, das des
zweiten in 10 und das des dritten gleichfalls in 10 Theile getheilt. Eine Umdrehung
des ersten Zeigers zeigt an, daß das Schiff 1 Meile, eine Umdrehung des zweiten
Zeigers, daß das Schiff 10 Meilen, und eine Umdrehung des dritten Zeigers, daß das
Schiff 100 Meilen zurükgelegt hat. Beobachtet man daher die Anzahl der
Eintheilungen, welche der erste Zeiger in der Minute zurüklegt, so findet man die
Geschwindigkeit des Schiffs in Meilen per Stunde.
Fig. 17
stellt die obere Ansicht,
Fig. 18 die
Seitenansicht, und
Fig. 19 die
innere Ansicht des den Contact bewerkstelligenden Apparats dar. An dem Ende der
Achse o befindet sich eine Schraube o¹ welche in das Zahnrad o² greift. Von der Oberfläche dieses Rades steht ein Stift o³ hervor, welcher bei jeder Umdrehung des Rades
einmal mit dem um p¹ drehbaren Hebel p in Berührung kommt und denselben vorwärts drängt. An
dem vorderen Theil dieses Hebels befindet sich eine Platte p², die mit dem runden Ende der Achse q
in Berührung ist, so daß, wenn der Hebel vorwärts bewegt wird, auch die Achse q an dieser Bewegung Theil nimmt. Eine Feder q¹ ist mit einem von der Seite der Achse q hervorspringenden Stift verbunden, wodurch die Achse
q zurükgedrängt wird, wenn der an dem Zahnrad o² befindliche Stift das Ende des Hebels p verläßt. An dem Ende der Achse q befindet sich eine dünne Messingplatte r,
welche abwechselnd mit den an den Enden der Kupferdrähte des Seils A befestigten Scheiben s, s
in Berührung gebracht und von denselben entfernt wird. Dünne Elfenbeinstreifen t, t verhüten, daß die Scheiben mit den messingenen
Seiten des Gestells in Berührung kommen; t¹ ist
ein Elfenbeinblatt, an das beide Leitungsdrähte befestigt sind. Dieser elfenbeinene
Theil ist seitwärts durch Streifen t², t² begränzt und hat nach vorn und hinten einigen
Spielraum, wenn die Messingplatte gegen die Scheiben gedrükt oder von denselben entfernt wird. Die
Messingplatte z, z¹ welche den oberen Theil und
die Seiten des Gestells bildet, steht so hervor, daß sie dem Drehungsbestreben
Einhalt thut, welches dieser Apparat äußern würde, wenn er nicht durch das Wasser,
das durch den von diesen hervorstehenden Kanten gebildeten Canal strömt, daran
gehindert werden sollte. Die Achse o¹ ist mit dem
Rotator durch ein Universalgelenk und das Seil Y
verbunden.
In der Abbildung Fig. 14 ist c der Rotator, c¹ ein kupfernes seine Achse bildendes Luftgefäß.
Die vier flachen Messingflügel c², c² sind unter einem gewissen Winkel an diese
Achse gelöthet. Wird daher der Apparat durch das Wasser gezogen, so ertheilt dieses
demselben vermittelst der schief gestellten Flügel eine rotirende Bewegung. Das
Luftgefäß c¹ hat den Zwek, dem Rotator ungefähr
das Gewicht des durch ihn verdrängten Wassers zu geben. Der Rotator gleicht
hinsichtlich seiner Construction demjenigen, welcher bei Gelegenheit eines früher
mir ertheilten Patentes beschrieben und nun in der königlichen Marine allgemein
eingeführt ist.
Was die Methode betrifft, die Leitungsdrähte an der Seite des Schiffs hinabzuführen,
so wird eine Eisenstange, welche 5–10 Fuß unter die Wasserlinie ragt,
mittelst zweier Schrauben an die Seite des Schiffs befestigt; die eine dieser
Schrauben befindet sich ungefähr 6 Zoll, und die andere ungefähr 3 Fuß über der
Wasserlinie, so daß die Stange nach Belieben befestigt oder losgemacht werden kann.
Die Leitungsdrähte erstreken sich an der Seite des Schiffs hinab, treten dann vorn
an die Eisenstange und werden an dieselbe auf geeignete Weise befestigt. An dem
unteren Ende der Stange befindet sich ein kreisrunder Hals, um den die Drähte ins
Wasser geleitet werden.
Tafeln