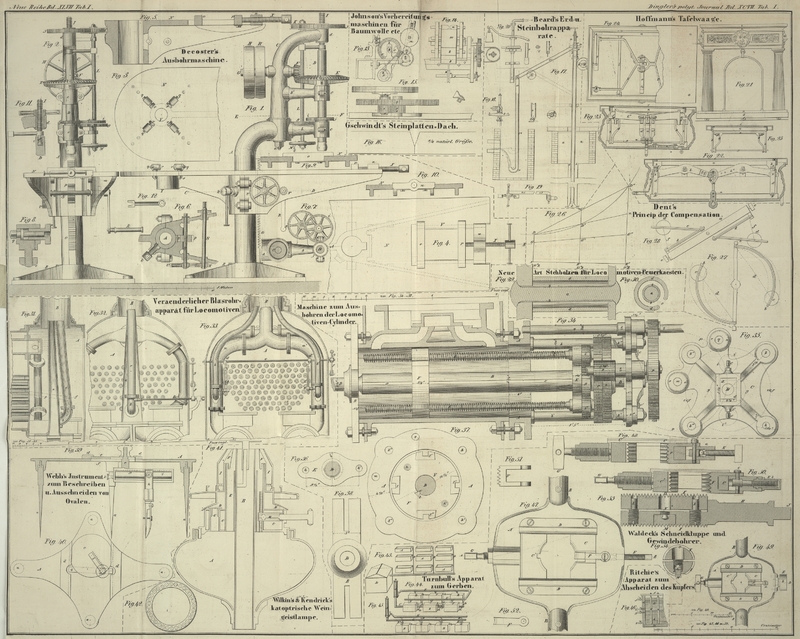| Titel: | Beschreibung der Tafelwaage; von C. Hoffmann, Mechanikus in Leipzig. |
| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. X., S. 19 |
| Download: | XML |
X.
Beschreibung der Tafelwaage; von C. Hoffmann, Mechanikus in
Leipzig.
Aus Poggendorf's Annalen, 1845, Nr. 2, S.
317.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Hoffmann's Tafelwaage.
Bei Anlage der Construction dieser Waage hatte ich mir zur Aufgabe gemacht, nur eine
verlässige und bequeme, so wie besonders ambulante und compendiöse Waage, zum
Gebrauch für Geldwechsler oder auf Ladentafeln der Apotheker, Conditoren u.s.w.
herzustellen, aus welcher Ursache ich auch nach befriedigter Lösung dieser Aufgabe
den Namen „Tafelwaage“ für dieselbe wählte. Bei den ersten
Versuchen ergab diese Waage jedoch hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit ein Resultat,
welches meine Erwartung weit übertraf; denn sie gibt, bei einer sorgfältigen
Ausführung, auf den Einhunderttausendsten Theil von ihrer schwersten Belastung noch
einen merkbaren Ausschlag. Diese Eigenschaft, in Verbindung mit ihren weiterhin erwähnten
Eigenthümlichkeiten, machen sie nicht nur zu gewissen physikalischen Experimenten in
vortheilhafter Weise anwendbar, sondern die Waage erhält dadurch für chemische und
pharmaceutische Laboratorien noch einen ganz besonderen Werth. Verlangt man nicht
eine Vollkommenheit der Gewichtsangabe in dem Grade, wie sie nur zu höheren
wissenschaftlichen Zweken in Anspruch genommen wird, so leistet die gedachte
Tafelwaage, hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit und Verlässigkeit, nicht nur
dasselbe, was von einer guten gleichschenkeligen Waage zu verlangen ist, sondern sie
verbindet damit auch zugleich die Bequemlichkeit einer sogenannten tragbaren
Brükenwaage, besizt aber, außer ihren erwähnten Eigenthümlichkeiten, noch die
wesentlichere, daß ihre Lastschale frei über den Apparat und nur in vertikaler
Richtung schwingt.
Der Wägemechanismus besteht aus zwei neben einander gestellten fünfekförmigen
gleichschenkeligen Waagebalken, deren äußere Endachsen die Lastschale und ihre
innere die Kraftschale tragen. Der für erwähnte Achsen dadurch entstehenden Reibung,
daß die gleichen Achsenpaare der Balken in Kreisbögen von entgegengesezten
Richtungen schwingen, während die Schalen dabei eine senkrechte behaupten, habe ich
in der Art begegnet, daß ich den Pfannen der Schalen zu ihren senkrechten auch eine
seitliche Schwingung verschafft habe. Leztere kann besonders für die Lastschale nur
in eigenthümlicher Weise bewerkstelligt werden, da diese über der horizontalen
Achsenebene schwebt; es ist das Nähere darüber in der weiterhin folgenden Erklärung
der Abbildungen zu ersehen. Da ferner beim Gleichgewichtszustand der Waage nur ein
senkrechter Druk von den Pfannen der Schalen auf die Achsen stattfinden soll, so
dürfen die Achsen der beiden Balken zum Tragen der Kraftschale weder hinter noch
neben einander gestellt seyn. Man hat sich vielmehr die Mitte beider Achsen als zwei
Punkte zu denken, von welchen einer in den andern zu bringen ist. Um diesen Zwek zu
erreichen, habe ich der Achse des einen Balkens zwei Schneiden, und der des andern
nur eine Schneide gegeben, welche leztere ich zwischen die ersteren treten lasse,
was sich auch aus der nachfolgenden Erklärung der Abbildungen näher ergibt.
Fig. 21 ist
eine Vorderansicht der Waage, im vierten Theil der natürlichen Größe zu 6 Pfund
schwerster Belastung abgebildet. Das Aeußere besteht, außer den Waagschalen, ganz
aus Gußeisen; a ist der Behälter für die Waagbalken
u.s.w.; b die aus schwachem Messingblech gearbeitete
plane Lastschale, welche mit einem nach unten gerichteten Rand versehen ist. Die
punktirten Linien bei c deuten die an einem Doppelbügel hängende
Kraftschale an, welche in einem Kreisausschnitt des Fußgestells d schwingt. Diese Schale dient zugleich als Senkblei, um
den Apparat in waagrechten Stand sezen zu können, welches bewerkstelligt wird, wenn
durch die beiden vorn angebrachten verstellbaren Füße e,
e und den hinteren feststehenden f die Schale
in dem durch die punktirten Linien angegebenen Kreisausschnitt des Fußgestells
gleich abstehend gemacht wird. Die Füße e, e erhalten
ihre Stellung durch hinter den Säulen angebrachte Kopfschrauben.
Fig. 22 gibt
einen Längendurchschnitt des Behälters für die Waagbalken u.s.w. Fig. 23 einen Querschnitt
desselben Behälters; Fig. 25 denjenigen Theil
aus Fig. 23,
welcher die vierfüßige Lastschale mit ihren beweglichen Pfannen darstellt, und Fig. 24 eine
theilweis geöffnete obere Ansicht des Behälters; – a, Fig.
22 bis 25, ein mit vier Füßen b, b versehener
eiserner Rahmen, auf welchem die Lastschale c ruht; d, d die mit den Stegen e, e
in Verbindung stehenden, nach oben schwingenden Arme, welche nach außen die vier zur
Lastschale gehörigen Pfannen f, f tragen; g, g zwei stählerne Wellen, um welche sich die Arme d, d bewegen; h, h°,
Fig. 22,
23, 24, die zwei
gleichschenkeligen fünfekförmigen Waagebalken; i, i
deren Mittelachsen; k, k deren äußere Endachsen, und I, Fig. 22, und I° l, l°, Fig. 22, 23, deren
innere Endachsen; m, Fig. 22, 23, 24, ein stählerner
bügelförmiger Arm, welcher oben die Pfanne für die Achse I enthält; m°, m° zwei durch einen Steg verbundene ähnliche Arme, welche die
Pfannen für die Achsen l°, l° enthalten. Diese drei Arme stehen unten durch einen in ihnen
sehr leicht beweglichen stählernen Stift n mit der Oehse
o für die Kraftschale in Verbindung. Befinden sich
nun die Waagbalten in völligem Gleichgewichtszustand, so fallen ihre drei inneren
Schneiden in eine gerade Linie, und drüken dann die Pfannen der Kraftschale
senkrecht auf dieselben; ferner fallen auch die an beiden Balken gedachten
Aufhängepunkt für die Kraftschale zusammen, weil die dazu gehörigen Achsen weder
neben noch hinter einander gestellt sind, sondern die Achse l ihren Plaz zwischen l°, l° einnimmt. Die kleine Abweichung von der
geraden Linie, welche vorerwähnte Achsen beim Schwingen der Ballen machen, ist so
unbedeutend, daß der Druk von den auf ihnen ruhenden Pfannen doch noch als ein
senkrechter zu betrachten ist, da leztere oben auf den Armen m° m, m° sizen, welchen ein
verhältnißmäßig tiefer Drehpunkt gegeben ist. Dasselbe gilt auch für die Pfanne der
Lastschale, welches an Fig. 25 deutlich zu
erkennen ist. An einem der Stege e, e, Fig. 22 und 24, ist bei
p der Zeiger oder die Zunge der Waage angebracht,
und q ist die Gegenzunge; r,
Fig. 23
und 24, ist
ein zur Hemmung der Waage dienender Riegel.
Soll die Waage mit Anwendung einer Hohlschale gebraucht werden, so gebe ich eine mit
einem Fuß versehene dergleichen Schale nebst einem Gegengewicht mit bei.
Tafeln