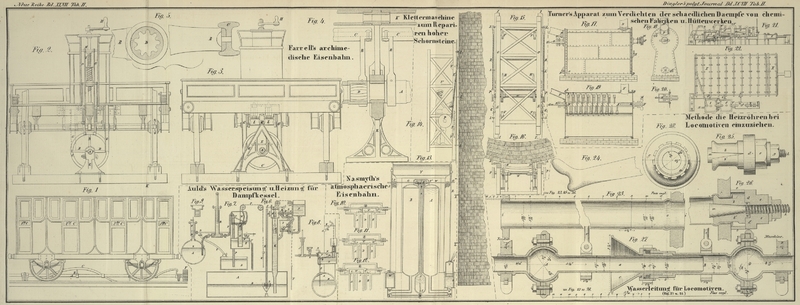| Titel: | Methode, wie bei den Locomotiven der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn die Heizröhren eingezogen werden. |
| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. XXVI., S. 95 |
| Download: | XML |
XXVI.
Methode, wie bei den Locomotiven der
Kaiser-Ferdinands-Nordbahn die Heizroͤhren eingezogen
werden.
(Aus dem Organ fuͤr die Fortschritte des
Eisenbahnwesens, 1845 2tes Heft.)
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Methode bei den Locomotiven die Heizröhren einzusezen.
Die 11 1/2 Fuß langen Röhren von 1 28/32'' Durchmesser bestehen nicht auf ihrer
ganzen Länge aus Messing, sondern das in die Feuerkammerwand eintretende Ende ist
auf eine Länge von 5 1/4'' aus 1/8'' starkem Kupferblech gebildet; die Wandstärke
des messingenen Theils beträgt nur 3/32'' Beide Theile sind so mit einander
verbunden, daß der messingene 1 1/4'' lang ausgeschärfte Theil in den ebenfalls so
lang scharf auslaufenden kupfernen Theil eintritt und die Verbindungsstelle gut
verlöthet ist. Fig.
23 erläutert dieses.
Nachdem das Rohr auf die erforderliche Länge von 11 Fuß 3 1/4 Zoll genau und gerade
abgeschnitten und in die Rohrwände eingestekt ist, werden beiderseits und besonders
an dem kupfernen in die Feuerkammerwand eintretenden Theil die Ränder mit Hülfe eine
Hammers umgebogen und nach und nach 12–18 conische Dorne von verschiedenen
Dimensionen hineingetrieben, damit sie sich rings der ganzen Peripherie der Löcher
gut anlegen. Hierauf rundet man die Ränder bei i, i',
Fig. 23,
durch den in Fig.
24 abgebildeten Sezmeißel ab und treibt darnach nochmals einen conischen
Dorn ein, um das Anlegen in den Löchern vollkommen herzustellen.
Nach dieser Operation läßt man den in Fig. 25 in Ansicht und
in Fig. 26 im Durchschnitt
abgebildeten Apparat in das Rohr von der Seite der Feuerkammer eintreten, um die
Vertiefung bei o, Fig. 23 dicht an der
Feuerkammerwand herauszubringen resp. einzudrüken. Bei
diesem Apparat endigt der Conus m in die Schraube h, um diesen Conus legt sich das Stük b, b' in zwei Theilen; an einem Ende trägt b, b' einen Rand oder Wulst, der dazu dient die
Vertiefung bei o im Rohr herzustellen. Der andere Theil
von b, b' ist durchaus cylindrisch, ausgenommen an der
Stelle a, wo er sechskantig und gehärtet ist. Der Theil
i tritt in das Stük d,
welches hier eine entsprechende sechsekige Oeffnung hat, so wie auch bei e äußerlich sechskantig ist, wo es von einem großen
Schlüssel umfaßt wird.
Wenn man daher vermittelst dieses Schlüssels den Theil e resp.
d herumdreht, so dreht man den Theil b, b'
folglich mit, und indem man immer diese beiden Theile dreht, zieht man gleichzeitig
auch nach und nach die Mutter g an, welche die Schraube
h, die auf eine Verlängerung des Conus m geschnitten ist, vorwärts gehen läßt; dadurch geben
sich die mit dem Wulst versehenen Theile b, b' immer
mehr auseinander und bilden nach und nach die Vertiefung bei o aus.
Der Ring c dient dazu, den Apparat oder vielmehr den
Wulst des Theils b, b' in der gehörigen Entfernung von
der innern Wand der Feuerkammer zu halten, damit die zu bildende Vertiefung an den
innern Rand des Lochs vollkommen sich anlege.
Diese zwar etwas umständliche Art und Weise des Einziehens der Röhren hat den
Vortheil, daß man die sonst gewöhnlichen Rohrringe, welche die Rohrmündungen immer
verengen, das Festsezen von Kohksstükchen veranlassen und ein häufiges Auswischen
oder Reinigen der Röhren nöthig machen, gar nicht bedarf. Die Vertiefung oder der
Wulst bei o hat außer dem vollkommenen Schluß in der
Rohrwand noch den Zwek, die ungleiche Ausdehnung der Röhren und übrigen Kesseltheile
unschädlich zu machen; es ist aber auch nicht zu verkennen, daß dieser Wulst, wenn
mit der Zeit ein Auswechseln der Röhren nöthig wird, das Herausnehmen sehr
erschwert. Es mußte dieses in die Feuerkammer eintretende Ende von Kupfer gefertigt
werden, weil Messingblech das Auftreiben und Spannen ohne Gefahr der Beschädigung
nicht zugelassen haben würde.
Mainkur bei Frankfurt a. M. im März 1845.
Constantin Gleim, Techniker.
Anmerkung und Berichtigung.
Bei der in diesem Bande des polytechnischen Journals S. 5 mitgetheilten neuen Art
Stehbolzen zur Verankerung der geraden Feuerkammerwände an den Locomotiven ist ein
Irrthum eingeschlichen, den ich mir hier zu berichtigen erlaube.
Der eiserne Nietbolzen a wird nicht, wie dort angegeben,
zuerst mit dem kupfernen Röhrchen b umgeben, sondern
lezteres erst durch die beiden entsprechenden Löcher der Feuerkammerwände gestekt,
von beiden Seiten durch einen Dorn aufgetrieben und mit einem Hammer die Ränder
umgelegt, darauf erst der Nietbolzen a eingetrieben und
gehörig vernietet und verstemmt. – Die Umhüllung des eisernen Nietbolzens mit
Kupfer hat außer dem leichtern und bessern Dichten hauptsächlich auch noch den Zwek,
das Rosten dieses Bolzens zu verhüten.
Der Obige.
Tafeln