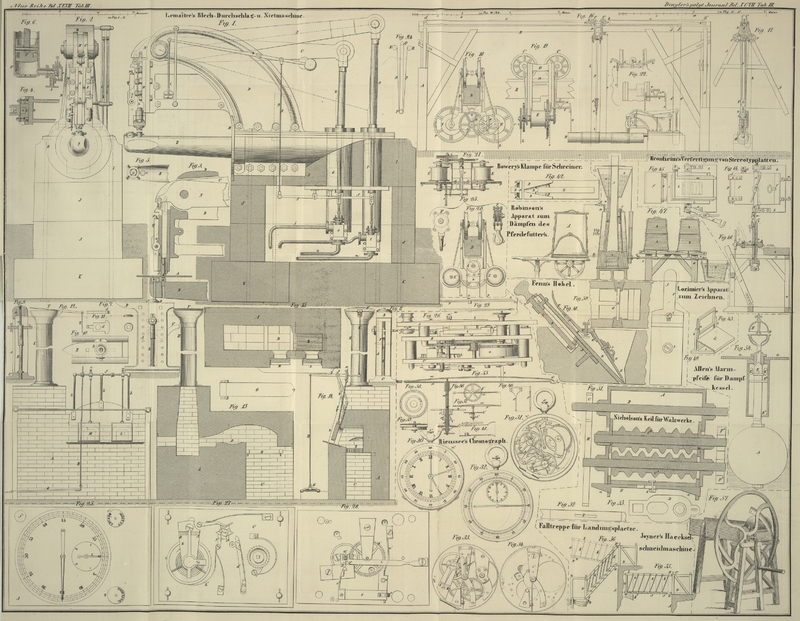| Titel: | Verbesserungen in der Anfertigung von Stereotypplatten, worauf sich Joseph Martin Kronheim, Kupferstecher zu London, einer Mittheilung zufolge, am 29. Jul. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. XLIX., S. 177 |
| Download: | XML |
XLIX.
Verbesserungen in der Anfertigung von
Stereotypplatten, worauf sich Joseph Martin Kronheim, Kupferstecher zu London, einer Mittheilung zufolge, am 29. Jul. 1844 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts, April 1845, S.
161.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Kronheim's Verfertigung von Stereotypplatten.
Die Verbesserungen bestehen
1) in einer verbesserten Methode, aus Lettern oder andern erhabenen Drukflächen
Matrizen oder Formen herzustellen, in welchen die Stereotypplatten gegossen
werden;
2) in einem Apparat, um die erwähnten Matrizen zu halten und die Stereotypplatten zu
gießen. Das Verfahren hiebei ist nachstehendes. Nachdem die aus zusammengefügten
Lettern bestehende Leite oder Form auf die gewöhnliche Weise zubereitet und fest
zusammengefaßt worden ist, wird dieselbe, die Rükseite abwärts gekehrt, auf einen
flachen Tisch gelegt, um mittelst einer plastischen Composition im
Contre-Relief einen Abdruk von derselben zu nehmen. Diese plastische
Komposition besteht aus folgenden Ingredienzien, die in dem bezeichneten Verhältniß
mit einander vermengt werden. Ungefähr 6 1/2 Pfd. feines Weizenmehl werden mit
ungefähr 9 1/2 Pfd. Stärke vermengt; diese Masse wird mit ungefähr 5 Pfd. Wasser und
1/4 Unze Alaun wohl unter einander gearbeitet und auf gewöhnliche Weise zu Brei
gekocht. Ist dieser Brei kalt geworden, so kommen zu je 4 1/2 Pfd. desselben 4 Pfd.
fein pulverisirte und fein geschlämmte Kreide; das Ganze läßt man endlich durch ein
feines Sieb oder zwischen einem Walzenpaar hindurchgehen.
Mit dieser Composition als Brei werden drei oder mehrere Blätter Seidenpapier an ein
Blatt starkes Löschpapier befestigt, wodurch man eine Lage von Materialien, die man
eine „Flanke“ (a flanc) nennt,
erhält. Diese Flanke wird in einer Presse auf dieselbe Weise wie Pappdekel gepreßt;
nach 3 bis 4 Tagen ist dieselbe ziemlich troken und für den Gebrauch fertig. Die auf
oben erwähnte Weise auf einen flachen Tisch gelegte Letternform muß nun in einen
Rahmen geschlossen und die Letternfläche sorgfältig gereinigt werden, Auf diese
Fläche nun wird die Flanke in feuchtem Zustand glatt aufgelegt, und mittelst einer
Bürste sanft aufgedrükt, um das plastische Material der Flanke in die Vertiefungen
in und zwischen den Lettern einzudrüken. In dieser Lage bleibt die Flanke und wird
durch flache Gewichte oder Metallplatten überall gleichförmig angedrükt; die
lezteren sind mit vielen
kleinen Löchern durchbohrt, damit die Feuchtigkeit der Flanke leichter verdunsten
kann. Wenn nun die Flanke vollkommen troken ist, so ist sie eine harte Matrize
geworden, an ihrer Rükseite flach, an ihrer Borderfläche aber nach der Gestalt der
Lettern im Contre-Relief vertieft. In diesem Zustand wird die Flanke als
Matrize benüzt, in welche das Letternmetall zur Herstellung einer Stereotypenplatte
gegossen werden kann. Um mit Hülfe dieser Matrize Stereotypplatten zu gießen, wird
dieselbe in einem Apparat befestigt, welcher aus einem geeigneten Gestell besteht,
worauf die Form mit ihrem Zugehör befestigt ist. Fig. 44 stellt den
Apparat im Grundriß, Fig. 45 im Grundriß bei
geöffneter Form und Fig. 46 im mittleren verticalen Durchschnitt dar. Die leztere Figur zeigt
die Form in geschlossenem gußfertigem Zustand.
Das hölzerne Gestell a, a, a trägt eine starke Bank b, woran eiserne Träger c, c
befestigt sind. Leztere dienen zur Aufnahme der Zapfen d,
d, um die sich die Formbüchse e, f mit ihrem
Leitrahmen und Zugehör dreht. Die Formbüchse besteht aus zwei flachen Platten, die
mit einem verschiebbaren Scharnier g verbunden sind;
dieses tritt durch lange in den Scharnierträgern h, h
und i, i befindliche Schlize; die Scharnierträger aber
sind an die unteren Theile der Platten e, f befestigt.
Wenn die Formbüchse, wie in Fig. 45, offen ist, so
fällt die Platte f, wie die Punktirungen in Fig. 46
andeuten, auf ihr Scharnier zurük.
Soll nun eine Stereotypplatte gegossen werden, so muß man zuerst die Formbüchse
erwärmen, damit das flüssige Metall während des Gießens nicht plözlich erstarre. Zu
dem Ende wird zwischen die Platten e und f eine heiße Metallplatte eingefügt; die Schlize in den
Trägern h, h und i, i
gestatten nämlich, die Formbüchse für diesen Zwek weit genug zu öffnen. Auch die
Compositionsmatrize sollte erwärmt werden. Die erwärmte Formbüchse bringt man in
eine horizontale Lage und zieht, wie Fig. 45 zeigt, ihre obere
Platte l zurük. In dieser Lage stüzt man die Formbüchse
durch einen Hebel j. Die Compositionsmatrize k, k legt man auf die flache Platte e, und um das Anhängen des Gusses an die Matrize zu
verhüten, bestäubt man ihre Oberfläche und Zwischenräume überall mit Talkpulver,
welches nachher sorgfältig abgewischt werden muß. Hierauf legt man auf die
Vorderfläche der Matrize winkelig umgebogene ungefähr 1/8 Zoll dike Metallstreifen
l und m, um die Dike der
Stereotypplatte zu bestimmen. Der Streifen m läßt sich
in der Hülse n verschieben, um die Breite des Gusses zu
adjustiren.
Nachdem auf diese Weise die Matrize auf die horizontale Platte e und die Streifen l und m an den Rand der Matrize gelegt worden sind, so muß die Platte f, welche man vorher mit Papier überzogen hat,
niedergeklappt werden um die Matrize einzuschließen; die zwischen den Platten e und f fest liegenden
Streifen l und m bilden nun
in Verbindung mit den lezteren die Formbüchse. Der um q
drehbare horizontale Hebel p wird sodann über die
Formbüchse gebracht und sein gabelförmiges Ende wie Fig. 44 zeigt, in Kerben
an der andern Seite des Gestells eingelegt. Wenn die durch den Hebel p gehende Schraube s auf die
Rükseite der Platte f niedergedreht wird, so werden
dadurch die Platten f und e
fest an einander gedrükt. Um nun die Form in eine verticale Lage zu bringen, muß der
Hebel j zurükgezogen, und die Formbüchse e, f mit ihrem Leitrahmen r
und Zugehör um ihre Zapfen d, d in die Fig. 46 dargestellte Lage
gedreht werden. Jezt stekt man nur noch zwei kleine Keile seitwärts in die enge
Oeffnung der Form, woraus diese zur Aufnahme des flüssigen Letternmetalls bereit
ist.
Das auf die gewöhnliche Weise geschmolzene Letternmetall wird oben in die Form
gegossen und füllt sofort alle Vertiefungen der Compositionsmatrize aus, während die
Rükseite des Gusses durch die Oberfläche der Platte f
glatt ausfällt. Da die leztere mit einem Blatt Papier überzogen ist, so kann während
des Gusses die Luft aus der Form entweichen.
Ist die Stereotypplatte erkaltet, so kann sie aus der Form herausgenommen werden,
indem man, wie Fig.
46 zeigt, die Platte f zurükschlägt, die
Metallstreifen l und m
abnimmt und die Matrize k herauszieht. Nachdem
schließlich die Ränder des Gusses gerade geschnitten worden sind, erscheint derselbe
als eine vollkommene Stereotypplatte.
Tafeln