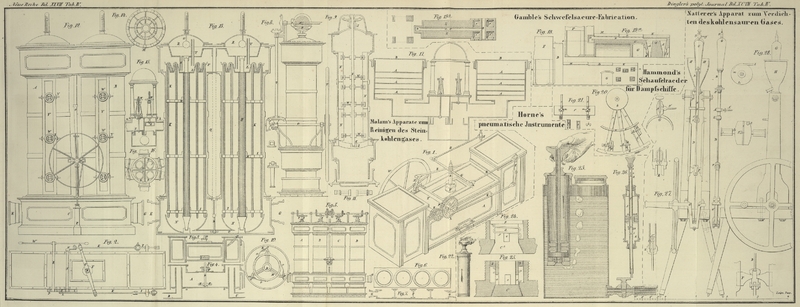| Titel: | James Malam's patentirte Verbesserungen in der Reinigung des Steinkohlengases. |
| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. LXVIII., S. 262 |
| Download: | XML |
LXVIII.
James Malam's patentirte Verbesserungen in der
Reinigung des Steinkohlengases.
Aus dem Mechanics' Magazine 1845, No. 1133, 1134, 1135 u.
1136.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Malam's Verbesserungen in der Reinigung des
Steinkohlengases.
Hrn. Malam's Patent umfaßt vier
Verbesserungen in der Steinkohlengas-Bereitung, welche, obwohl sie alle sich
auf dessen Reinigung beziehen, sich doch wesentlich von einander unterscheiden und
nicht überall gleich anwendbar sind. Die erste dieser Verbesserungen besteht in
einem vortrefflichen Verfahren, das Steinkohlengas vom Schwefelwasserstoff zu
befreien, welchen es beinahe stets enthält.
Bisher bediente man sich zu diesem Zwek gewöhnlich des Kalkhydrats, entweder in
nassem oder trokenem Zustande; da aber der Kalk zugleich mit dem Schwefelwasserstoff
eine gewisse Menge Kohlensäure absorbirt, welche ebenfalls im Gas vorhanden ist, und
seine Fähigkeit, den Schwefelwasserstoff aufzunehmen, in demselben Grade verliert,
als er Kohlensäure absorbirt, so tritt gewöhnlich der Fall ein, daß ein
Kalkreiniger, nachdem er lange Zeit im Gebrauche war, auch nicht mehr die geringste
Menge Schwefelwasserstoff absorbirt. Nun besteht Hrn. Malam's Verbesserung darin, das Gas durch eine
Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxydul (grünem Vitriol) zu leiten, ehe es in den
Kalkreiniger übergeht. Der Eisenvitriol verbindet sich mit dem
schwefelwasserstoffsauren Ammoniak, mit welchem der wenige freie Schwefelwasserstoff
stets gemischt ist, erzeugt schwefelsaures Ammoniak und Schwefeleisen und läßt dem
Kalk nicht viel mehr zu thun übrig, als die Kohlensäure zu absorbiren. Folgenden
Apparat wendet Malam hiezu an.
„Ich bringe zwischen den sogenannten Waschapparat und den
Kalkreinigungsapparaten eine Vorrichtung an, die zum Unterschied „der
Eisenvitriol-Reinigungsapparat“ genannt werden kann. Fig. 1 ist
eine perspectivische Ansicht dieser Vorrichtung; Fig. 2 die Ansicht
derselben von Oben; Fig. 3 eine
Vorderansicht und Fig. 4 der
Höhendurchschnitt durch den Hauptheil des Apparats. A ist ein Kasten, welcher den grünen Vitriol enthält, der in mehr oder
weniger Wasser aufgelöst wird, je nachdem das Gas mehr oder weniger
schwefelwasserstoffsaures Ammoniak enthält. Im Durchschnitt kann als richtiges
Verhältniß angenommen werden 1 1/2 Theile grünen Vitriols und 1 Theil Wasser.
Nachdem der Kasten beinahe ganz mit dieser Lösung angefüllt ist, läßt man das
Gas auf seinem Wege zu den Kalkreinigern durch denselben streichen, nämlich
durch die Röhre B ein- und durch die
entgegengesezte Röhre C wieder austreten. D ist die Achse einer Rührvorrichtung, durch welche
die Vitriollösung in beständiger Bewegung erhalten wird, so daß sie dem
Hindurchstreichenden Gas eine stets wechselnde Oberfläche darbietet. E, E sind die Arme des Rührers und F ist eine Stopfbüchse im Dekel des Behälters, durch
welche die Achse oder Welle D geht. Die
Rührvorrichtung wird in Bewegung gesezt durch die aus Fig. 1 und 2
ersichtlichen Vorrichtungen. G ist ein Querhebel,
welcher oben an der Achse D gut befestigt ist; H, H sind zwei Seitenstangen, die mit einem Ende mit
den Enden des Hebels G, mit dem andern aber mit den
obern Enden zweier kleinen Treibwellen I, I in
Verbindung stehen, welche leztere sich auf Achsen bewegen, die in dem Gestell
der Kammer A, befestigt sind. K, K sind zwei Stangen, welche die untern Enden der beiden abwechselnd
wirkenden Treibwellen I, I mit zwei Kurbeln L und M verbinden, die
an den Enden einer Welle N angebracht sind, welche
ihre Lager auf dem Dekel des Behälters A hat; O ist ein gezahntes Rad, welches an einem Ende der
Welle N aufgestekt ist; in dasselbe greift ein
Getriebe P, welches an dem Ende einer andern Welle
R befestigt ist, die ebenfalls auf dem Dekel des
Behälters A angebracht ist und an ihrem
entgegengesezten Ende das Schwungrad W trägt. Wird
nun der Welle R durch irgend einen Motor eine
rotirende Bewegung mitgetheilt, so veranlaßt diese die Umdrehung der Kurbeln L und M, und diese
theilen dann durch Vermittelung der Theile K, I, H
und G der Achse und den Armen D und E des Rührers eine halbkreisförmige
oder abwechselnde Bewegung mit.“
Das Steinkohlengas führt stets eine große Menge Wasserdampf aus den Retorten mit
sich, welcher später sicherlich noch bedeutend vermehrt wird, entweder durch die
Reinigung mit Kalk (wenn diese mit nassem Kalk stattfindet) oder durch das Wasser im
Gasometer. Je mehr solcher Wasserdampf im Gas ist, desto geringer ist seine
Leuchtkraft und desto rauchender (qualmender) die Flamme bei seinem Verbrennen. Um
so größer aber auch ist die Gefahr, daß die Röhren durch das sich verdichtende und
gefrierende Wasser verstopft werden.
Hrn. Malam's zweite
Verbesserung besteht in der Befreiung des Gases vom Wasserdampf; sein Verfahren
dabei beschreibt er wie folgt:
„Ich lasse das aus dem Gasometer kommende Gas durch eine Reche
verdichtender oder niederschlagender Gefäße
„Gefrier-Cylinder“ genannt, streichen, deren
Construction aus den Abbildungen zu ersehen ist. Fig. 5 ist eine
Vorderansicht einer Reihe dieser Cylinder; Fig. 6 der Grundriß
derselben; Fig.
7 ein senkrechter Durchschnitt der Basis dieser Cylinder; Fig. 8 ein
Aufriß von der Hinterseite; Fig. 9 ein anderer
senkrechter Durchschnitt, welcher mehr von der innern Einrichtung zeigt, und
Fig.
10 ein Querdurchschnitt. A, B, C, D sind
die Gefrier-Cylinder. Das Gas wird aus dem Gasometer durch die Röhre E am Boden des ersten Cylinders A eingelassen; aus A
geht es oben in B über, welchen herunterkommend es
durch die Oeffnung F (siehe Fig. 7) in C hinaufsteigt und in D
übergeht, von wo es in die Hauptröhrenleitung G
gelangt. Die innere Beschaffenheit der Cylinder, bei allen vieren gleich, ist
aus den Figuren
8, 9 und 10 ersichtlich. H ist eine senkrechte Welle, die unten in einer
Büchse K in der Brüke L
läuftlauft und oben durch eine Stopfbüchse I aus dem
Cylinder tritt. M, M, M ist eine Anzahl leichter
Räder, welche an die senkrechte Welle H festgekeilt
sind; eines derselben ist im Durchschnitt zu sehen in Fig. 11. N, N, N sind Scharrer (Schaber), welche mit
Vorsprängen auf der Peripherie der Räder M, M
verbunden sind und durch die Federn O, O in
Thätigkeit gesezt werden, welche sie an die innere Oberfläche des Cylinders
andrüken und zwar in folgender Absicht. Wenn das Gas aus dem Gasometer in diese
Cylinder übergeht und mit ihren kalten Metallflächen in Berührung kömmt, so wird
der darin enthaltene Wasserdunst an den Seiten derselben in reifähnlichen
Eistheilchen niedergeschlagen. Um diese Wirkung desto sicherer zu erreichen,
werden die Cylinder in mehr als zweimal so großen Dimensionen verfertigt, als
das Einlassungsrohr E, wodurch nothwendig dem
Vorwärtsdringen des Gases Einhalt gethan wird, so daß wenig oder gar kein Gas
entweicht, ohne mit den Seiten der Cylinder in Berührung zu kommen. Das sich an
den Seiten anhäufende Eis muß natürlich von Zeit zu Zeit weggeschafft werden,
was der Zwek obenerwähnter Scharrer N, N, N ist.
Denselben wird nöthigenfalls mittelst des aus den Abbildungen ersichtlichen
Räderwerks eine rotirende Bewegung ertheilt. P, P, P,
P sind an den senkrechten Wellen H, H, H, H
befestigte Winkelräder; R, R, R, R sind Getriebe auf
der liegenden Welle S, welche die Winkelräder P in Bewegung sezen; T
und U sind Wellen, welche die Getriebe R treiben und V ist ein
Schwungrad, welches die Welle U in Bewegung sezt und
seine erste Bewegung von irgend einem Hauptmotor erhält. Das von den
Seitenwänden aller Cylinder abgescharrte Eis fällt zu Boden, von wo es durch
eine Fallklappe entfernt wird.“
Die dritte von Hrn. Malam
gemachte Verbesserung besteht im Austroknen des Gases, nachdem es den verschiedenen
oben beschriebenen Reinigungsprocessen unterworfen wurde.
„Zu diesem Behufe, sagt der Patentträger, lasse ich das aus den
Gefrier-Cylindern kommende Gas durch eine andere Reihe von Cylindern
streichen, wo es der absorbirenden Einwirkung des Alkohols (oder sonst einer
stark geistigen Flüssigkeit) ausgesezt wird. Es sind dieß die Spiritus.
Cylinder. Fig.
12 ist die Vorderansicht dieser Cylinder und Fig. 13 ein
senkrechter Durchschnitt durch die Mitte des Apparats. A und B sind die Cylinder, die in einem
hohlen Fuß C eingesezt sind, der durch die
Scheidewand D in zwei Abtheilungen getheilt wird.
H, H sind zwei stehende Achsen, die im Boden des
Fußgestells C befestigt sind und drei Leitringe I, I, I tragen, welche sich in gleichen Entfernungen
von einander befinden. Den Querschnitt eines solchen Ringes zeigt Fig. 14.
L, L sind zwei offene Spiritus-Behälter,
die oben auf den Achsen H, H angebracht sind und aus
zwei concentrischen Kammern bestehen, wovon die äußere viel kleiner ist als die
innere. K, K, K, K sind Bündel von Baumwollgarn, wie
man sich ihrer zu Lampendochten bedient; sie werden durch Ringe gezogen, welche
am Boden des kleinern Spiritus-Behälters L, L
befestigt sind, bis beide Enden in gleicher Entfernung von den Ringen
zusammentreffen; die Enden werden sodann über die Ränder des
Spiritus-Behälters hinübergewendet, und durch die Löcher M, M in den Leitringen I, I,
I gezogen, so daß sie zulezt etwas über den untersten Ring
hinausreichen. N, N sind zwei kreisrunde Schalen,
welche die Füße der Achsen H, H umgeben und durch
die horizontale Röhre O mit einander communiciren.
P ist eine Drukpumpe, deren
Einlassungs-Ventil sich in die Röhre O
öffnet. Q ist eine Röhre, die von der Drukpumpe bis
auf das obere Ende der Cylinder führt, wo sie durch Seitenarme mit zwei
geschlossenen Spiritus-Behältern R, R in
Verbindung steht, welche mit dem übrigen Apparat weiter in keiner Weise
communiciren, als durch die Verbindungsröhren S, S
und die Luftröhren T, T. Ist nun der Apparat so
vorgerichtet, so denken wir uns die Spiritus-Behälter L, L mit Alkohol etwas über das untere Ende der
Luftröhren T, T hinauf angefüllt, so wie auch die
Reservoirs R, R zum Theil mit solchem gefüllt. Der
Alkohol wird durch die Capillar-Anziehung der Baumwollfäden K, K in die Höhe gezogen, aus den Behältern L, L, fortgeleitet und zieht jene Theile dieser
Fäden hinab, welche in den Cylindern hangen, erhält sie beständig feucht und
bietet so große Alkohol-Oberflächen dar, welche starke Verwandtschaft zu
allen Wasserdämpfen besizen, womit sie in Berührung kommen. Der von den
Baumwollfäden abtropfende Alkohol wird in den Schalen N, N
aufgefangen und, wenn er sich in hin. länglicher Menge angesammelt hat, mittelst
der Drukpumpe P in die geschlossenen Reservoirs R, R hinaufgepumpt, von wo er in den Röhren S, S hinunterfließt, bis die Behälter L, L wieder bis zum untern Ende der Luftröhren T, T angefüllt sind. So oft der Alkohol im Gefäß L, L unter den Spiegel der Luftröhren T, T sinkt, strömt Luft hinauf in die Reservoirs R, R und drükt so viel Spiritus hinunter als nöthig
ist, damit die Oberfläche der Flüssigkeit in L, L
wieder über die untern Enden der Luftröhren T, T
hinaufreicht. U, U sind Schwimmventile (Schwimmer),
deren Spindeln in Glasröhren hineinreichen, durch welche die Höhe des Alkohols
in den geschlossenen Reservoirs R, R, folglich auch
in den offenen Gefäßen jederzeit ersichtlich ist. Das der Einwirkung des
Alkohols zu unterwerfende Gas wird zuerst durch das Rohr E in den Cylinder A eingelassen, steigt
diesen hinauf, begibt sich durch den Canal F in den
Cylinder B, strömt diesen hinab und entweicht durch
das Rohr G in die Leitung. Indem es diesen Umlauf
macht, wird jeder etwa noch darin suspendirte Wasserdampf beinahe mit Gewißheit
von dem Alkohol absorbirt, womit er in Berührung kömmt; sollte ein Antheil
Alkohol selbst verdunsten und mit dem Gas austreten, so kann dieß nur zur
Vergrößerung der Leuchtkraft desselben beitragen. V,
V sind Thüren, durch welche man die Cylinder öffnet, um die Fäden von
Zeit zu Zeit in Ordnung zu bringen oder zu erneuern; diese Thüren werden
mittelst Klemmschrauben W, W befestigt.“
Wir kommen nun zur lezten der Malam'schen Verbesserungen;
so wichtig und werthvoll sie durchgängig sind, möchten wir doch glauben, daß die
jezt zu beschreibende schneller als irgend eine der übrigen in der Praxis Eingang
finden wird. Jede Anstalt muß ihren Kalkreinigungs-Apparat haben und wird
sonach die Verbesserungen an demselben nicht lange unberüksichtigt lassen. Sie
bestehen im Wesentlichen darin, daß der große Raum, welchen die Kalkreiniger
gewöhnlich einnehmen, sehr vermindert wird – daß die Röhren weniger Biegungen
haben als sonst – daß die Ventile bei weitem nicht so kostspielig sind
– und endlich daß dieser Theil der Reinigung nichtsdestoweniger schneller und
wohlfeiler bewerkstelligt wird. Fig. 15 ist ein
senkrechter Durchschnitt, woraus man die Construction der Klappen und die
Vorkehrungen, wodurch sie geöffnet und geschlossen werden, ersieht. Fig. 16 ist ein
Querschnitt von Fig. 15 nach der Linie ab.
A ist das von den bekannten Waschapparaten herführende
Rohr, welches in die untere Abtheilung B des
Klappenkastens mündet. Die obere Abtheilung C des
Klappenkastens zerfällt in vier Unterabtheilungen
D, D, D, D. In jeder dieser leztern befindet sich eine
Klappe E, von der eigenthümlichen aus Fig. 15 ersichtlichen
Construction; sie ist darin sowohl geschlossen als geöffnet zu sehen. Die Klappe hat
eine cylindrische Form; um sie zu heben und zu senken, so daß sie in jeder
beliebigen Stellung festgehalten werden kann, dient ein Handrad W, welches wie eine Schraubenmutter oben an der Spindel
der Klappe befestigt ist, an welcher eine Schraube zu dessen Aufnahme ausgeschnitten
ist. G ist eine luftdichte Stopfbüchse, durch welche die
Klappenspindel hinaufgeht. I ist eine Kehle oder ein
Kranz, der die Oeffnungen umgibt, welche die Communicationen zwischen den unteren
und oberen Abtheilungen des Klappenkastens bilden; derselbe muß in der Höhe einer
Wassersäule gleich seyn, welche dem Druke, unter dem das Gas aus den
Waschvorrichtungen kommt, das Gleichgewicht hält. Dieser Canal wird mit Wasser
angefüllt, in welches die Klappen beim Niedergehen tauchen, so daß eine hydraulische
Absperrung gebildet wird, welche jeden Uebergang von Gas aus einer Abtheilung in die
andere verhindert. Fig. 17 ist ein senkrechter Durchschnitt einer Reihe von
Reinigungsapparaten, welche mit diesen Klappen-Kästen versehen sind. A, A, A sind die Kalksiebe, deren in jeder Abtheilung
fünf sind. B, B sind die Dekel, welche mit Wasser
luftdicht abgesperrt sind. Damit man diese Dekel leicht abheben kann, wenn man zu
den Reinigern gelangen will, um den Kalk zu erneuern, ist ein Querbalken auf Säulen
gelegt, welche auf dem Reinigungsapparat stehen, an welchem Querbalken ein Laufblok
hin und her geschoben werden kann, von dessen unterm Ende eine Schraubwinde
herabgeht, mittelst welcher, wenn sie über einen der Kalkreiniger gebracht wird, der
Dekel gefaßt und in die Höhe gehoben werden kann. An der Schraubenspindel der Winde
ist ein Handrad angebracht, durch welches sie auf oder nieder bewegt wird; und von
den Dekeln gehen Stifte in die Höhe, die in Vertiefungen in dem untern Ende der
Schraubenspindel einpassen und mittelst eines Querstifts befestigt werden. Ist der
Dekel von seinem Plaze gehoben, so wird er durch Verschieben des Laufbloks längs des
Querbalkens in der einen oder andern Richtung leicht bei Seite gebracht.
Tafeln