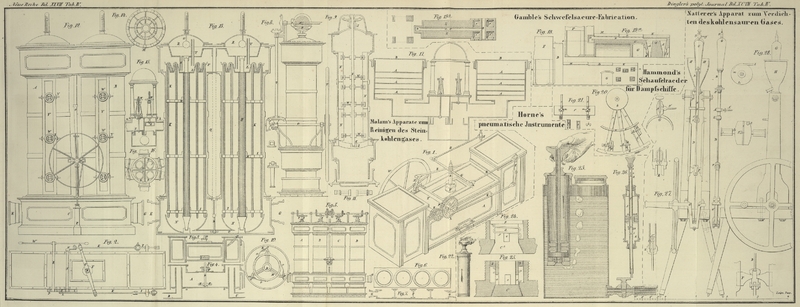| Titel: | Beschreibung des Natterer'schen Apparats zur Darstellung der Kohlensäure und des Stikstoffoxyduls im flüssigen und festen Zustand. |
| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. LXIX., S. 268 |
| Download: | XML |
LXIX.
Beschreibung des Natterer'schen Apparats zur Darstellung der
Kohlensaͤure und des Stikstoffoxyduls im fluͤssigen und festen
Zustand.
Aus dem Journal fuͤr praktische Chemie, 1845, Nr.
10 und 11.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Natterer's Apparat zur Darstellung flüssiger und fester
Kohlensäure.
Bekanntlich ist es Hrn. J.
Natterer in Wien gelungen, die Kohlensäure, so wie das
Stikstoffoxydul mittelst einer Compressionspumpe tropfbar-flüssig
darzustellen. Wir theilen in Folgendem eine Beschreibung und Abbildung des Apparats
mit, wie derselbe von Hrn. Mechanikus
Krafft in Wien ausgeführt wird, und fügen der Beschreibung einen
Abdruk der Gebrauchs-Anweisung des Apparats bei.
A, Fig. 27 und 28, ist eine
Röhre, auf der einen Seite mit einer Schraube versehen, deren conisches Ende in die
Oeffnung b, des Pumpenstiefels B luftdicht eingepaßt ist, und mittelst der Mutter, die sich in dem Ring
A' befindet, fest angezogen wird;D.h. und welche in einen Ring A' so eingeschraubt
ist, daß der conische Theil durch den Ring hindurch, und in die
entsprechende Oeffnung im Pumpenstiefel eintritt.A. d. R. das andere Ende von A ist mit Kerben versehen,
um einen Schlauch befestigen zu können, der mit einem Behälter, worin sich das zu
comprimirende Gas befindet, verbunden ist; die Oeffnung von A beträgt im Durchmesser ungefähr 2 Pariser Linien.
B ist der Pumpenstiefel, ein eisernes Rohr, 20 Zoll
lang, dessen Oeffnung, 6 Linien im Durchmesser, genau ausgeschliffen; die äußere
Stärke der untern Hälfte ist 9–10''', die der obern 12 bis 13'''; in der
Mitte hat er eine Schraube, wodurch er mit der Mutter B'
am Gestell befestigt ist.
Im Innern des Stiefels befindet sich der Kolben C,
bestehend aus einer Kappe von Juchten-Kernleder, die auf der Kolbenstange D, zwischen der Scheibe c
und der Mutter c', befestigt ist. E ist eine Stopfbüchse und dient dazu, den Behälter beim Auf- und
Niedergehen des Kolbens von der äußern Luft abzusperren; die Kolbenstange muß
deßhalb gut abgedreht und geschliffen seyn.
Durch Umdrehen des Krummzapfens G', dessen Bewegung durch
den Schlitten F in eine geradlinige verwandelt wird,
wird das Auf- und Niedergehen des Kolbens bewirkt, und zwar so, daß er am höchsten Punkt mit dem
Stiefel abschneidet, und beim niedrigsten ungefähr 1 Zoll unter der Oeffnung b sich befindet.
G ist ein Gefäß von Schmiedeisen, unten mit einem sich
nach innen öffnenden Ventil, oben mit einem Hahn versehen; es ist 1 Fuß hoch, im
großen Durchmesser 4, im kleinen 2 Zoll; die Blechstärke ist 2–3 Linien. Das
Ventil ist kugelförmig und besteht aus scheiden von gutem Leder; der Hahn g besteht aus einem in das Gefäß fest eingeschraubten
Stük, worin sich eine Schraube, unten mit einem Conus versehen, befindet, der gut
eingeschliffen ist. Das Röhrchen g' dient nun dazu, die
Luft ausströmen zu lassen; die Oeffnung beträgt die Stärke eines Pferdehaars; das
Aeußere von g' paßt in das Röhrchen 1, welches sich am
Gefäß L befindet.
L ist ein aus zwei halbkugelförmigen Theilen bestehendes
Gefäß von dünnem Messing, welche zusammengestekt und durch zwei Bügel l' zusammengehalten werden; am Boden derselben befinden
sich kleine Löcher. m ist eine Feder, auf welche das Gas
zunächst strömt, um den Druk auf die Seitenwände unschädlich zu machen.
H ist ein kupferner Behälter für Wasser oder Eis, um den
obern Theil des Stiefels und den Recipienten abzukühlen.
Gebrauchs-Anweisung des
Apparats.
Darstellung der flüssigen
Kohlensäure.
Ist der Compressions-Apparat zusammengestellt, so wird der
Kautschuk-Schlauch an die Saugröhre fest angebunden und über diesen Bund
noch ein Kautschuk-Streifen gewunden. Das andere Ende des Schlauchs wird
an einer Chlorcalcium-Röhre befestigt, welche wieder mittelst eines
kurzen Kautschuk-Rohrs mit dem Gasometer in luftdichte Verbindung zu
sezen ist; eben so ist auch die Zuströmungs-Röhre zum Gasometer mittelst
einer 8–10 Zoll langen Kautschuk-Röhre mit einer geräumigen
dreihälsigen Woulf'schen Flasche in Verbindung zu
sezen. An einem Halse wird die Kautschuk-Röhre angebracht, um die Flasche
rütteln zu können, in dem zweiten ein Nachgußtrichter, dessen Oeffnung
2–3 Zoll vom Boden entfernt ist, und in dem dritten, weitesten, ein
gekrümmter Heber, dessen kürzerer schenket fast bis an den Boden der Flasche
reicht, welcher zum Ablassen der Glaubersalzlösung dient, durch welchen Hals,
wenn die Soda größtentheils gelöst ist, auch wieder Soda nachgegeben wird,
jedoch mit der Vorsicht, bevor man den Kork wieder einsezt, durch Zugießen von
Schwefelsäure die atmosphärische Luft aus der Flasche zu vertreiben.
Nun füllt man den dritten Theil der Flasche mit gröberen Stüken calcinirter Soda
und gießt so viel laues Wasser zu, bis die Soda bedekt ist. Man muß sich von der
Luftdichthaltung sämmtlicher Röhren wohl überzeugen, um nicht atmosphärische
Luft mit zu comprimiren, weßhalb man auch den Gasometer während des Comprimirens
beschweren muß, um im Fall daß eine Röhre nicht gut schließt, lieber Kohlensäure
zu verlieren, als atmosphärische Luft in den Apparat zu bekommen.
Nun wird der Recipient, dessen Gewicht man genau bestimmt hat, fest angeschraubt
und das kupferne Gefäß zum Theil mit kaltem Wasser oder Eis und Wasser gefüllt.
Man macht nun 20 bis 30 Umdrehungen, worauf man diese Luft durch den geöffneten
Hahn wieder entweichen läßt, um die in dem Recipienten enthaltene atmosphärische
Luft zu vertreiben. Hierauf wird der Hahn wieder geschlossen und nun zu
comprimiren begonnen, welches 1–1 1/2 Stunden Zeit erfordert, indem man
nicht unausgesezt fortpumpen kann, weil sich die Kolbenstange durch die Reibung
in der Stopfbüchse erwärmt, weßhalb man sie auch öfter beöhlen muß.
Sollte man während des Comprimirens eine bedeutende Abnahme des Geräusches,
welches das Ventil beim Einströmen der Kohlensäure verursacht, wahrnehmen, so
wäre dieß ein Zeichen, daß das Kolbenleder nicht luftdicht hält, worauf man das
Wasser im Kessel abfließen läßt, den Recipienten abschraubt und 8–10
Tropfen reines Oehl in den Stiefel tropft, dann den Recipienten wieder
aufschraubt und nun mittelst des Rads das Oehl in denselben hineindrükt, wodurch
sowohl das Kolben- als auch das Ventilleder zum besseren Verschluß
gebracht wird. Man wiederholt dasselbe Verfahren, so oft 2–3 Kubikschuh
Kohlensäure gepumpt sind, wobei man den Recipienten auch immer abwiegt. Man
pumpt so lange Kohlensäure fort, bis die Gewichtszunahme 450 Gramme beträgt. Es
sind dann ungefähr 2/3 Theile des Recipienten mit flüssiger Kohlensäure erfüllt,
welches man dadurch erkennt, daß man den nach aufwärts gekehrten Hahn so weit
öffnet, daß man ein Ausströmen des Gases deutlich hört, worauf man den
Recipienten so weit langsam neigt, bis das Geräusch sich deutlich verändert,
welches ein Beweis ist, daß das Niveau der Flüssigkeit bis zur
Ausströmungsöffnung gekommen ist und dieselbe durch die Flüssigkeit versperrt
worden. Man kann daher, wenn man eine größere Menge fester Kohlensäure
benöthigen sollte, selbst noch 30–40 Gramme mehr hinein pumpen, nur darf
man den Recipienten an keinen wärmeren Ort bringen, weil die thermometrische
Ausdehnung der flüssigen Kohlensäure sehr bedeutend ist.
Einen gefüllten Recipienten kann man Monate lang stehen lassen, ohne fürchten zu
müssen, daß das Metall angegriffen werde, indem die Recipienten von Innen ganz
mit Kupfer überzogen sind und selbst das Eisen nicht im geringsten von der Säure
angegriffen wird.
Erzeugung der festen
Kohlensäure.
Wenn man die flüssige Kohlensäure in feste verwandeln will, so kühlt man den
Recipienten früher in einer Kälte erzeugenden Mischung stark ab, indem man desto
mehr feste Kohlensäure erhält, je besser der Recipient abgekühlt wurde.
Während nun Jemand das halbkugelförmige Gefäß, die beiden Halbkugeln fest gegen
einander drükend, so hält, daß die beiden Handhaben und das Einströmungsröhrchen
in horizontaler Lage sich befinden, öffnet ein Zweiter den Hahn durch 1–2
Umdrehungen der Schraube und läßt 4–5 Secunden lang einströmen. Der
Recipient muß mit nach abwärts gerichtetem Hahn gehalten werden und das
Ausströmungsröhrchen desselben in das Einströmungsrohr des Gefäßes gepaßt
werden.
Würde man zu lange einströmen lassen, so würde ein Theil der festen Kohlensäure
mechanisch mit herausgeschleudert werden.
Die feste Kohlensäure wird nun in eine dünnwandige Schale gegeben und zu den
Abkühlungsversuchen mit 10–20 Tropfen Schwefeläther zu einem Brei
angemacht. Das Thermometer läßt man so machen, daß die Kugel nicht zu groß ist,
um nicht zu viel Kohlensäure anwenden zu müssen, und daß die Scala nicht bis zur
Kugel reicht, um die ganze Kugel mit Kohlensäure umgeben zu können. Will man
Queksilber gefrieren lassen, so gieße man nicht die ganze Masse Queksilber auf
einmal in die Schale, sondern immer nur 50–80 Gramme, bedeke die
Oberfläche desselben ganz mit Kohlensäure und wende dann, wenn das ganze
Queksilber fest geworden, dasselbe, um es auch auf der unteren Seite stark
abkühlen zu können, damit man es längere Zeit im festen Zustand zeigen kann.
Hört man nach 5–6maligem Ausströmen beim Oeffnen des Hahns ein von dem
früheren Geräusch verschiedenes, so ist dieß ein Zeichen, daß keine flüssige
Kohlensäure mehr vorhanden ist; man schließe daher schnell den Hahn, wiege den
Recipienten wieder ab und pumpe für einen zweiten Versuch die fehlende
Gewichtsmenge Kohlensäure zu. Die luftige Kohlensäure, welche im Recipienten
zurükbleibt, wiegt gewöhnlich 80–90 Gramme.
Wurde der Recipient 10–12mal gefüllt, so ist es räthlich, daß man die
Kohlensäure ausströmen läßt und das Ventil abschraubt, um den Recipienten und das
Ventil vom Oehl reinigen zu können, so wie es auch gut ist dasselbe zu thun,
wenn man den Recipienten monatlang unbenuzt liegen zu lassen gedenkt, indem
sonst das Kupfer vom Oehle angegriffen würde. Man hat sich auch von Feit zu Zeit
von der Luftdichthaltung der Stopfbüchse zu überzeugen, indem man im
entgegengesezten Falle neue Lederscheiben und Flachs einzulegen hätte.
Das Comprimiren des
Stikstoffoxyduls.
Man bereitet sich salpetersaures Ammoniak, indem man bei der
Kohlensäure-Compression kohlensaures Ammoniak und Salpetersäure anwendet.
Das salpetersaure Ammoniak muß jedoch ganz frei von Salmiak gemacht werden,
indem sich bei der Erwärmung Chlor entwikeln würde, welches der Pumpe und deren
Recipienten schaden würde.
Bei der Compression des Stikstoffoxyduls hat man jedoch die Vorsicht ja nicht
außer Acht zu lassen, daß man weder das Kolbenleder, noch das Ventil, noch das
zwischen dem Recipienten und dem Stiefel befindliche Leder mit Oehl, sondern
immer bloß mit Wasser befeuchtet, indem es sonst geschehen könnte daß, nach Art
des pneumatischen Feuerzeugs, durch die große Wärmefreiwerdung während des
Comprimirens, das Oehl sich entzünden und wegen der Menge des nur lose an den
Stikstoff gebundenen Sauerstoffgases die Entzündung sich in das Innere des
Recipienten fortpflanzen könnte und dadurch der Recipient zertrümmert würde.
Man reinigt daher den Recipienten und das Ventil früher wohl vom Oehl, beledert
die Kolbenstange neu, wie man auch ein neues, mit Wasser befeuchtetes Leder
zwischen den Recipienten und den Stiefel einlegt.
Wird diese Vorsichtsmaaßregel berüksichtigt, so ist nicht die mindeste Gefahr
vorhanden. Man kann dieselbe Gewichtsmenge Stikstoffoxyduls pumpen, wie bei der
Kohlensäure. Die Ausströmungs-Oeffnung muß jedoch beim Stikstoffoxydul
viel kleiner seyn, weil sonst durch die Menge des sich bildenden Gases das
flüssige Stikstoffoxydul mechanisch mit herausgerissen würde, weßhalb man die
zweite Spize anzuschrauben hat.
Zu allen Abkühlungs-Versuchen dürfte flüssiges Stikstoffoxydul bei weitem
vorzuziehen seyn, indem es einerseits eine viel niedrigere Temperatur hat und es
sich wegen seiner flüssigen Form viel besser hiezu eignet und andererseits viel
länger anhält als das Gemenge von fester Kohlensäure mit Aether.
Aufstellung des
Apparats.
Bei einiger Geschiklichkeit oder mit Hülfe eines Maschinisten wird es leicht
seyn, die Compressionspumpe zusammenzustellen, vom Staub und etwa vorhandenen
Rost zu reinigen, die Bewegungen, Kolbenstange und Stiefel einzuöhlen und die
betreffenden Schrauben so anzuziehen, daß die Pumpe einen ruhigen Gang hat.
Vorzüglich hat man darauf zu sehen, daß die Stopfbüchse unten am Stiefel
luftdicht schließt, damit nicht beim Pumpen atmosphärische Luft eingesogen wird.
Man bewerkstelligt dieß dadurch, daß man dieselbe fest mit der Hand anschraubt,
was auch während des Pumpens zuweilen zu geschehen hat. Sollte es nöthig werden
ein neues Leder auf die Kolbenstange zu befestigen, so schraube man die
Stopfbüchse, so wie die Mutter, mit welcher die Kolbenstange an die Führung der
Pumpe befestigt ist, ab, nehme dieselbe aus dem Stiefel, verwechsle das alte
Leder mit einer neuen Kappe und fiele die Kolbenstange von unten in den Stiefel,
jedoch so, daß sich keine Falten bilden, weßhalb der Stiefel auch unten
erweitert ausgedreht ist, schraube die Stopfbüchse wieder an und befestige die
Kolbenstange wie früher an die Führung.
Die Befestigung des Saugrohrs an den Stiefel ist, wenn es nöthig wäre dasselbe
ab- und anzuschrauben, so vorzunehmen, daß die conische Schraube sich
beim Anschrauben in das conische Loch des Stiefels genau einpaßt.
Jeder Recipient ist auf 150 Atmosphären probirt, weßhalb sie ohne alle Gefahr
benuzt werden können, indem die Kohlensäure nur 40–50, das
Stikstoffoxydul 50–60 Atmosphären zum Flüssigwerden erfordert.
Tafeln