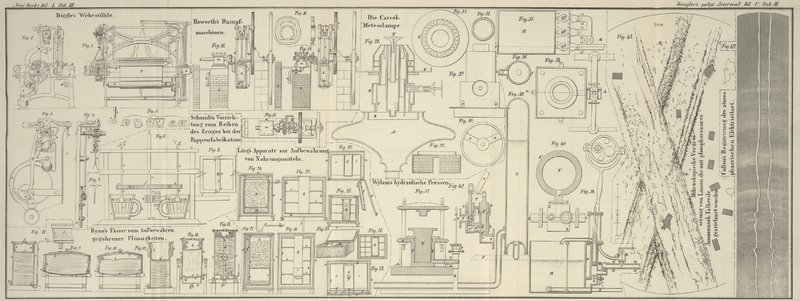| Titel: | Die Carcel-Meteorlampe. |
| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XXXV., S. 170 |
| Download: | XML |
XXXV.
Die Carcel-Meteorlampe.
Aus dem Mechanics' Magazine, 1845, Nr.
1165.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Carcel's Meteorlampe.
Unter den neueren Lampen verdient die verbesserte Carcel-Lampe besonders
Erwähnung. Sie eignet sich zum Brennen von einer Mischung aus Terpenthinöl und
Weingeist und unterscheidet sich von andern Spirituslampen insbesondere dadurch, daß
anstatt des gewöhnlichen soliden Brechers (breaker) eine
hohle Röhre mit einem schalenförmigen Obertheil angeordnet ist, durch welche
fortwährend Luft in das Innere der Flamme strömt. Durch diese einfache Vorrichtung
erhält man ein Licht von sehr intensiver Helligkeit.
Fig. 28
stellt einen Seitendurchschnitt dieser Lampe dar. A ist
das Reservoir; C der (Fig. 29 abgesondert
gezeichnete) Brenner, welcher in einen Hals B geschraubt
ist, der an dem oberen Theil des Reservoirs festsitzt. N
ist der neue hohle Brecher; a, a sind zwei Luftröhren,
welche von der äußeren Seite des Brenners C in einer
geneigten Richtung nach der inneren Luftröhre D sich
erstrecken. Diese Luftröhre mit ihren beiden Seitenröhren ist Fig. 30 abgesondert im
Grundrisse dargestellt. E ist ein Windschirm von der
Fig. 31
und 32 im
Grundriß und Durchschnitt dargestellten eigenthümlichen Form; F der Glashälter, welcher aus zwei Theilen 1 und 2 besteht; der Theil 1
ist unten durchlöchert und der Theil 2, wie der separate Grundriß Fig. 33 zeigt, mit
durchlöcherten Ringen umgeben.
Tafeln