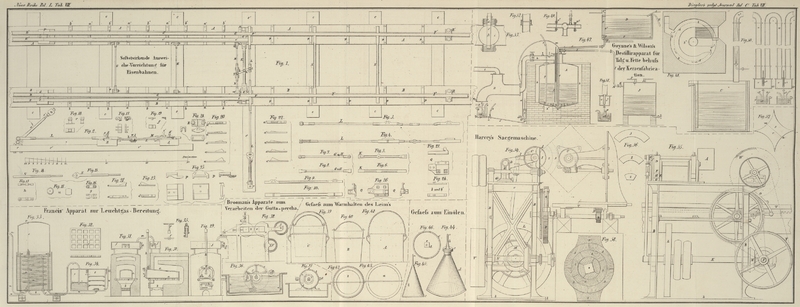| Titel: | Gefäß zum Einölen von Wellen und Zapfen. |
| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. LXXXI., S. 445 |
| Download: | XML |
LXXXI.
Gefäß zum Einölen von Wellen und
Zapfen.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Gefäß zum Einölen von Wellen und Zapfen.
Dieses einfache aber höchst nützliche Gefäß zum Einölen von in Lagern laufenden
Wellen und Zapfen ist ursprünglich eine Erfindung der Engländer und bereits in
vielen Werkstätten Deutschlands eingeführt. Fig. 44 ist die
isometrische Ansicht eines Oelgefäßes, wie es vom Mechaniker Emil Hoffmann in Leipzig (Windmühlenstraße) gefertigt wird
(das Duzend zu 6 Thlr.).
d ist ein hohles und kegelförmiges Gefäß von
lackirtem Weißblech – unten durch einen dünnen elastischen Blechboden,
welcher federt, wenn man mit dem Daumen darauf drückt, geschlossen – das an
der Basis 4 1/2 Zoll Durchmesser und bis zu c 2 1/2 Zoll
senkrechte Höhe hat. Bei c befindet sich eine messingene
Mutterschraube im Gefäß, in welche das gedrehte messingene Mundstück a, b festgeschraubt wird; der luftdichte Verschluß wird
durch einen dazwischen gelegten Kautschukring erzielt. Das Mundstück a, b ist ein hohler Cylinder, der oben bei a eine Oeffnung hat von der Dicke einer feinen
Stecknadel. Dieses Gefäß wird nun durch die Schraubenöffnung mit dem flüssigen Oel
gefüllt, der Druck der Luft verhindert aber den Oelaustritt durch die feine
Mundstücköffnung; er erfolgt aber, wenn mit dem Daumen der Hand auf den elastischen
Boden des Gefäßes gedrückt wird. In diesem Augenblick treten nämlich, je nachdem man
mehr oder weniger stark drückt, ein oder mehrere Tropfen aus. Das Gefäß muß dabei
mit der Spitze nach unten gerichtet werden. Das dünne Mundstück gestattet das
Einträufeln in Orte, die sehr klein sind und versteckt liegen. Die Oelersparniß ist
bei Anwendung des Gefäßes nicht unbedeutend, da man durch dasselbe dem Lager das Oel
nach Bedürfniß tropfenweise zumessen kann, während bei dem offenen Schmierkännchen
man den Oelzufluß keineswegs in der Gewalt hat. Vorzüglich nützlich bewährt sich das
Instrument in Spinnereien, wo so unendlich viele Theile sich drehend reiben, so auch
in mechanischen Werkstätten. Wird mit dem Gefäß, ohne abzusetzen, viel eingeölt, so
muß man es zuweilen mit der Spitze nach oben wenden, damit aufs neue Luft durch die
Mundstücköffnung eindringe. Man führt das Gefäß mit einer Hand, den Daumen auf die
Bodenplatte gelegt. Noch einfacher, wohlfeiler und für viele Zwecke deßwegen
eingänglicher, läßt sich das Gefäß, wie Fig. 45 und 46 gezeichnet,
herstellen. Das kegelförmige Gefäß ist von Weißblech und von gleicher Form und
Größe, wie Fig.
44, nur daß es kein eigens abzuschraubendes Mundstück hat, sondern das
Gefäß selbst in eine feine Röhre mit der nöthigen Oeffnung ausläuft. Unten in dem
elastischen Blechboden e befindet sich eine viereckige
Messingmutter d luftdicht eingesetzt, durch welche das
Oel ins Gefäß gegossen und darauf mit einer Schraube, die einen kleinen runden Kopf
hat, verschlossen wird; c ist ein vorspringender
Blechrand, etwas höher wie der Schraubenkopf, damit man das Gefäß aufrecht stellen
kann. – Eine ganz einfache, wenn auch unvollkommenere Anwendung des Princips,
worauf jenes Oelgefäß beruht, läßt sich erzielen, wenn man, anstatt die
Schraubenmutter unter dem Boden des Gefäßes b, Fig. 45, anzuzinnen, gleich ein
richtig rundes Loch in den Boden schlägt oder bohrt und dieses Loch mit einem gut
passenden Stöpsel luftdicht abschließt. (Deutsche Gewerbe-Zeitung, 1846 Nr.
16.)
Tafeln