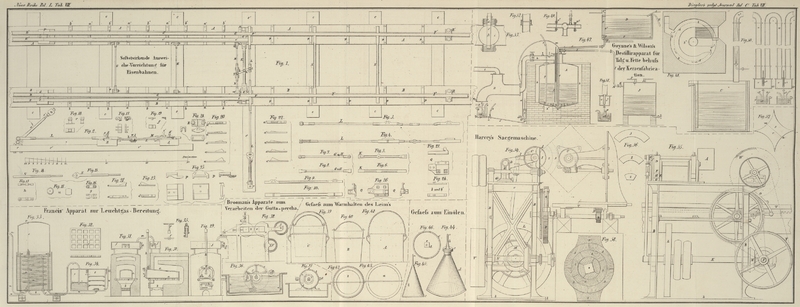| Titel: | Ueber ein zweckmäßiges Gefäß zum Warmhalten des Leims; von H. Schröder. |
| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. LXXXIII., S. 454 |
| Download: | XML |
LXXXIII.
Ueber ein zweckmäßiges Gefäß zum Warmhalten des
Leims; von H.
Schröder.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Schröder, über ein zweckmäßiges Gefäß zum Warmhalten des
Leims.
Es ist längst bekannt, daß der Leim durch anhaltendes Kochen an bindender Kraft
verliert; man weiß daß die beste Art, den Leim aufzulösen, darin besteht, denselben
in kaltem Wasser einzuweichen bis er gallertartig aufgequollen ist, und ihn in
diesem Zustand bei einer Temperatur, welche die Siedhitze des Wassers nicht
übersteigt, unmittelbar vor dem Gebrauch zergehen zu lassen. Gleichwohl überzeugt
man sich, wenn man die Werkstätten der Schreiner, Buchbinder u.s.w. besucht, daß
diese längst bekannte Regel in der Behandlung des Leims fast nirgends befolgt wird,
fast überall sieht man, daß der Leim in eisernen oder messingenen Pfannen
unmittelbar über glühenden Kohlen oder auf den durch Hobelspäne geheizten Oefen
anhaltend gekocht und theilweise verbrannt wird, so daß derselbe einen großen Theil
seiner bindenden Kraft bereits verloren hat, wenn er verwendet wird. Ich glaube
daher den Schreinern, Buchbindern u.s.w. einen Dienst zu erweisen, wenn ich im
Nachfolgenden ein zweckmäßiges Gefäß zum Auflösen und Warmhalten des Leims
beschreibe, wie ich es in der Werkstätte des Schreinermeisters Karl Busch (zu Mannheim) in Anwendung sehe, dessen neues
Etablissement sich mehrfach durch eine zweckmäßige Einrichtung und Leitung, dessen
Magazin sich durch Geschmack und solide Arbeit der darin aufgestellten Möbel
auszeichnet. Obwohl der Gebrauch eines solchen Gefäßes nicht neu ist, obwohl
dasselbe in mehreren größeren Werkstätten schon seit langer Zeit in Anwendung ist,
so ist es doch, wie ich mich überzeugt habe, den wenigsten Gewerbsmeistern bekannt.
Hr. Karl Busch hat mir
ungefähr wie folgt die Vortheile des auf Tab. VII. im Grundriß und Aufriß
dargestellten Gefäßes geschildert.
Die Schreiner haben sich schon oft die Frage gestellt, woher es komme, daß eine Fuge
auseinanderfällt, die doch gut zusammengefügt und sorgfältig geleimt ist, daß
Furnüre, an welchen die Arbeit untadelhaft ausgeführt wurde, sich dennoch ziehen und
stellenweise losgehen? Aber meist hat man sich nicht die richtige Antwort gegeben:
daß es von der fehlerhaften Behandlung des Leims herrührt, welche darin besteht, den
Leim in Pfannen unmittelbar über den Hobelspänefeuer zu kochen, und so oft er gebraucht wird,
über demselben aufzuwärmen, wodurch derselbe in seiner Beschaffenheit verschlechtert
und theilweise verbrannt wird. In der Anwendung solchen verbrannten Leims ist die
Hauptursache des Mißlingens so mancher Schreinerarbeiten zu suchen. Soll diesem
Uebelstande abgeholfen werden, so darf der Leim nie über die Siedhitze des Wassers
erwärmt werden; er darf daher nicht unmittelbar in metallenen oder irdenen Gefäßen
über das Feuer gebracht werden, sondern er muß in einem Wasserbad erwärmt werden.
Dazu dient nun folgender Apparat. A und a, (Fig. 39 bis 43), stellt im
Aufriß und Grundriß ein cylindrisches Gefäß von verzinntem Eisenblech dar; dasselbe
hat etwa 4 1/2 Zoll Höhe und etwa 5 Zoll Durchmesser; dieß ist der Wasserkessel. In
dieses Gefäß A wird ein zweites Gefäß B und b in Aufriß und
Grundriß) von Messing eingestellt, welches durch einen an seinem oberen Ende
vorstehenden ringförmigen Ansatz auf dem kreisrunden Rande des Wasserkessels eben
aufliegt: dieß ist der eigentliche Leimkessel, dessen Wandung 2–3 Linien dick
ist, um die Temperatur des Leims immer etwas unter der des Wassers zu erhalten. Die
Höhe dieses Leimkessels beträgt etwa 4 Zoll, sein Durchmesser 4 Zoll 3 Linien. Die
Henkel an beiden Gefäßen sind von Eisendraht. Die Figur C gibt die Zusammensetzung beider Gefäße an. In den Wasserkessel A wird nun so viel Wasser gebracht, daß es denselben
nicht ganz füllt, wenn der Leimkessel B eingesetzt ist.
Das Ganze steht auf einem kleinen Herd oder Ofen von Eisenblech, oder auf einem
sogenannten Saukopf, welcher mit dem Kehrsel und sonstigen Abfällen der Werkstätte
geheizt wird. Dadurch wird das Wasser im Gefäß fortwährend heiß erhalten; die beiden
Kessel liegen mit ihrem obern Rande nicht so dicht auf einander, daß die
Wasserdämpfe nicht entweichen könnten. Der Leim im Kessel B kann also niemals eine größere Temperatur als die Siedhitze des Wassers
erleiden. Wird der Leim etwas verdünnter gebraucht, so kann das heiße Wasser des
Kessels sogleich zum Verdünnen desselben angewendet werden, ohne daß man den Leim
nach Zusatz des Wassers erst wieder aufkochen müßte. Hat der Arbeiter auf seiner
Bank etwas zu leimen, so stellt er den ganzen Apparat neben sich auf die Bank; die
das Leimgefäß B umgebende erhitzte Wassermasse und das
dicke Wassergefäß halten die Wärme so gut zusammen, daß der Leim 1 1/2 bis 2 Stunden
nicht erkaltet und fortwährend zum unmittelbaren Gebrauch geeignet bleibt, ehe er
wieder einige Minuten aufgewärmt werden muß.
Wer sich dieses Gefäßes bedient, kann sich auf die Bindekraft des Leims, wenn
derselbe nur sonst von guter Beschaffenheit ist, unbedingt verlassen; er erspart dadurch
gegen das übliche Verfahren wenigstens ein Drittheil an Leim selbst, so wie auch an
Feuerung zur Erwärmung des Leims, und wird daher, von dem Vortheil, daß seine Arbeit
zuverlässiger und besser wird, ganz abgesehen, in kurzer Zeit an bloßem
Materialwerth weit mehr erübrigt haben, als die Kosten der Anschaffung eines oder
mehrerer solcher Gefäße betragen, deren jedes, wenn es sorgfältig gefertigt ist, auf
4 bis 5 fl. zu stehen kommt. Wer immer den Werth einer solchen Vorrichtung kennen
gelernt hat, wird sich durch den Preis derselben gewiß nicht abschrecken lassen.
(Mannheimer
Gewerbvereins-Blatt, 1846 Nr. 10.)
Tafeln