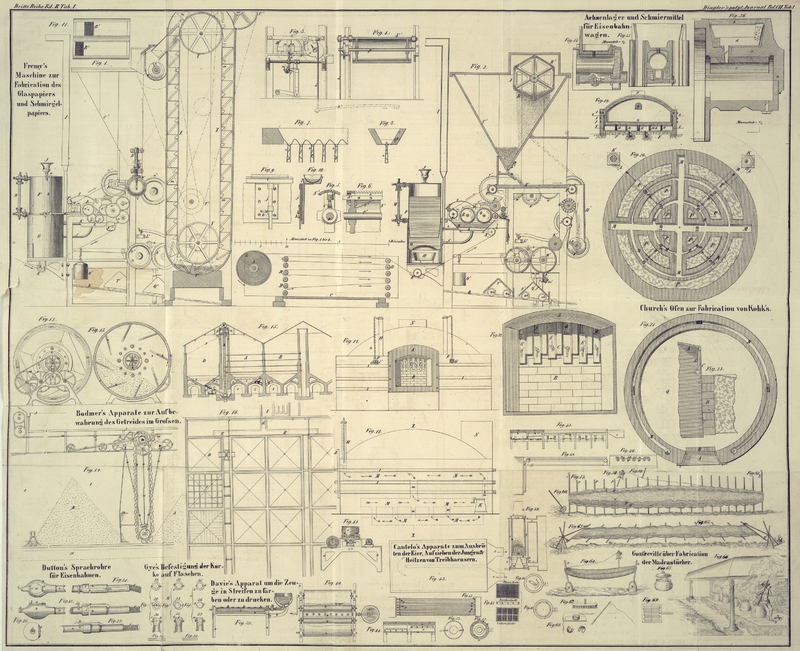| Titel: | Sprachrohre für Eisenbahnwagen, worauf sich George Dutton, in Dutton-street, Grafschaft Middlesex, am 11. Nov. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. I., S. 2 |
| Download: | XML |
I.
Sprachrohre für Eisenbahnwagen, worauf sich
George Dutton, in
Dutton-street, Grafschaft Middlesex, am 11.
Nov. 1845 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts, Sept. 1846, S.
85.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Dutton's Sprachrohre für Eisenbahnwagen.
Wenn irgend einem Theil eines Eisenbahnzuges ein Unfall begegnet, wovon der
Locomotivführer nichts weiß, sollte man letztern davon augenblicklich
benachrichtigen können, damit er die Locomotive schnell zum Stillstand bringt; dieß
ist der Zweck vorliegender Erfindung. Sie besteht in einem Apparat, wodurch die
Reisenden in einem Wagen dem Locomotivführer Nachrichten mittheilen können. Der
Apparat besteht aus einer Reihe von metallenen oder andern Röhren, welche mit
einander verbunden sind, sich über die ganze Länge des Zugs erstrecken und an jedem
Ende, sowie auch an geeigneten Stellen, mit Ventilen oder bedeckten Oeffnungen
versehen sind; außer diesen Oeffnungen oder Ventilen ist die ununterbrochene Röhre
auch noch mit Pfeifen versehen, um durch ein lautes Signal vor jeder mündlichen
Mittheilung die Aufmerksamkeit des Locomotivführers erregen zu können. Die Röhren
können aus dünnem Messing oder galvanisirtem (verzinktem) Eisen von 1 oder 1 1/2
Zoll Durchmesser verfertigt werden. Man bringt sie entweder im Innern des Wagens,
längs der Decke oder unter dem Fußboden an; letztere Anordnung ist vielleicht
vorzuziehen, weil man die Röhren dabei leichter mit einander verbinden und
auseinander nehmen kann; jedenfalls ist es nöthig, kurze, sich aufwärts oder abwärts
verzweigende Röhren mit Mundstücken zu haben, um von jedem Theil des Zugs aus dem
Conducteur oder Locomotivführer leicht Mittheilungen machen zu können. Die
Hauptröhren, welche sich längs des Dachs oder Bodens der Wagen erstrecken, sind
starr und gerade und an ihren Enden mit Ansähen versehen, in welche die Enden der
biegsamen Verbindungsröhren gesteckt werden, um die Röhre des einen Wagens mit der Röhre des benachbarten
Wagens zu verbinden. Diese Verbindungsröhren sind biegsam gemacht, damit sie der
Wirkung der Bufferfedern nachgeben und auch dem Annähern oder Entfernen der Wagen
von einander nicht hinderlich sind. Damit die biegsamen Röhren zwischen den Wagen
mit den starren Röhren in den Wagen auf eine sichere, leichte und einfache Weise
verbunden und von denselben getrennt werden, auch nicht in Unordnung gerathen
können, ist an jedem Ende der biegsamen Verbindungsröhre ein Federfänger angebracht,
welcher, indem er in eine Häspe oder Büchse am Ende der starren Wagenröhren greift,
beide sicher in Verbindung hält.
Fig. 24 ist
der Seitenaufriß einer Röhre mit dem Apparat zum Sprechen oder Pfeifen; Fig. 25 ein
Grundriß und Fig.
26 eine Endansicht derselben. a, a ist eine
starre Metallröhre, welche, um einen Verlust an Schall zu verhüten, mit Leder oder
einem sonstigen schlechten Leiter des Schalls überzogen werden muß. b, b ist das Mundstück; es ist kugelförmig, um so viel
Luft einzuschließen als nöthig ist, damit der Schall der Pfeife längs der Röhren
fortgepflanzt wird; c ist die Pfeife am Ende der Röhre
und d das Ventil, welches das Mundstück verschließt
während man pfeift. Der Schall der Pfeife tritt direct in die sphärische Kammer b, b und wirkt gegen das darin enthaltene Luftvolum; und
da das Ventil oder der Deckel d genau schließt und das
Entweichen des Schalls verhindert, so muß sich der Schall längs der Röhre
fortpflanzen. Das Ventil d paßt mit seinem geschliffenen
Rand genau auf seinen Sitz; es wird mittelst eines Federfängers e geschlossen, den man leicht zurückziehen und frei
machen kann, wenn man durch die Röhren sprechen muß. Damit die Vibration oder das
Geräusch in den Wagen auf den Schall keinen Einfluß haben kann, darf die Röhre
durchaus nicht mit dem Metall oder Holzwerk der Wagen in Berührung kommen; die
Löcher in den Enden und Abtheilungen der Wagen, durch welche die Röhren gesteckt
werden, sind daher mit Leder oder einem sonstigen geeigneten Material gefuttert.
f, f,Fig. 24 und
25, sind
Theile der biegsamen Röhre mit dem Federfänger g und dem
kegelförmigen metallenen Endstück h, welches in den
Ansatz i am Ende der starren Röhre a, a des Wagens gesteckt wird. Der Federfänger g ist an dem metallenen Endstück der biegsamen Röhre
befestigt, wie man in Fig. 24 und 25 sieht; und
wenn man die zwei Röhren zusammenbringt, dringt der Federfänger in die Häspe oder
das Oehrstück j am Ende der Röhre a, a und hält die zwei Röhren sicher in Verbindung.
Es ist noch zu bemerken, daß beide Enden der biegsamen Verbindungsröhre mit
Federfängern g und kegelförmigen Endstücken h versehen sind; die Enden der Röhre a, a sind auch mit correspondirenden Ansätzen i und Häspen oder Oehrstücken j versehen, welche, da sie alle von gleicher Größe und in denselben
relativen Lagen in allen Wagen angebracht sind, stets leicht verbunden oder getrennt
werden können. Ferner sollte ein Mundstück und Signal, wie oben beschrieben, am Ende
einer Zweigröhre an irgend einer passenden Stelle innerhalb jedes Wagens angebracht
werden oder auch in jeder besonderen Abtheilung eines Wagens, damit die Reisenden
direct mit dem Locomotivführer oder Conducteur communiciren können. Fig. 27 zeigt Theile
zweier mit einander verbundenen Röhren.
Tafeln