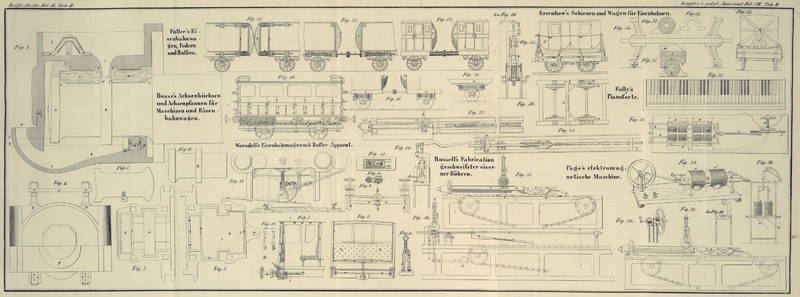| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication geschweißter eiserner Röhren, worauf sich Thomas Henry Russell, Röhrenfabrikant zu Wednesbury, in der Grafschaft Stafford, am 14. Aug. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. XXI., S. 108 |
| Download: | XML |
XXI.
Verbesserungen in der Fabrication geschweißter
eiserner Röhren, worauf sich Thomas Henry Russell, Röhrenfabrikant zu Wednesbury, in der Grafschaft
Stafford, am 14. Aug. 1845 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Aug. 1846,
S. 65.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Russell's Verbesserungen in der Fabrication geschweißter eiserner
Röhren.
Fig. 21
stellt den Mechanismus, welcher den Gegenstand meiner Erfindung bildet, in der
Seitenansicht,
Fig. 22 im
Grundriß und
Fig. 23 im
Längendurchschnitt dar. Man sieht in diesen Figuren nur die beiden Enden der
Ziehbank.
Fig. 24
liefert einen Querschnitt des Mechanismus. Die Erfindung besteht in einem geeigneten
mechanischen Apparat, mit dessen Hülfe der zum Zusammenschweißen erforderliche
äußere Druck hervorgebracht wird, eine Operation die sonst gewöhnlich ein Arbeiter
mittelst des Hammers aus freier Hand bewerkstelligt. a,
a ist das Gestell der Ziehbank; b sind die
Zangen, welche die Röhre halten; c der Haken, der die
Zangen b mit der Kette d
verbindet; e eine Stange, die ich das Schnabeleisen (beak-iron) nennen will, weil es ähnliche Dienste
leistet, wie der Schnabel eines Amboßes beim Zusammenschweißen einer Röhre aus
freier Hand. Diese Stange e ist an ihrer Arbeitsfläche
bei e verstählt und in dem festen Theil f festgekeilt. Sie ist stark genug, um einer Biegung zu
widerstehen und bietet daher einer über sie geschobenen Röhre eine genügende innere
Stütze dar, um den Röhrensaum unter Anwendung mechanischen Drucks festschweißen zu
können. g ist ein an der Ziehbank befestigtes hohles
Gesims, auf dem die zu schweißende Röhre mit ihrem unteren Theil dergestalt ruht,
daß der Saum oder die Fuge nicht auf der Stange des Schnabeleisens aufliegt; h die in einer Schweißhitze befindliche Röhre, deren
Ränder über einander greifen. Um das Schnabeleisen so kurz als möglich machen zu
können, ziehe ich es vor zuerst die eine und dann die andere Hälfte der Röhre zu
schweißen. Je größer indessen der Durchmesser der Röhre ist, desto größer kann das
Schnabeleisen seyn, ohne sich durch den angewandten Druck zu biegen. i ist eine an ihrem Umfang mit einer Rinne versehene
Walze, welche ich nebst dem mit ihr verbundenen Apparat für das beste Mittel halte,
um den für die Operation des Schweißens erforderlichen Druck von außen
hervorzubringen. Diese Walze ist in einer gabelförmigen verschiebbaren Stange j gelagert, und diese ist mit einem Hebel k verbunden, so daß der Arbeiter durch Niederbrücken
dieses Hebels einen Druck gegen die Oberfläche der Röhre hervorbringt, der
hinreicht, um die Ränder der Röhre zusammenzuschweißen, während sie längs des
Schnabeleisens unter der Walze i hinweggezogen wird.
Nachdem nämlich der Arbeiter eine gehörig vorbereitete Röhre auf etwas mehr als die
Hälfte ihrer Länge bis zur Schweißhitze erwärmt hat, nimmt er sie aus dem Ofen,
schiebt sie mit Hülfe eines oder mehrerer Gehülfen auf das Gesims g über das Schnabeleisen und drückt die Walze gegen die
übereinander greifenden Ränder, so daß diese, während die Röhre durch die Kette der
Ziehbank fortgezogen wird, zwischen die Walze und das Schnabeleisen gepreßt
werden.
Der so eben beschriebene Mechanismus eignet sich zur Anfertigung von Röhren größeren
Durchmessers. Da es jedoch wünschenswerth ist, auch eiserne Röhren von kleinerem
Durchmesser zusammenzuschweißen, bei denen die Stange des Schnabeleisens nicht dick
genug seyn würde, um einer Biegung den gehörigen Widerstand darzubieten, wenn sie
nur an dem einen Ende unterstützt wäre, so unterstütze ich das Schnabeleisen nahe an
der Stelle, wo der Druck in Ausübung kommt. Dadurch bin ich im Stande, der
Schnabelstange eine weit größere Länge zu geben, als wenn sie nur an dem einen Ende
befestigt wäre. Fig. 25
stellt den Grundriß und
Fig. 26
die Seitenansicht einer Ziehbank mit dem Apparate zur Zusammenschweißung solcher
eiserner Röhren dar. In dem vorliegenden Fall werden die Röhren direct aus dem Ofen
über das Schnabeleisen gezogen. Die Zangen b umfassen
bei diesem Apparat das äußere Ende der Röhre. Um das Zerdrücken des Röhrenendes zu
verhüten, wird ein hohler Kegel x in dasselbe geschoben.
e ist das Schnabeleisen mit seiner Stange; der
Durchmesser dieser Stange sollte so groß seyn, als es nur der Durchmesser der Röhre
gestattet, ohne jedoch die freie Bewegung der Röhre zu verhindern. w ist eine mit einer Rinne versehene Walze, auf der die
Röhre mit ihrer unteren Fläche ruht. Der Apparat zur Herstellung des äußeren Drucks
gleicht dem oben beschriebenen. Da das Schnabeleisen wegen seiner großen Länge sich
leicht biegen könnte, wenn es nur in f unterstützt wäre,
so unterstütze ich die untere Fläche der Röhre noch durch eine andere Walze y. Die Walze w ist in einem
Gestell gelagert und wird durch das Gewicht w¹
aufwärts gedrückt.
Tafeln