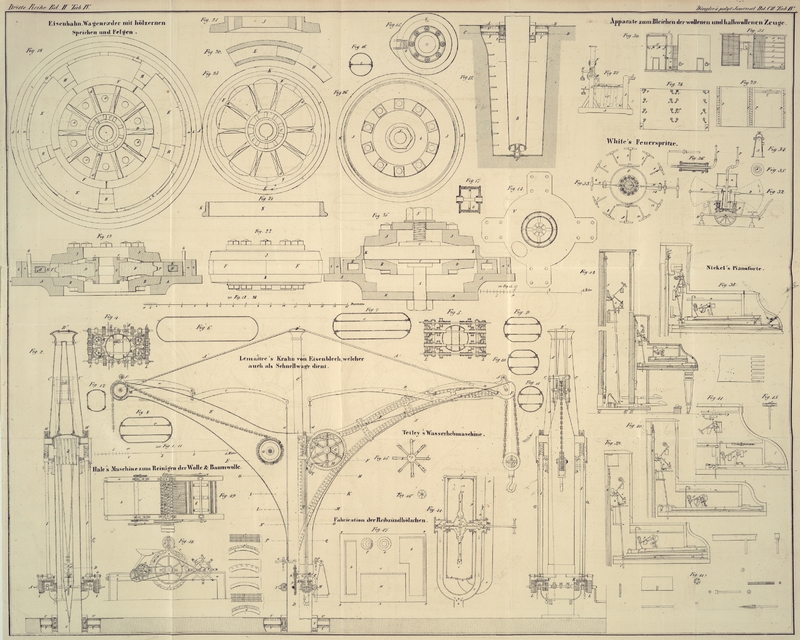| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zum Reinigen der Wolle und Baumwolle, worauf sich James Hale zu London, am 16. Oct. 1845 einer Mittheilung zufolge ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. LV., S. 280 |
| Download: | XML |
LV.
Verbesserungen an Maschinen zum Reinigen der
Wolle und Baumwolle, worauf sich James Hale zu London, am 16. Oct.
1845 einer Mittheilung zufolge ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jul. 1846,
S. 1.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Hale's Verbesserungen an Maschinen zum Reinigen der Wolle und
Baumwolle.
Diese Erfindung bezieht sich auf gewisse neue und nützliche Verbesserungen in der
Construction, Anordnung und Verbindung der mechanischen Mittel zum Zausen und
Krämpeln von Wolle oder Baumwolle, wobei die Fasern dieser Stoffe von Kapseln,
Samen, Zweigen und andern fremden und nutzlosen Substanzen durch Anordnung
mechanischer Hülfsmittel gereinigt werden, welche theils für sich, theils in
Verbindung mit der gebräuchlichen Krämpelmaschine in Anwendung kommen. Die besagten
Verbesserungen sind in Beziehung auf die Art ihrer Einrichtung, Verbindung und
Wirkungsart Fig.
48 in der Seitenansicht und Fig. 49 im Grundrisse
dargestellt. Die Construction ist folgende: die Maschine ruht auf einem geeigneten
Gestell a, an dessen einem Ende sich ein endloses Tuch
b befindet, das über zwei horizontale Walzen c und c' gespannt ist; ganz
nahe an diesem läuft eine Zuführwalze d, deren Umfang
aus einer Anzahl von Ringen besteht, welche, wie man sieht, an ihrem äußern Rand mit
Zähnen versehen sind. Diese Walze nimmt die Wolle oder Baumwolle sammt Kapseln,
Samen etc. auf und führt sie vorwärts zwischen ihrer Peripherie und dem Rost f, welcher den Cylinder nahe genug umgibt, um die Samen
durchpassiren zu lassen. Von da wird die Wolle oder Baumwolle auf den Cylinder e geführt, welcher dicht an dem Cylinder d läuft; er besteht aus Holz, Zinn oder irgend einem
andern Material mit einer abwechselnden Reihe stählerner und pappdeckelner Ringe,
welche seine Peripherie bedecken. Eben so ist es bei dem Cylinder d. Die Hervorragung dieser Stahlringe über die
pappdeckelnen ist bei e', Fig. 48, zu sehen. Sie
haben Kerben oder Zahne an ihrer Peripherie in Zwischenräumen von 1/2 bis 1 Zoll und
mehr. Die Zähne sind hakenförmig und besitzen eine runde erweiterte Gurgel, wie die
Abbildung zeigt. Diese Form der Zähne mit den Zwischenräumen zwischen den
Stahlringen macht, daß die Wolle etc. unter der Oberfläche der Zähne (von denen nie
zwei in benachbarten Ringen einander entgegengesetzt sind) bleibt, während die
Kapseln, Unrath oder Baumwollsamen oben bleiben. Während die Samen den oben
genannten Rost Passiren, rollen sie darüber hinweg; die Fasern aber ziehen sich von
ihnen getrennt, zwischen die Zähne hinein. Oberhalb dieses Cylinders befindet sich
ein zinnerner, eiserner oder stählerner Cylinder g',
dessen Oberfläche in gleichen Distanzen von metallenen Ringen g¹ mit verbindenden Stücken g²
umgeben ist, welche in radialer Richtung stehen, und zwar so, daß sie dicht an der
Oberfläche des Cylinders e laufen und die Kapseln,
Unrath etc. in den Behälter h schaffen. Gegenüber den
Speisewalzen ist ein Bürsten-Cylinder angebracht, welcher die Fasern von den
Zähnen des Cylinders e wegbürstet.
Die Bewegung der Maschine geschieht durch ein über eine Rolle laufendes Band. Die
Rolle befindet sich an der Welle des Cylinders e, an
welcher auch noch eine andere Rolle k sitzt, von der ein
Band zu der Rolle l geht. Letztere ist mit einem
Getriebe m versehen, welches nahe an der Zuführwalze d in einem Zapfen des Gestelles sitzt. An der Achse der
Zuführwalze befindet sich ein Stirnrad n, welches in das
eben genannte Getriebe greift, wodurch die Zuführwalze getrieben wird. An der Achse
der Rolle k befindet sich außen eine große Trommel oder
Rolle o, über welche ein Band zur Rolle p geht. Die Größe dieser Rollen ist in der Art
proportionirt, daß den Bürsten die erforderliche Schnelligkeit mitgetheilt wird. An
der Achse des Bürstencylinders (man kann aber anstatt der Bürsten auch Krämpeln
benützen) befindet sich ebenfalls eine Rolle q, von der
ein starkes Band r zu dem Cylinder g geht, dem er somit seine Bewegung mittheilt. Die Walze
c' erhält ihre Bewegung von der Achse des Cylinders
d, wie die punktirten Linien in Fig. 48 andeuten.
Tafeln