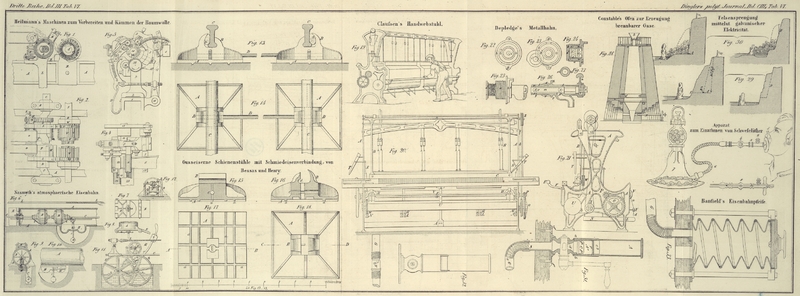| Titel: | Verbesserter Metallhahn, worauf sich John Depledge zu Sheffield am 20. November 1845 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. LV., S. 254 |
| Download: | XML |
LV.
Verbesserter Metallhahn, worauf sich John Depledge zu Sheffield am
20. November 1845 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts, Oct. 1846, S.
168.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Depledge's Metallhahn.
Die Erfindung hat zum Zweck, der Unbequemlichkeit und dem Flüssigkeitsverluste zu
begegnen, der bei gewöhnlichen Faßhahnen stattfindet. Sie besteht in der Anwendung
fester Hahnen, mittelst welcher Fässer in einem Augenblicke angezapft werden können,
ohne einen Tropfen ihres Inhaltes zu verlieren. Der Hahn verschließt das Faß
luftdicht und verhütet so das Ansetzen von Schimmel nach dem Ablassen der Flüssigkeit; zugleich
verhindert seine Einrichtung jedes heimliche Ablassen von Flüssigkeit, indem es,
sobald der Hahn verschlossen und versiegelt ist, Niemanden möglich ist einen Theil
von dem Inhalte des Fasses abzuziehen, ohne daß dieses entdeckt würde.
Die Figuren 22
und 23 sind
Frontansichten des in Rede stehenden Hahns. Fig. 24 ist ein
Durchschnitt des geschlossenen; Fig. 25 zeigt die
Außenseite des geöffneten Hahns nebst einem Theile des dabei angewandten Zapfens.
Fig. 26
ist der Längendurchschnitt des Hahns, a stellt ein
hohles cylindrisches Metallstück mit einer Flansche b am
einen Ende vor; dasselbe kann an seiner Außenseite glatt oder mit Schraubengängen
versehen seyn; auch auf der Innenseite hat es zwei oder drei als Mutterschraube
dienende Gänge c. Ein anderes cylindrisches Metallstück
d paßt in den Theil a
hinein; auf seiner Außenseite hat dasselbe in die Schraubenmutter c eingreifende Schraubengänge; das äußere Ende ist mit
einer Platte oder einem Deckel d* verschlossen, und vor
diesem Deckel befindet sich eine Scheibe e, welche den
Hahnen luftdicht verschließt, wenn das Stück d
eingeschraubt ist. Das letztere besitzt ringsherum Löcher für den Eintritt der
Flüssigkeit; auf jeder Seite hat dasselbe zugleich einen Schlitz g zur Aufnahme eines von dem Zapfen hervorragenden
Bolzens; außen aber ist ein Nagel h angebracht, um das
Ausschrauben zu verhindern. i ist eine Scheibe, um den
Hahn zu verschließen, wenn der Zapfen herausgenommen ist; diese Scheibe dreht sich
um einen Bolzen i*, und ein Siegel kann auf sie gedrückt
werden, um ein etwaiges Ablassen von Flüssigkeit aus dem Faß zu entdecken. In Fig. 22 ist
diese Scheibe geschlossen, in Fig. 23 geöffnet
dargestellt. Die Scheibe kann auch weggelassen und ein Stück Kork in die Oeffnung
des Hahns gesteckt werden. Bei j, j hat der Hahn
Schraubenlöcher, damit er an den Boden des Fasses angeschraubt werden kann. Der zu
dem Hahn gehörige Zapfen (Fig. 25 und 26) besteht
aus einem hohlen eisernen Cylinder mit einer Lilie oder einem Stöpsel m, der sich durch einen Schlüssel n umdrehen läßt. Durch den Körper des Stöpsels geht ein Canal, dessen
Mündungen bei o, o sichtbar sind, und wenn der Hahn
offen ist, den Oeffnungen p, p* gegenüberstehen, wenn er
geschlossen ist, nach der entgegengesetzten Seite gerichtet sind. Rings um den
Zapfen läuft eine breite Rinne q, q, welche beim
Einsetzen des Zapfens in den Hahn die Flüssigkeit, die durch die Löcher l eingetreten ist, zu der Oeffnung p leitet. An dem Zapfen sind zwei Hervorragungen oder
Bolzen r, r (s. die Endansicht Fig. 27) angebracht,
welche in den Schlitz g des Cylinders d einpassen. Wenn nun der Zapfen in den Hahn eingesetzt
und an seinen Platz geschraubt ist, so kann der Cylinder d
abgeschraubt oder rückwärts gedrängt werden, wodurch sich der Hahn öffnet; durch die
umgekehrte Drehung wird der Zapfen entfernt und der Hahn geschlossen. Um den Zapfen
in dem Hahn wasserdicht einzusehen, kann man ihn bei s
mit einem Bande oder einer Liederung von Kautschuk, Gutta-percha oder
dergleichen versehen, welche Stoffe wegen ihrer Elasticität in die ersten Gänge der
Schraube c des Hahns eintreten und so gut als eine
metallene Schraube gelten; es kann übrigens auch dieser Theil aus Metall gemacht und
eingeschraubt werden. An dem Hals des Hahns befindet sich ein Ohr oder ein Lappen
mit einem Loche, und ein entsprechendes Ohr befindet sich auf der Flansche b, um beide mittelst eines kleinen Vorlegeschlosses
vereinigen zu können.
Tafeln