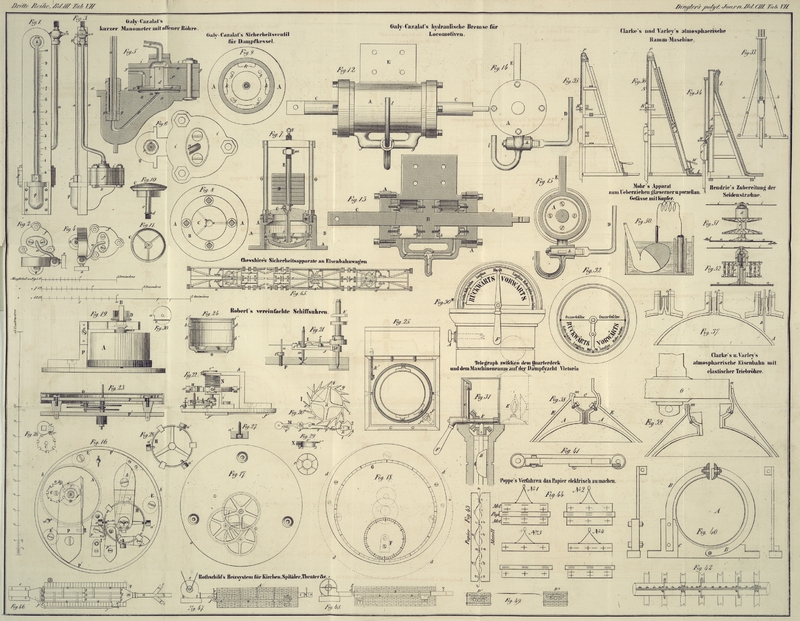| Titel: | Ueberziehen gläserner und porzellanener Gefäße mit Kupfer; von Dr. Mohr in Coblenz. |
| Autor: | Dr. Karl Friedrich Mohr [GND] |
| Fundstelle: | Band 103, Jahrgang 1847, Nr. LXXXI., S. 361 |
| Download: | XML |
LXXXI.
Ueberziehen gläserner und porzellanener Gefäße
mit Kupfer; von Dr. Mohr in
Coblenz.
Mit einer Abbildung auf Tab. VII.
Mohr, Verfahren gläserne etc. Gefäße mit Kupfer zu
überziehen.
Auf der Industrieausstellung zu Paris im Sommer 1844 waren gläserne und porzellanene
Gefäße aller Art ausgestellt, die mit einem sehr gleichmäßig dicken fest anliegenden
Ueberzuge von Kupfer umgeben waren. Die Schönheit des Ueberzuges ließ nichts zu
wünschen übrig. Es wurde gerühmt und war auch einleuchtend, daß diese Gefäße einer
raschern Hitze ohne zu springen, insbesondere gut der Weingeistflamme ausgesetzt
werden konnten. Man fand hier Kolben, Retorten, Abdampfschalen, Kaffee- und
Theekannen mit einem festanschließenden Kupferüberzuge. An den Schalen war der
Ueberzug zum Losmachen (à détache). Es war
einleuchtend, daß diese Kupferschichte nur auf galvanischem Wege aufgetragen seyn konnte; um
indessen doch eine Andeutung darüber zu erhalten, kaufte ich einen gläsernen Kolben,
der bis an den Hals mit Kupfer überzogen war, mit Auslassung dreier Kreise in der
obern Hälfte, um in den Kolben hineinsehen zu können; ferner eine Abdampfschale,
deren untere Fläche bis auf einen Zoll vom Rande verkupfert war. Innerhalb des
Kolbens konnte man die anliegende Kupferfläche durch das Glas sehen. Sie schien
weißlich von Farbe und mit geraden Streifen versehen zu seyn, gerade als wenn
viereckige Stanniolblätter aufgetragen wären. Der Kupferüberzug der Porzellanschale
ließ sich ganz ablösen, was die Form der Schale erlaubte. Hier konnte man nun die
innere Fläche des Kupfers ganz frei, ohne anliegendes Glas sehen. Allein hier ließ
sich auch keine Andeutung über die Natur der ursprünglichen metallischen Unterlage
entnehmen; das rothe Kupfer war ohne alle Striche, ohne den Glanz des falschen
Blattgoldes, ganz rein an dem Porzellan anliegend. Da ich aus dieser Untersuchung
keinen bestimmten Schluß über die Natur der metallischen Unterlage erhielt, so
beschloß ich auf eigener Bahn diesen Gegenstand zu verfolgen. Einen gläsernen
Setzkolben überstrich ich ganz dünn mit Copalfirniß, und als dieser ein wenig
getrocknet war, belegte ich diese Stellen mit falschem Blattgolde, welches in
Nürnberg und Fürth in großen Mengen gemacht wird und sehr wohlfeil im Handel zu
haben ist. Das Blattgold haftet auf den nicht ganz trockenen Stellen mit
Hartnäckigkeit. Es ist schwierig, diesen Beleg schön und glatt zu machen, weil die
ebenen Metallblättchen viele Falten schlagen, wenn sie über eine gewölbte Fläche
aufgezogen werden. Es entstehen dadurch immer Rippen und auch wohl Blößen, die man
auf dieselbe Weise mit Blattgold belegt. Den überzogenen Gegenstand setzt man in
grellen Sonnenschein oder in dem Trockenofen zum Trocknen des Firnisses hin. Das
Blattgold hat Risse und Poren genug, um dieses zu gestatten. Nun füllt man das Gefäß
mit Wasser und verstopft es, damit es in der Kupfervitriollösung untersinke.
Nöthigenfalls gibt man noch Schrote oder sonst schwere Körper in das Gefäß. Die
Ueberziehung mit Kupfer geschieht in der bekannten galvanoplastischen Art. Man wählt
ein steinzeugenes weites Gefäß, worin der zu überziehende Gegenstand untergetaucht
werden kann, füllt es mit einer concentrirten Lösung von Kupfervitriol an, seht eine
poröse Thonzelle mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt hinein und verbindet den von
der Zinkstange in der Zelle herkommenden Draht mit der metallischen Oberfläche des
zu überziehenden Gefäßes. Das Ende dieses Drahtes schmilzt man mit Siegellack in
eine Glasröhre ein, damit es sich nicht selbst mit Kupfer dick belege und dadurch die Flüssigkeit
unnützer Weise erschöpfe, sowie auch den Strom von dem Gefäße ableite. Das zu
überziehende Gefäß wird öfter umgelegt, um alle Stellen gleich dick zu überziehen.
Das Kupfer legt sich immer an der Stelle am stärksten an, die dem Thoncylinder am
nächsten ist. In Ermangelung einer porösen Thonzelle kann man auch ein Glas mit
abgesprengtem Boden anwenden, an dem man den Boden durch eine darüber gespannte und
dicht verbundene Thierblase ersetzt hat. In die Kupferlösung hängt man das Ende
eines leinenen Beutels, der Krystalle von Kupfervitriol enthält. Die Flüssigkeit
hält sich dadurch immer gesättigt. Nach 3 bis 4 Tagen ist die Kupferschichte dick
genug.
Fig. 50
stellt die ganze Zusammenstellung des Apparats im Durchschnitte dar. Eine kleine
Retorte erscheint zur Ueberkupferung eingesetzt.
Nachdem dieser Versuch gut gelungen war, obgleich die Oberfläche des Kupfers nicht
die ganze Glätte und Reinheit des Pariser Fabricats hatte, wurden fernere Versuche
mit dem Auftragen der metallischen Grundlage gemacht.
Die mit Copalfirniß bestrichenen Gefäße wurden mit metallischem Kupfer, welches durch
Reduction mit Wasserstoffgas und Kupferoxyd bereitet war, bestreut und vollkommen
damit überzogen. Nach dem Trocknen wurde das Gefäß der Ueberkupferung ausgesetzt und
auch so ein gutes Resultat erhalten. In gleicher Art wurde Messingfeile aufgestreut.
Die Ueberkupferung war viel rauher, aber auch noch brauchbar.
Endlich wurde gewöhnliche Bronze genommen und dadurch das beste Resultat auf dem
leichtesten Wege erhalten. Die mit Copalfirniß dünn überstrichenen Gefäße wurden mit
einem weichen in Bronze getauchten Haarpinsel überpudert und zuletzt vollkommen
damit überstrichen. Der Ueberzug ist goldfarbig glänzend. Im durchscheinenden Lichte
steht man viele Lücken und helle Punkte, aber diese hindern nicht daß sich der
Kupferüberzug vollkommen gedeckt absetze, nachdem der Firniß vorher scharf
getrocknet war. Der Kupferüberzug war sehr glatt und dicht und ließ sich mit
Bimsstein, Sandstein, Sandlappen, Feilen und Kratzen abputzen und Poliren, und nahm
die schönste Politur des Kupfers an.
Ich habe in dieser Art Kolben, Retorten, Abdampfschalen, Kaffeekannen,
Porzellantiegel, Glasröhren und ähnliche Dinge mit Kupfer überzogen und
mannichfaltigen starken Gebrauch von denselben gemacht.
In den verkupferten Gefäßen kann man über der Weingeistlampe mit starker Flamme und
lebhaftem Holzkohlenfeuer alle Flüssigkeiten zum Kochen erhitzen, auflösen und
destilliren. Auch gegen mechanische Verletzungen sind die Gefäße stärker, obgleich man nicht
zu sehr darauf rechnen soll, da der Ueberzug doch niemals sehr dick ist.
Die Kosten dieser Procedur sind im ganzen gering und das Gelingen keinem Zweifel
unterworfen. Bei Abdampfschalen ist es minder gut anzuwenden, weil bei diesen der
Kupferüberzug sich nicht durch Umschließen und Uebergreifen festhalten kann, sondern
leicht als Calotte ablöst. Man muß nun die ursprüngliche Lage des Ueberzugs wieder
aufsuchen, wenn derselbe dicht anschließen soll. Ohnedieß ist eine Luftschichte
dazwischen und der Zutritt der Wärme eher gehindert als gefördert.
Tafeln