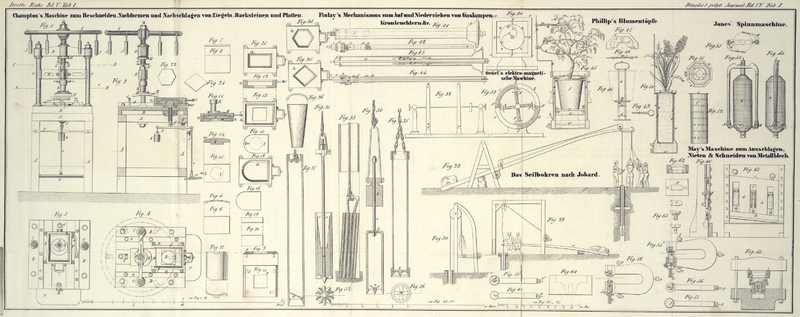| Titel: | Verbesserte Blumentöpfe mit Zugehör, worauf sich George Phillips, Chemiker in Park-street, Grafschaft Middlesex, am 17. August 1846 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XXI., S. 69 |
| Download: | XML |
XXI.
Verbesserte Blumentöpfe mit Zugehör, worauf sich
George Phillips,
Chemiker in Park-street, Grafschaft Middlesex, am 17. August 1846 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts, Mai 1847, S.
260.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Phillips' Blumentöpfe.
Die Erfindung besteht darin, die Töpfe worin Pflanzen gezogen werden, in ein
metallenes Gehäuse so einzuschließen, daß ein Behälter unter dem Topf entsteht,
welcher die aus letzterm abtropfende Flüssigkeit aufnimmt; dadurch wird nicht nur
die Verdunstung des Wassers großentheils verhindert, sondern die Wurzeln der Pflanze
werden auch frei von überflüssiger Feuchtigkeit erhalten und der Atmosphäre ist
freier Zutritt zu den Wurzeln gestattet. Dabei kann man übrigens die Blume entweder
in einen gewöhnlichen irdenen Gartentopf oder in einen durchlöcherten Metalltopf
pflanzen. Von den abgebildeten Apparaten dient der eine für kräuterartige Pflanzen,
wie Pelargonium und der andere für knollige Wurzeln,
z.B. Hyacinthen.
Fig. 45 ist
ein senkrechter Durchschnitt durch die Mitte eines Apparats, wobei ein gewöhnlicher
irdener Gartentopf angewandt ist. a, a, a ist das äußere
Gehäuse, vorzugsweise aus Zink verfertigt; dasselbe kann auf der Außenseite lackirt,
bemalt etc. werden. b, b, b ist ein beweglicher
Metallrahmen, in Fig. 46 in der Seitenansicht abgebildet; er besteht aus zwei senkrechten
Seiten, welche an ihren unteren Enden durch Querstreben b*,
b* verbunden sind, und ist an den oberen Enden mit Ringen oder Griffen e, e versehen, damit man den Rahmen leicht aus dem
Gehäuse nehmen kann. An den inneren Seiten der verticalen Theile b, b sind Leisten d, d
gebildet, um ein Holzstück c zu halten, auf welches man
den Gartentopf stellt; auch sind mehrere Leistenpaare vorhanden, damit man das
Holzstück c in verschiedenen Höhen je nach der Größe des
Topfs anbringen kann. Nachdem der Gartentopf f, in
welchen die Blume gepflanzt wurde, auf die hölzerne Stütze c gestellt worden ist, läßt man den beweglichen Rahmen b, b mittelst der Griffe e,
e in das Gehäuse a, a hinab. Die Griffe e, e werden dann niedergebogen, wie man in Fig. 45 sieht,
und wenn der Topf f für den Rahmen zu klein ist, drückt
man kleine Keile f*, f* aus Kork zwischen die Seiten des
Topfs und die verticalen Rahmentheile b, b um den Topf
in der Mitte des Gehäuses fest zu halten. Man sieht daß zwischen dem unteren Theil des Blumentopfs
f und dem Boden des Gehäuses a ein beträchtlicher Raum ist, welcher einen Behälter für das aus dem Topf
abtropfende Wasser bildet; das Wasser welches sich von Zeit zu Zeit darin ansammelt,
lauft ab wenn man den Pfropf g herauszieht; mittelst der
engen Röhre oder Schnepfe h, welche gegen das Reservoir
offen ist, kann man sich leicht von der Höhe des Wasserstands überzeugen. Wenn das
Wasser im Reservoir die in der Figur durch punktirte Linien bezeichnete Höhe
erreicht, muß es durch Herausnehmen des Pfropfs g
abgezogen werden; da dieses Wasser aber eine beträchtliche Portion der unorganischen
Salze enthält, welche aus der Erde ausgewaschen wurden und die einen Theil der
Nahrung der Pflanze bilden, so muß man es wieder auf die Dammerde im Topf gießen,
damit diese Salze nicht unbenutzt verloren gehen; um eine zu rasche Verdampfung des
Wassers zu verhindern, ist der Topf mit einem Deckel von eigenthümlicher
Construction versehen, zwischen dessen beweglichen Theilen der Stengel der Pflanze
durchgehen kann. Dieser bewegliche Deckel besteht aus zwei Theilen, welche
aneinanderpassen und den Stengel der Pflanze einschließen; eine Hälfte dieses
Deckels zeigt Fig.
47 besonders im Grundriß und Fig. 48 in der
Seitenansicht. Er besteht aus einem flachen Zinkstück i,
i, dessen äußerer Rand an den inneren Rand des Gehäuses a paßt und welches auf einer Leiste aufliegt, wie Fig. 45 zeigt;
so daß, wenn das zweite oder entsprechende Stück i, i
auf die Leiste gelegt wird, das Gehäuse ganz zugedeckt ist. Ein verschiebbares mit
einem Knopf versehenes Stück j, j ist an dem Stück i, i angebracht, so daß es auf demselben gleitet und
sich folglich der Dicke und Stellung des Stengels der Pflanze anpassen kann.
Da die meisten Blumen während des Wachsens einige Unterstützung erfordern, so ist das
untere Ende eines verticalen Drahts in eine im oberen Ende des Gehäuses angebrachte
Dille gesteckt und dieses verticale Stäbchen mit einer, zwei oder mehr Federfängern
oder Hältern l und m
versehen, um die Zweige, Blätter oder Blumen der Pflanze zu stützen oder
zurückzuhalten. Diese Hälter sind aus dünnem Draht hergestellt und können so
angefertigt werden, daß sie entweder (wie bei l) das
Ganze der Zweige umfassen oder (wie bei m) bloß einen
besondern Zweig, einen Stiel oder eine Blume zurückhalten oder stützen. Die Enden
des großen Federhälters l sind bloß zusammengehäkelt,
wie Fig. 45
zeigt; die des kleineren Hälters werden hingegen durch Verschieben eines kleinen
Rings längs der Arme geöffnet oder geschlossen, wie Fig. 49 zeigt.
Bisweilen mag es wünschenswerth seyn, den Apparat so compendiös als möglich zu
machen, z.B. zum Ziehen von Hyacinthen und andern knolligen Wurzeln. Man benutzt
dann anstatt des gewöhnlichen irdenen Topfs einen durchlöcherten metallenen Topf.
Ein solcher Apparat ist in Fig. 50 im senkrechten
Durchschnitt und in Fig. 51 im Grundriß abgebildet. a, a ist das
äußere Gehäuse wie in Fig. 45; f, f ist der metallene am Boden und den Seiten
durchlöcherte Topf, welchen man in Fig. 52 im Aufriß sieht.
Derselbe ist an feinem oberen Ende mit einem Vorsprung o,
o versehen, womit er auf der Schulter des äußeren Gehäuses aufliegt; der
Raum unter dem Topf f dient (wie im andern Apparat) um
das Wasser aufzunehmen welches von der Erde im Topf abtropft. Damit das Wasser keine
Erde aus dem Topf in den darunter befindlichen Raum mit sich reißen kann, ist der
Topf mit einem Sack p, p aus Flanell versehen, in
welchen man die Erde für die zu ziehende Pflanze gibt. Uebrigens wird der Apparat
wie der vorhergehende mit Deckeln und Federhältern versehen.
Tafeln