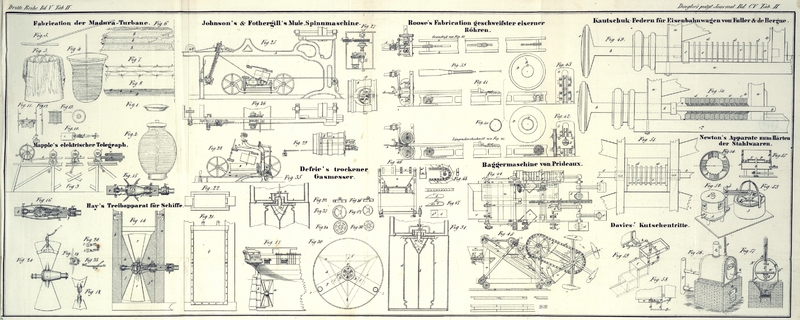| Titel: | Verbesserte Kutschentritte, worauf sich David Davies, Wagenfabrikant zu London, einer Mittheilung zufolge am 17. Sept. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 105, Jahrgang 1847, Nr. XXVI., S. 92 |
| Download: | XML |
XXVI.
Verbesserte Kutschentritte, worauf sich David Davies, Wagenfabrikant zu
London, einer Mittheilung zufolge am 17. Sept.
1846 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts, Mai 1847, S.
247.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Davies' Kutschentritte.
Den Gegenstand vorliegender Erfindung bildet eine geometrische Anordnung paralleler
Hebel, welche durch Drehung einer Achse in Bewegung gesetzt werden, um die auf ihnen
befestigten Tritte zu heben oder niederzulassen; die Welle kann mittelst einer
Kurbel oder durch das Oeffnen und Schließen des Kutschenschlags gedreht werden.
Fig. 58 zeigt
den Kutschentritt, wie er von der hinteren Seite des Wagens aus betrachtet
erscheint; Fig.
59 ist eine perspectivische Ansicht desselben. Unter dem Wagenkörper ist
zu beiden Seiten eine viereckige eiserne Büchse a
befestigt, welche den Tritt und seine Hebel in geschlossenem Zustande aufnimmt. b, b sind zwei Hebel welche bei c durch Bolzen mit dem Rahmen a verbunden
sind; d, d zwei ähnliche an die viereckige Achse e befestigte Hebel; die Achse e dreht sich in Lagern an der Seite des Rahmens a: f ist der auf zwei
Stäben g, g gelagerte Tritt. In Folge dieser Anordnung
werden sich die Stäbe b und d stets parallel zu einander und die Stäbe g
parallel zum Rahmen a bewegen. An dem einen Ende der
Achse e ist rechtwinkelig zu den Stäben d ein Hebel h befestigt. Das
Ende dieses Hebels ist durch ein Gelenk mit dem gabelförmigen Ende einer Stange i und diese durch ein anderes Gelenk mit einem an den
Kutschenschlag befestigten Träger k verbunden. Wenn der
Schlag geschlossen ist, so sind die Stäbe b, d und der
Tritt f in der Büchse a
eingeschlossen, der Stab i befindet sich in geneigter
und der Hebel h in verticaler Lage. wird aber der Schlag
geöffnet, so zieht der Theil k vermittelst des Gelenks
j die Stange i vorwärts;
diese bringt den Hebel h in horizontale Lage und
veranlaßt die Achse e die Stäbe b, d zu drehen und niederzudrücken, bis sie in die verticale Stellung
gelangen. Somit gelangen die verschiedenen Theile beim Oeffnen des Schlags in die
abgebildete Lage, lehren aber beim Schließen des Schlags in ihre ursprüngliche Lage
zurück. Eine starke auf die quadratische Welle e
drückende gebogene Stahlfeder! erhält den Tritt, er mag sich oben oder unten
befinden, in sicherer Lage; bei mehr als einem Tritt sind zwei solche Federn
anzuwenden. Aus den punktirten Linien in Fig. 59 ersieht man, daß
sich die Anwendung dieser Erfindung nicht auf einen einzigen Tritt beschränkt,
sondern auf eine beliebige Anzahl derselben ausgedehnt werden kann. Bei Wagen ohne
Thüren, z.B. Phaetons, kann man den Tritt mittelst Drehens einer an dem Hebel h angebrachten Kurbel herunterlassen.
Tafeln