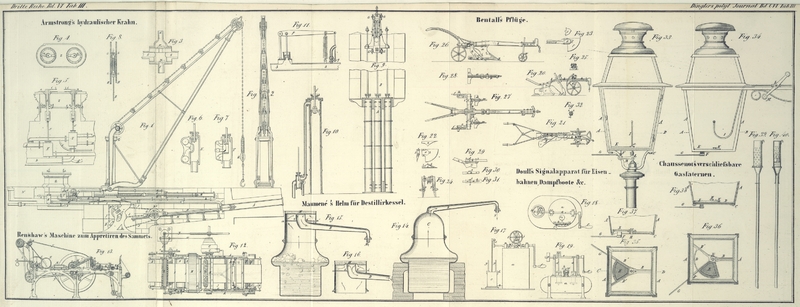| Titel: | Armstrong's hydraulischer Krahn. |
| Fundstelle: | Band 106, Jahrgang 1847, Nr. XX., S. 92 |
| Download: | XML |
XX.
Armstrong's hydraulischer
Krahn.
Aus dem Practical Mechanic and Engineer's Magazine, Mai
1847, S. 171.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Armstrong's hydraulischer Krahn.
Der im Folgenden zu beschreibende hydraulische Krahn ist auf dem Quai von Newcastle
in Gebrauch.
Fig. 1 stellt
den Krahn in der Seitenansicht,
Fig. 2 in
einer rechtwinkelig zu Fig. 1 genommenen Ansicht
dar.
A ist ein Cylinder mit einem wasserdicht an die
Kolbenstange B befestigten Kolben. C, C ist eine Speisungsröhre, welche mit der
Hauptzuleitungsröhre D communicirt und durch welche das
Wasser in den Cylinder gepreßt oder aus demselben gelassen wird. Die Richtung der
Bewegung des Wassers wird durch ein Schieberventil E
bestimmt. D¹, D² und D³ sind drei Rollen, von
denen zwei, nämlich D¹, D² sich in festen Lagern drehen, während die andere D³ mit einem an dem Ende der Kolbenstange B befestigten Wagen F sich
bewegt. Der Wagen F liegt auf Frictionsrollen G, G, von denen zwei an jeder Seite des Wagens
angebracht sind und auf Schienen H, H laufen. I ist eine hohle gußeiserne, das feste Centrum bildende
Säule, um welche die beweglichen Theile des Krahns sich drehen; t, t, t ein an das Fundament festgeschraubtes
gußeisernes Gestell, an das die Säule I befestigt ist;
J, J die Kette, woran die Last hängt; diese Kette
geht durch die Mitte der Säule abwärts, läuft über die Rollen D¹, D², D³ und ist an das eine Ende des Schlittens oder Wagens F befestigt. Wenn man nun das aus irgend einer
hinreichend hochgelegenen Quelle in die Röhre D
geleitete Wasser durch die Speisungsröhre C, C in den
Cylinder A läßt, so wird durch den Wasserdruck Kolben
nebst Stange B in Bewegung gesetzt. Dadurch wird die an dem Ende der Kette
befestigte Last gehoben, wobei die Strecke der Kolbenbewegung vermittelst der Rollen
D¹, D²,
D³ verdreifacht erscheint, so daß die Last
auf eine Höhe gehoben wird, welche dem dreifachen Kolbenhub gleichkommt. Läßt man
aber das Wasser durch die Röhre C, C aus dem Cylinder
A entweichen, dadurch, daß man den mit einer
Ausflußröhre L communicirenden Canal in der Büchse E öffnet, dagegen den mit der Hauptröhre D communicirenden schließt, so kehrt der Kolben wieder
in seine vorherige Lage zurück und die Last sinkt herab. Der Cylinder A ist in geneigter Lage angeordnet, damit das Gewicht
des Schlittens F mit seinen Rollen und Zugehör das
Straffziehen der Kette mittelst des Gegengewichtes K
erleichtere. Um den Krahn gleichfalls vermittelst hydraulischer Wirkung nach beiden
Richtungen zu wenden, bedient man sich eines Cylinders M. Dieser Cylinder enthält einen Kolben, der sich von dem oben beschriebenen
dadurch unterscheidet, daß er sich nach beiden Seiten bewegt, je nachdem der Druck
des Wassers auf die eine oder die andere Seite des Kolbens gerichtet ist. Die Stange
dieses Kolbens ist mit der zwischen Führungen O, O
gleitenden Zahnstange N verbunden. Diese Zahnstange
greift in eine an dem unteren Rande des Halses P
angebrachte Verzahnung. An diesen Hals und den Theil Q
ist das Gestell des Schnabels befestigt. R, R und S, S sind die Röhren, durch welche das Wasser in oder
aus dem Cylinder M gedrückt wird. Der Zu- und
Abfluß des Wassers wird mittelst eines Schieberventils T
regulirt. U, V sind zwei an jeder der Röhren R, R und S, S des Cylinders
M befestigte Ventile, welche verhüten, daß die
Wendung des Schnabels beim Schluß des Schieberventils T
zu plötzlich angehalten werde. Fig. 3 stellt eines dieser
Ventile U mit einem Theile einer der Röhren S im Durchschnitte dar. d
ist eine kleine mit der Hauptröhre D communicirende
Röhre und I eine kleine mit der Ausflußröhre L und der Cisterne W
communicirende Röhre. Die Cisterne W wird durch das aus
den Cylindern A und M
abfließende Wasser gefüllt erhalten. Die Ventile U, V
sind, wie Fig.
3 zeigt, mit Klappen X und Y versehen, die sich aufwärts öffnen. S, S ist ein Theil einer der Speisungsröhren, welche von
der Ventilbüchse T nach dem Cylinder M führen. Die Wirkungsweise dieser Ventile ist folgende.
Angenommen, der Schnabel des Krahns drehe sich in Folge der Wirkung des Wassers auf
den Kolben des Cylinders M und die Röhre S wirke in Beziehung auf den Cylinder M als Ausströmungscanal, so würde beim plötzlichen
Schließen des Schiebventils in der Büchse T das Wasser
an der Ausströmungsseite des Kolbens keinen Ausweg mehr finden und daher die
Fortbewegung des Kolbens plötzlich hemmen; der ganze in der Drehung begriffene Apparat würde
in Folge des Trägheitsmomentes der bewegten Masse einen heftigen Stoß erleiden,
würde die Klappe X nicht dem Wasser einen Ausweg
darbieten und demselben den Rückfluß in die Hauptröhre D
gestatten, sobald nämlich die durch das Moment des Krahnschnabels veranlaßte
Compression stark genug geworden ist, um das Ventil gegen den Widerstand der auf
seine obere Seite wirkenden Wassermasse zu heben. Auf diese Weise erfolgt das
Anhalten des Kolbens nicht plötzlich, sondern allmählich, und der Krahn wird zwar
rasch aber ohne Stoß in Stillstand gebracht.
Verhalt sich dagegen die Röhre S rücksichtlich des
Cylinders M als Einströmungscanal, so würde beim
Schließen des in der Büchse T befindlichen
Schieberventils und während das Trägheitsmoment noch fortwährend Bewegung ertheilt,
Wasser durch die Klappe Y aus der Cisterne W aufgesaugt werden, um den luftleeren Raum zu erfüllen,
welcher sonst an der Einströmungsseite des Kolbens entstehen würde. Es erhellt
somit, daß durch Anbringung eines Ventils der erwähnten Art an beiden Wasserwegen
R, R und S, S des
Cylinders M der schädliche Einfluß des Trägheitsmomentes
des Schnabels beseitigt ist, nach welcher Richtung sich auch der Kolben bewegen
möge. Der Cylinder bleibt zugleich zu beiden Seiten des Kolbens stets mit Wasser
gefüllt, welches daher in dem Augenblick, wo das Admissionsventil wieder geöffnet
wird, von dem erneuerten Druck einen unmittelbaren Impuls empfängt.
Z, Fig. 1, ist die
Indicatortafel, deren Inneres so eingerichtet ist, daß der Maschinist, welcher die
Zeiger mittelst der an denselben angebrachten Kurbeln dreht, die Operation des
Krahns vollkommen controliren kann, indem die Kurbel und der Zeiger zur Rechten die
rotirenden Bewegungen, die zur Linken die Operationen des Hebens und Niederlassens
leiten. Der ganze Apparat Fig. 1, mit Ausnahme des
Schnabels und der Säule des Krahns, sowie der Zeigertafel ist unter dem Boden
angebracht, und die den Mechanismus einschließende Vertiefung ist mit Brettern
bedeckt.
Fig. 4 liefert
eine hintere Ansicht des Schnabels und der Säule des Krahns.
Die in Fig. 9
dargestellte Anordnung hat den Zweck, verschiedene Kraftabstufungen beim Heben
mittelst hydraulischen Drucks zu erzielen. Wird der geringste Grad der Kraft
erfordert, so läßt man das Wasser in den mittleren Cylinder allein einströmen.
Während nun die Rolle durch die mittlere Kolbenstange B
fortbewegt wird, bleiben die beiden äußeren Kolbenstangen, deren jede durch ein in
dem Querstück befindliches Loch geht, in Ruhe, das Querstück aber gleitet längs derselben fort. Ist die
zweite Kraftstufe erforderlich, so läßt man das Wasser in die beiden äußeren
Cylinder und sperrt es von dem mittleren ab. In diesem Falle übt der mittlere
Cylinder A keine Kraft auf die Rolle aus, wogegen die an
ihren äußersten Enden mit Knöpfen versehenen Kolbenstangen der äußeren Cylinder mit
vereinter Kraft auf das Querstück und die mit demselben verbundene Rolle wirken, und
die mittlere Kolbenstange nur mit sich nehmen. Wird endlich die Kraft aller drei
Cylinder verlangt, so läßt man das Wasser gleichzeitig in alle drei eindringen und
die drei Kolbenstangen wirken alsdann gemeinschaftlich auf die Rolle. Fig. 10 ist
der Durchschnitt eines dieser Cylinder.
Fig. 4 ist der
obere Theil der Zeigertafel Z und Fig. 5 der übrige Theil
des mit der Zeigertafel verbundenen Apparates. Die Kurbel i ist an einer Stange b befestigt, die sich
unten in einer Schraube in dem hohlen Kopfe m der
Ventilstange x endigt. Der Zeiger n sitzt an einem Rohre, das sich frei um die Stange b dreht und ein Rad h enthält. Ein an der
Achse b befestigtes Getriebe g greift in ein Rad k, dessen Getriebe j in jenes an dem Rohre befestigte Rad h greift, so daß, während die Kurbel i eine hinreichende Anzahl von Umdrehungen macht, um das
Schieberventil von einem Ende seines Laufs bis zum andern zu bewegen, die von dem
Zeiger n zurückgelegte Strecke sich auf eine einzige
Umdrehung beschränkt.
Fig. 6 stellt
die Ventilbüchse E und Fig. 7 die Ventilbüchse
T im Durchschnitte dar. Fig. 11 ist eine Art
Sicherheitsventil, welches über der Hauptröhre D
angeordnet werden kann, um dem Bersten der Röhre in Folge einer unvorhergesehenen
Zunahme des Drucks vorzubeugen, welche eintreten könnte, wenn das Wasser aus irgend
einer Ursache plötzlich angehalten werden sollte. Die Kraft des auf den Kolben r drückenden Wassers überwältigt in diesem Falle den
Widerstand einer am Hebel p angebrachten Spiralfeder und
öffnet auf einen Augenblick den Hahn q, wodurch der
erschütternde Stoß gemildert wird.
Tafeln