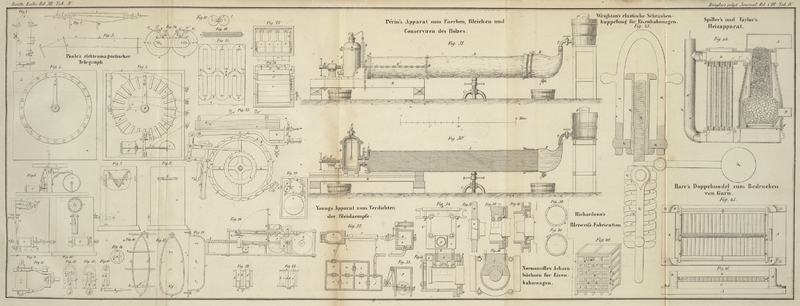| Titel: | Ueber die Verfahrungsarten des Hrn. Renard Périn zum Färben, Bleichen und Conserviren des Holzes; Bericht des Hrn. Payen. |
| Fundstelle: | Band 112, Jahrgang 1849, Nr. XLVI., S. 211 |
| Download: | XML |
XLVI.
Ueber die Verfahrungsarten des Hrn. Renard Périn zum
Färben, Bleichen und Conserviren des Holzes; Bericht des Hrn. Payen.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement, Februar 1849, S. 51.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Périn's Verfahrungsarten zum Färben und Bleichen des
Holzes.
Der Erfinder benutzt zum Tränken des Holzes mit verschiedenen Flüssigkeiten ein
theilweises Vacuum, welches er mittelst des in Fig. 30 und 31
abgebildeten Apparats erzielt.
Das zu injicirende Holz wird gegen den Apparat D
angebracht; derselbe besteht aus einem gußeisernen Cylinder mit einem
aufgeschliffenen Deckel, dessen Oeffnung mittelst eines Metallpfropfs G verschlossen werden kann; der Pfropf ist mit einer
Metallstange verbunden, an deren unterem Ende sich Werg befindet, das mit Weingeist
getränkt wurde. (Hr. Périn wendet jetzt den
Holzgeist als ein wohlfeileres Brennmaterial an.) Unten am Cylinder ist ein Hahn I angebracht. Vor dem Cylinder wird eine Scheibe L angebracht, welche in der Mitte mit einem Loch
versehen ist, das mit dem Innern des Cylinders communicirt. Gegen diese Scheibe muß
der Querschnitt des zu injicirenden Holzstamms angedrückt werden, nachdem man ihn am
Umkreis dieses Endes mit einem schmalen Scheibchen oder Ring von Leder oder
Kautschuk belegt hat. Der Baum ist mit einem eisernen Reif M umgeben, an welchem zwei Ketten angebracht werden, die man mit ihrem
anderen Ende am Cylinder befestigt; letzterer wird nun in Gang gesetzt, d.h.
mittelst einer
Druckschraube E vorwärts oder zurück geschoben; indem
man nämlich diese Schraube mittelst ihres Hebels in der erforderlichen Richtung
umdreht, nähert man die Scheibe dem Holzstück bis zum vollständigen Anschluß; der
zwischen die Scheibe und den Baum eingepreßte Kautschukring verhindert daselbst das
Einziehen der äußeren Luft, während der Zwischenraum, welchen dieser Ring auf dem
Querschnitt des Baumes frei läßt, hinreicht, damit die Saftcanäle durch das im
Apparat mittelst der Verbrennung erzeugte Vacuum ausgesaugt werden können.
Um das andere Ende des Holzstamms wird ein Sack aus undurchdringlichem Zeug R gebunden, welcher mit einem die Flüssigkeit
enthaltenden Recipient P communicirt; erzeugt man nun
das Vacuum im Apparat, so wirkt der Luftdruck auf die Oberfläche der Flüssigkeit und
diese färbende Flüssigkeit dringt folglich in die Canäle des Baums, auf welche der
Cylinder am anderen Ende ansaugend wirkt.
Um das Vacuum herzustellen, senkt man in den Cylinder Werg, welches mit Weingeist
getränkt und dann angezündet wurde. Während der Verbrennung hört man durch den Hahn
I ein starkes Zischen, eine Folge der Ausdehnung der
Luft. Der Arbeiter, welcher den Apparat bedient, muß dabei die Hand auf den Hahn
halten, durch welchen die Luft entweicht; sobald dieses Zischen bedeutend nachläßt,
das Zeichen daß die Verbrennung aufhört, schließt er schnell diesen Hahn, damit die äußere Luft nicht wieder in den Cylinder
eindringen kann.
Bei der Verbrennung des Weingeists entstehen Kohlensäure und Wasserdampf; die
Verdichtung des letztem erzeugt das Vacuum im Cylinder und folglich in den Canälen
des Baums, welcher gegen seine Scheibe angedrückt ist; andererseits wirkt der
Luftdruck auf die im Recipient enthaltene Flüssigkeit, welche daher in die Canäle
einbringt, dieselben in der ganzen Länge des Baums durchlauft und dabei das
hygroskopische Wasser und die Säfte des Holzes vor sich hertreibt.
Hr. Périn hat jetzt seine Anstalt, worin er diesen
merkwürdigen Industriezweig betreibt, außerhalb Paris, nach la Villette verlegt. Das
unbehauene Holz wird in den Höfen und unter einem großen Schoppen niedergelegt, um
nach dem Injiciren und Zuschneiden verkauft zu werden. Drei Handlanger und ein
Färber reichen zum Bedienen der achtzehn Injicir-Apparate hin, welche die
Anstalt enthält; diese vier Arbeiter können in 24 Stunden 60 bis 70 Decisters Holz
zubereiten. Die Sägmühle beschäftigt etwa fünf Arbeiter unter einem Vorarbeiter.
Die Holzarten, welche er hauptsächlich anwendet, sind Rothbuche, Weißbuche, Birnbaum,
Erle und Birke.
Um vollständig gefärbt zu werden, verschluckt ein Stamm durchschnittlich 18 Liter
Flüssigkeit per Decister. Die Menge des Safts, welche
diesen Bäumen entzogen wird, beträgt je nach der Zeit, welche seit ihrem Fällen
verstrich, 10 bis 16 Liter per Decister. Bäume, welche
nach dem Fällen 10 Monate lang unter Dach aufbewahrt wurden, eignen sich noch zum
Injiciren nach diesem Verfahren.
Sogleich nach dem Abrinden läßt sich das Holz vollkommen injiciren, ohne von einem
Cylinder umhüllt zu seyn. Dieß wäre auch der Fall nach dem Behauen; da aber dann die
Holzfasern zum Theil durchschnitten sind, so ist es besser das Holz in einen
Cylinder zu stecken.
Um die Durchdringung eines Holzstammes – derselbe mag mit seiner Rinde
versehen seyn oder nicht, oder auch behauen seyn – zu vervollständigen, kehrt
man ihn um, damit ihn die färbende Flüssigkeit auch noch in der entgegengesetzten
Richtung durchziehen muß.
Zum Färben des Holzes benutzt Hr. Périn dieselben
Beizen und Farbstoffe, welche man gewöhnlich anwendet, um Garn und Zeuge von Flachs,
Hanf und Baumwolle ächt zu färben.
Oft ist es vortheilhaft das Holz, welches gefärbt werden soll, vorher mittelst Chlor,
unterchlorigsaurer Salze etc. zu bleichen, man erzielt dann sicherer die gewünschte
Nüance.
Das auf beschriebene Weise behandelte Holz vereinigt folgende Vortheile: 1) es
trocknet schnell aus, weil ihm der Saft entzogen und durch Lösungen ersetzt wurde,
welche keine zerfließenden Salze enthalten; 2) es schrumpft beim Trocknen weniger
ein, weil die Beizen und Farbstoffe, womit es durchdrungen wurde, zum Theil in
festen Zustand übergehen und die Höhlungen der Holzfasern ausfüllen; 3) es wirft
sich weniger als das natürliche Holz, weil die schwammigen Theile die Farbstoffe
besser verschlucken und von denselben eine größere Menge als die harten Holztheile
fixiren, wodurch die ganze Masse des Holzes eine gleichförmigere Dichtigkeit erhält;
4) solches Holz wird wegen der in sein Gewebe eingetriebenen chemischen Agentien von
Insecten nicht angegriffen; 5) endlich läßt es sich besser poliren und schöner
firnissen, weil seine Poren verstopft sind und sein ganzes Gewebe regelmäßiger
ist.
Der Preis des so zubereiteten Holzes ist nicht hoch; man verkauft für die
Kunst-Tischlerei das Kilogramm zu 25 bis 80 Centimes; für gewöhnliche Möbeln
kommt solches Holz nur etwa um 10 Proc. theurer als das schönste holländische
Eichenholz zu stehen; endlich kostet von solchem zu Furnüren geschnittenen Holze der
Quadratmeter 2 bis 3 Fr.
Erklärung der Abbildungen.
Fig. 30 ist
ein Längsdurchschnitt des Apparats; Fig. 31 der Seitenaufriß
desselben.
A Baumstamm, horizontal gehalten, am einen Ende durch
das Gestell B und am andern durch den Bock C. D gußeiserner Cylinder, in welchem das Vacuum dadurch
hergestellt wird, daß man der in ihm enthaltenen Luft durch Verbrennung ihren
Sauerstoff entzieht; er ist auf dem Gestell B angebracht
und wird auf eben abgerichteten Wangen desselben mittelst der durch den Support F geführten Schraube vorwärts oder zurück geschoben. G gußeiserner Deckel, mit einer Eisenstange versehen, an
deren Ende mit Weingeist getränktes Werg angebracht wird. H Hahn an dem Rohr, welches den Cylinder mit dem einen Ende des Baumstamms
in Verbindung setzt. I Hahn, um den vom Cylinder
angesogenen Holzsaft ablaufen zu lassen. K Manometer, in
Centimetern graduirt; seine Röhre communicirt mit dem Innern des Cylinders D. L Scheibe oder Ring aus Leder oder Kautschuk, an
einem Ende des Baumstamms befestigt. M Kette, mit Haken
und Vorstecknägeln versehen, welche dasselbe Ende des Baums umspannt. N zwei Ketten, nämlich eine an jeder Seite des Gestells
B; mit ihrem einen Ende sind sie an der Kette M und mit dem andern an zwei auf dem Gestell B befestigten Haken gehalten. P Behälter, welcher die färbende Substanz enthält. Q Hahn, um die Verbindung herzustellen zwischen dem Recipient P und einem Sack aus undurchdringlichem Zeug, welchen
man so um den Baumstamm schnürt, daß keine Flüssigkeit entweichen kann. S Hahn, um nach beendigter Operation die im
undurchdringlichen Sack R zurückgebliebene Flüssigkeit
in einen untergestellten Zuber ablaufen lassen zu können.
Tafeln