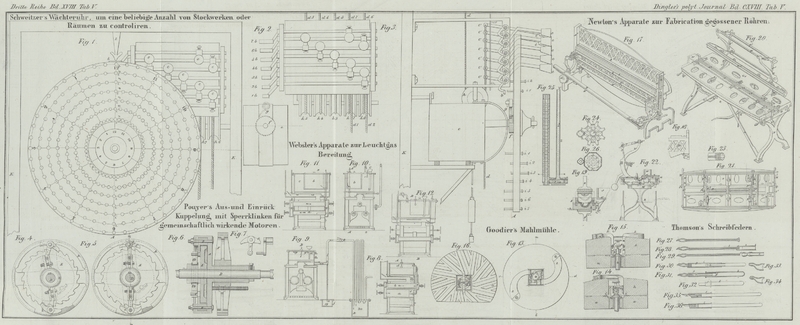| Titel: | Verbesserungen an Schreibfedern, welche sich William Thomson, Civilingenieur in London, am 4. Julius 1849 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 118, Jahrgang 1850, Nr. LXXV., S. 350 |
| Download: | XML |
LXXV.
Verbesserungen an Schreibfedern, welche sich
William Thomson,
Civilingenieur in London, am 4. Julius 1849 patentiren ließ.
Aus dem London Journal of arts, Septbr. 1850, S.
79.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Thomson's Schreibfedern.
Diese Erfindung besteht
1) in der Verfertigung gläserner Schreibfedern;
2) in der Verfertigung elastischer Hälter für gewöhnliche
Stahlfedern.
Fig. 27
stellt eine gläserne Feder im Durchschnitte dar.
Das Instrument besteht aus einem Haarröhrchen von 1/32 Zoll innerer Weite. Das eine
Ende der Röhre ist geschlossen und zu einer Erweiterung aufgeblasen. Die Spitze a wird sodann glühend gemacht und in einen krummen
Schnabel ausgezogen. Die Breite dieses Schnabels und der Durchmesser seiner Oeffnung
bestimmt die Dicke des Federstriches. Der Schnabel wird auf einem Schleifstein mit
Schmirgel oder Diamantstaub geschliffen. Das Instrument wird mit Tinte gefüllt,
indem man die Spitze in die Tinte taucht, den Mund an das obere Ende des Instruments
hält und die Luft aussaugt, worauf sogleich die Tinte in die Erweiterung tritt. Das
Instrument kann nachher umgedreht oder geschüttelt werden, ohne daß die Tinte
ausfließt.
Anstatt die Luft mit dem Munde auszusaugen, kann man sich auch eines künstlichen
Saugstückes bedienen. b, Fig. 28, bezeichnet eine
kurze Metallröhre, welche an dem einen Ende mit einem Ring c von Kaut schuk versehen ist, der luftdicht um den Stiel des Instrumentes
schließt. Wenn nun das Instrument gefüllt werden soll, so bringt man die Röhre b in die punktirte Lage 1 und taucht die Spitze a in die Tinte, schließt dann das obere Ende der Röhre
b mit dem Daumen luftdicht und zieht die Röhre
aufwärts in die Lage 2. Dadurch entsteht an dem oberen Ende des Instrumentes ein
luftleerer Raum, in dessen Folge sich die untere Erweiterung sogleich mit Tinte
füllt. – Fig. 29 zeigt eine Modification dieses Saugstückes. Dasselbe besteht aus
zwei Metallröhren d, e, welche weil genug sind um längs
des Stiels frei gleiten zu können, und durch eine Kautschukröhre f mit einander verbunden sind. Die Enden dieser
elastischen Röhre f sind ausgedehnt, so daß sie die
Röhren d, e dicht umfassen und festhalten; ihr mittlerer
Theil jedoch, welcher nicht ausgedehnt ist, drückt gegen den Stiel des Instrumentes
und bildet eine ähnliche luftdichte Verbindung, wie der Ring c
Fig. 28.
Fig. 30 ist
der Durchschnitt einer Schreibfeder, bei welcher die Tinte vermittelst eines Kolbens
in die erwähnte Erweiterung gesaugt wird. Diese ist mit einem kurzen Stiel versehen,
welcher in das Ende einer Metallröhre g luftdicht
befestigt ist. Indem man nun einen in dieser Röhre befindlichen Kolben aus seiner
tiefsten Lage in die Höhe zieht, saugt dieser die Tinte in die Erweiterung. In der
Röhre g befindet sich eine Oeffnung i, mit deren Hülfe der atmosphärische Druck hergestellt
wird.
Fig. 31 ist
der Längendurchschnitt einer Feder, welche, nachdem sie mit Tinte gefüllt worden
ist, in die Tasche gesteckt werden kann; die Feder ist hier in ausgezogenem
Zustande, zum Gebrauche bereit, dargestellt.
Fig. 32 ist
die äußere Ansicht des Instrumentes in zusammengeschobenem Zustande, worin es in die
Tasche gesteckt werden kann. Der kurze Stiel der Blase ist in dem Ende einer
Metallröhre g befestigt, welche einen Kolben h enthält und an ihrem oberen Ende durch einen
Schraubendeckel j geschlossen ist. k ist ein metallenes Rohr, welches, wie Fig. 31 zeigt, über den
Deckel j paßt, und dazu dient das Instrument zur
gehörigen Länge auszuziehen. Ist dasselbe nicht im Gebrauch, so wird die Röhre k über die Röhre g
geschoben, worauf das Instrument in der compacten Gestalt von Fig. 32 erscheint.
Der Patentträger gibt zwar den gläsernen Schnabelspitzen den Vorzug, bemerkt jedoch,
daß die Schnäbel auch aus werthvollen Steinen verfertigt werden können, welche auf
gewöhnliche Weise geschliffen, gebohrt und wie Fig. 33 zeigt, an
gläserne Blasen gekittet wurden.
Um das Abbrechen der Glasschnäbel zu verhüten, kann, wie Fig. 34 zeigt, ein
kleines Metallrohr über den Schnabel geschoben werden.
Die Figuren 35
und 36
stellen Methoden dar, den Hältern gewöhnlicher
Stahlfedern Elasticität zu ertheilen. Bei dem Fig. 35 dargestellten
Hälter kommt die Feder zwischen die äußere Röhre l und
einen kurzen röhrenförmigen Hälter m, von dessen
hinterem Ende ein Stiel in einen Hals n von
geschwefeltem Kautschuk hineinragt. In Fig. 36 wird die Feder
zwischen die Röhre l und einen Stöpsel o aus geschwefeltem Kautschuk geschoben. Letzterer ist
nur mit seinem inneren Ende an die Röhre l
befestigt.
Tafeln