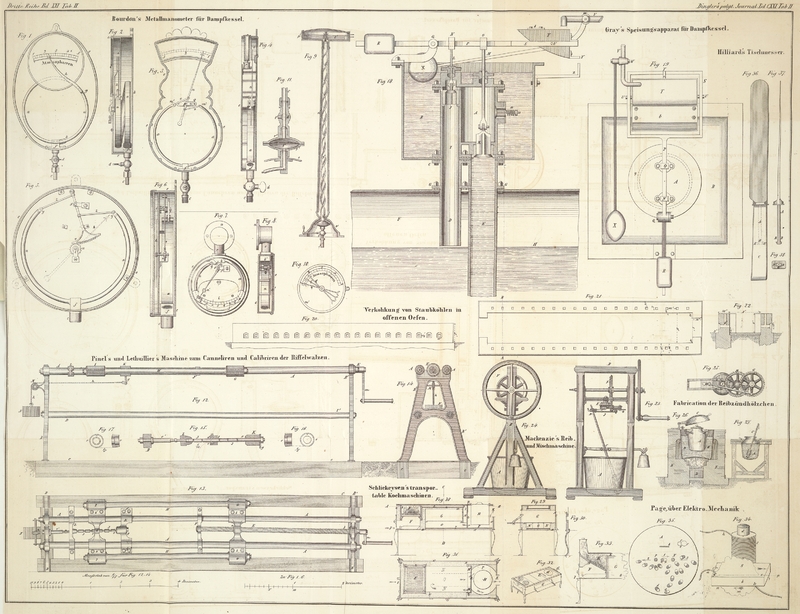| Titel: | Speisungsapparat für Dampfkessel; von Higginbotham und Gray. |
| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. XIX., S. 85 |
| Download: | XML |
XIX.
Speisungsapparat für Dampfkessel; von Higginbotham und Gray.
Aus dem Practical Mechanic's Journal, April 1851, S.
8.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Higginbotham's und Gray's Speisungsapparat für
Dampfkessel.
Die gewöhnlich gebräuchlichen Methoden, den Dampfkesseln das Wasser zuzuführen,
lassen sich in zwei Classen theilen; es werden nämlich entweder Speiseröhren mit
Füllköpfen angewandt, bei denen der hydrostatische Druck wirksam ist, oder einfache
Druckpumpen. Da wo Hochdruckdampf gebraucht wird, steht der erstgenannten
Vorrichtung die Höhe der Füllröhren und der nöthigen Wassersäule entgegen, während
bei Anwendung der Pumpe viele Kraft dadurch verloren geht, daß das Wasser den
bedeutenden Gegendruck im Kessel überwältigen muß, wobei es noch immer sehr
schwierig ist, den Wasserstand im Kessel auf der nöthigen Höhe zu erhalten.
Die vorliegende Erfindung, welche kürzlich Hrn. Matthew Gray in Glasgow patentirt wurde, vermeidet die beiden letztgenannten
Uebelstände, indem bei derselben der Wasserstand des Kessels beständig durch
abwechselnde Condensation von Dämpfen in dem Speisegefäße regulirt wird.
Fig. 18 ist
ein verticaler Durchschnitt des Speisungsapparates, wie derselbe oben auf dem
Dampfkessel aufgesetzt ist; Fig. 19 ist ein Grundriß
desselben.Maaßstab: 1½ Zoll = 1 Fuß.
Ein kurzer Condensationscylinder A ist auf den Boden des
oben offenen Behälters B für das Speisewasser
aufgeschraubt, und dieser Behälter ruht auf der Flansche C der beiden verticalen Röhren D, E. Diese
beiden Röhren sind in einem Stücke gegossen, und reichen in den Kessel F hinab, auf dessen Oberfläche sie durch Schrauben
befestigt sind, welche durch die Flansche G gehen. Das
offene untere Ende der Röhre D erstreckt sich gerade nur
bis zur Oberfläche H des Wassers im Kessel, wenn
derselbe bis zur richtigen Höhe gefüllt ist; und das obere Röhrenende schließt sich
an die Röhre I an, welche mit dem Cylinder A aus einem Stücke gegossen ist. Dieselben Schrauben
dienen sowohl um die beiden Röhren D und E, als auch um den Cylinder A mit dem Boden des Wasserbehälters B zu
verbinden. Die zwei Röhren D und I bilden so einen einzigen ununterbrochenen Canal, welcher vom Kessel aus
oben in den Cylinder A führt. Das obere Röhrenende ist
mit einem conischen Ventil J versehen, welches sich nach
unten zu öffnet. Die zweite Röhr E reicht beinahe bis
zum Boden des Kessels hinab, und ist unten ebenfalls offen, während ihre obere
Mündung durch ein ähnliches, nach unten sich öffnendes Ventil K, welches nur größer ist, verschlossen wird. Die beiden Ventile sind mit
Verbindungsstangen L, M versehen, welche durch am
Cylinderdeckel angebrachte Stopfbüchsen gehen, und oben mit durchbrochenen Köpfen
N, O versehen sind, die dieselben mit dem Hebel P zusammenhängend machen. Dieser Hebel dreht sich um
eine Achse Q, welche von einer Stütze getragen wird, die
oben auf den Wasserbehälter B aufgeschraubt ist. Der
kürzere Hebelarm ist mit einem verstellbaren Gegengewichte R versehen. Der längere Hebelarm bildet einen rechtwinkeligen Rahmen S, welcher zur Aufnahme eines im Gleichgewicht
gehaltenen Kastens T von Eisenblech bestimmt ist. Dieser
Kasten läßt sich um die Achse U in dem Rahmen
drehen.
Das Wasser wird durch die Röhre V zugeführt, in welcher
sich ein Hahn W befindet, der durch einen Hebel mit dem
Schwimmer X gedreht wird. Der Hahn ist so gestellt, daß
er auch dann noch eine ganz geringe Wassermenge durchfließen läßt, wenn der
Schwimmer X
zu seiner größten Höhe
gestiegen ist; mit anderen Worten, der Wasserzufluß aus der Röhre V kann nie gänzlich unterbrochen werden, wie hoch auch
der Wasserstand in dem Behälter B steigen mag. Das Ende
der Röhre V ist so gebogen, daß die Ausflußmündung über
den Kasten T zu liegen kommt.
Um die Wirkung dieses Apparates zu erklären, wollen wir annehmen daß der Wasserstand
im Kessel ein wenig unter die Mündung der Röhre D gefallen ist, und daß sich folglich in der Röhre D, I Dampf befindet. Da beständig Wasser in den Kasten
T zufließt, so bekommt derselbe endlich das
Uebergewicht über das Gewicht R; das lange Hebelende
nimmt bei seiner Abwärtsbewegung die Stangen L, M mit
sich, und öffnet so die Ventile J, K, die dann den Dampf
aus dem Kessel in den Cylinder A strömen lassen. Zu
gleicher Zeit trifft der vorstehende Winkel Y an dem
Kasten T auf den an dem Wasserbehälter B befestigten Aufhälter Z,
so daß der Kasten eine schiefe Lage annimmt, und seinen Inhalt in den Behälter B ausgießt. Nachdem das Wasser ausgeflossen ist, bekommt
das Gewicht R wieder die Oberhand, hebt den leeren
Kasten, und schließt so die beiden Ventile wieder. So lange die Ventile offen waren,
konnte sich der Cylinder A mit dem Dampf füllen, welcher
aber, nachdem sich die Ventile geschlossen haben, augenblicklich condensirt wird, da
der Cylinder A außen mit kaltem Wasser umgeben ist. Das
auf diese Weise hervorgebrachte Vacuum veranlaßt das mit einer Feder versehene
Ventil a sich nach einwärts zu öffnen, so daß sich der
Cylinder A mit Wasser aus dem Behälter B füllt. Die nachfolgende Bewegung des Hebels öffnet die
beiden Ventile I, K wieder, und der Dampf steigt wie
vorhin wieder in der Röhre D, l in die Höhe, drückt auf
die Oberfläche des Wassers im Cylinder A, und zwingt
dasselbe durch die Röhre E in den Kessel abzufließen.
Diese Wirkung erneuert sich periodisch, bis der Wasserspiegel im Kessel über die
Mündung der Röhre D steigt, wodurch der Zutritt des
Dampfes in diese Röhre abgesperrt, und der abwechslungsweisen Condensation im
Cylinder Einhalt gethan wird. In den Kessel gelangt dann kein Wasser mehr, obgleich
sich die Ventile J, K zeitweise öffnen, bis endlich
wieder Dampf durch die Röhre D, I in die Höhe steigt,
wodurch dann dem Kessel wieder wie vorhin Wasser zugeführt wird.
Eine Eigenthümlichkeit dieses Speisungsapparates ist, daß das Spiel der Ventile genau
nach dem Wasserbedarf im Kessel langsamer oder schneller vor sich geht. Sollte z. B.
einmal das Wasser in dem Kessel tief stehen, so werden die periodischen
Dampfcondensationen in
dem Cylinder A rasch vor sich gehen, da das Wasser im
Behälter schnell abnimmt, und der Schwimmer X folglich
den Zuflußhahn weiter öffnet. Der Kasten T wird sich
deßhalb schneller füllen, und in gleichem Verhältnisse das Dampf- und
Wasserventil häufiger öffnen. Damit sich die Ventile leicht öffnen lassen, ist der
Schlitz im Kopfe der Ventilstange M etwas länger
gemacht, als der Hebel hoch ist, so daß, wenn letzterer anfängt sich zu bewegen, er
allein auf das kleine Ventil I wirkt. Da dieses Ventil
nahe am Drehungspunkte des Hebels liegt, so kann der gefüllte Kasten T dasselbe leicht öffnen, und ist es einmal offen, so
hebt der einströmende Dampf den Druck auf das große Ventil auf, welches alsdann von
selbst niedersinkt. Um die zu rasche Entleerung des Gefäßes T und das zu schnelle Indiehöhesteigen desselben zu verhüten, ist eine
verstellbare Deckelplatte b quer über die Gefäßmündung
geschraubt. Durch dieselbe wird der Wasserausfluß verzögert, und der Hebel lange
genug niedergedrückt erhalten, um dem Wasser im Cylinder A die gehörige Zeit zu lassen, in den Kessel übergehen zu können.
Aus dem eben Beschriebenen ist ersichtlich, daß bei dieser schätzbaren Erfindung die
Speisung des Kessels nicht von der Wirkung eines im Kessel angebrachten Schwimmers,
oder einer ähnlichen Vorrichtung abhängig ist, sondern daß sie durch Oeffnen und
Schließen einer offenen Röhre und zwar durch das Steigen und Fallen des Wassers
selbst bewerkstelligt wird. Stellt man den Apparat gesondert auf, und versieht man
denselben mit mehreren Röhrenpaaren, die mit ebenso vielen Dampfkesseln in
Verbindung sind, so kann derselbe zur Speisung mehrerer Kessel verwendet werden. Der
beschriebene Apparat ist seit einiger Zeit in der großen Zeugdruckerei der HHrn. Todd und Higginbotham zu
Glasgow mit dem besten Erfolg im Gebrauch.
Der Erfinder, Hr. Gray, schlug noch zwei Modificationen
vor, wovon die eine durch eine sich beständig drehende Kurbel, welche auf den
Ventilhebel wirkt, thätig ist, während die andere den Hebel gar nicht hat, sondern
ihre Bewegung von Schwimmern erhält, die sich auf einer verticalen Spindel befinden,
welche in dem Condensationscylinder untergebracht ist.
Tafeln