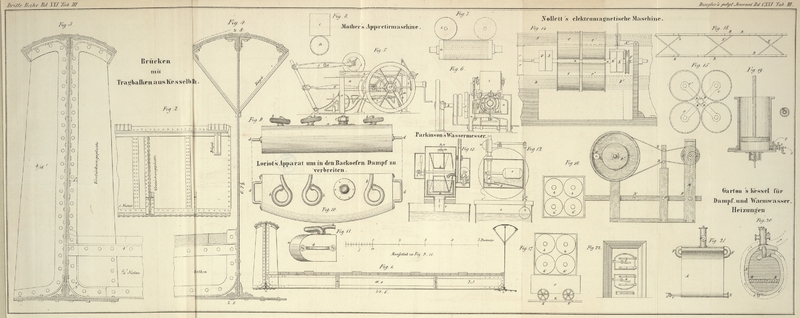| Titel: | Maschine zum Appretiren baumwollener etc. Gewebe, welche sich James Mather und Thomas Edmeston zu Pilkington in Lancashire, am 5. September 1850 patentiren ließen. |
| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. XLV., S. 194 |
| Download: | XML |
XLV.
Maschine zum Appretiren baumwollener etc. Gewebe,
welche sich James
Mather und Thomas
Edmeston zu Pilkington in Lancashire, am 5. September 1850 patentiren ließen.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai
1851, S. 275.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Mather's Maschine zum Appretiren baumwollener etc.
Gewebe.
Das Wesentliche dieser neuen Appretirmethode besteht in der Anwendung einer Walze,
welche auf dem zu behandelnden Zeuge in der Richtung seiner Breite hin- und
herbewegt wird.
Fig. 5 stellt
eine solche Maschine, worin der Zeug seine Vollendung erhält, im Seitenaufrisse,
Fig. 6 in
der Endansicht dar. Die Figuren 7 und 8 sind
besondere Ansichten derjenigen Theile, welche unmittelbar auf den Zeug einwirken.
a, a, a ist das Maschinengestell, b die Hauptwelle, auf welcher ein Stirnrad c befestigt ist, das in ein anderes an einer
Transversalwelle befestigtes Stirnrad greift. An dieser Welle befindet sich eine
Scheibe e, e mit einem Schlitz welcher einen Stift f aufnimmt, der mit einer Lenkstange g verbunden ist. Das andere Ende der letzteren ist mit
dem einen Arme eines schwingenden Rahmens h verbunden.
Dieser Rahmen schwingt unten um eine Achse i und steht
oben mit den Stangen j, j in Verbindung, welche durch
eine Querstange k an einander gekuppelt sind. Die
Stangen j, j nehmen die Achse einer Walze l auf.
Indem nun die Achse d rotirt, setzt der Kurbelzapfen f vermittelst der Stange g
den Rahmen h in Schwingung und ertheilt somit der Walze
l eine vor- und rückwärts gehende Bewegung,
welche hinsichtlich ihrer Ausdehnung durch die Stellung des Zapfens f in seinem Schlitze regulirt werden kann. An beiden
Enden des Gestells befindet sich ein Träger m mit
Lagern, welche auf- und nieder verschiebbar sind, und die Achse der
Längenwalze n, n aufnehmen. Diese Lager liegen auf
Schrauben o, welche in Muttern laufen, die an das
Maschinengestell befestigt sind. Durch Umdrehung dieser Schrauben kann die Walze n, n gehoben oder niedergelassen und in einer
horizontalen Richtung adjustirt werden. Eine an der Querwelle p, p befestigte endlose Schraube q, u greift
in die Zähne eines Schraubenrades v, welches an einem
Ende der Achse der Walze n gelagert ist.
Die Welle p enthält ferner ein Sperrrad r, in dessen Zähne von einem um p lose drehbaren Hebel s aus ein Sperrkegel
fällt. An eine der Stangen j ist eine Hervorragung t befestigt, welche, indem sie auf diese Weise
gleichzeitig mit der Walze l vorwärts getrieben wird,
mit dem Hebel s in Berührung kommt, und auf diese Weise
den Sperrkegel veranlaßt dem Sperrrade r eine partielle
Drehung zu ertheilen, welche durch Vermittelung der Schraube q und des Rades v eine langsame Drehung der
Walze n zur Folge hat. Bei der rückgängigen Bewegung der
Walze l gestattet der Theil t dem Hebel s vermöge des Gewichtes u seine vorherige Lage wieder einzunehmen.
Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Der zu behandelnde Zeug wird auf die
Walze n, n gerollt. Zu diesem Zweck hebt man die Walze
l in die Höhe und schraubt die Walze n, n nieder; hierauf schraubt man die letztere wieder in
die Höhe und läßt die Walze l mit ihrem eigenen Gewichte
auf die Zeugwindungen drücken. Setzt man nun die Hauptwelle in Rotation, so bewegt
sich die Walze l auf der Oberfläche des auf der Walze
n aufgewickelten Zeuges hin und her. Bei jeder
Vorwärtsbewegung kommt der Theil t mit dem Hebel s in Berührung und ertheilt mit Hülfe des Sperrrades r der Walze n, n eine langsame
Rotation, wodurch ein neues Stück der Zeugfläche unter die Walze kommt So geht die
Operation fort, bis eine genügende Pressung stattgefunden hat, um dem Zeug die
verlangte Vollendung zu ertheilen. Da sich die Walze in der Richtung der Breite des
Zeugs bewegt, so wird derselbe zugleich gestreckt. Das auf diese Weise zu
behandelnde Fabricat kann in feuchtem oder trockenem Zustande auf die Walze n gebracht werden; man kann es auch der Einwirkung der
Wärme aussetzen, indem man die Walze von innen mit Dampf erwärmt.
Soll diese Maschine zum Waschen oder Walken von Wollenzeugen angewendet werden, so
setzen wir die Walze n in einen Trog und lassen einen
Theil ihrer Pheripherie in Seifenwasser tauchen, welches durch Anwendung von Dampf
auf der geeigneten Temperatur erhalten wird.
Tafeln