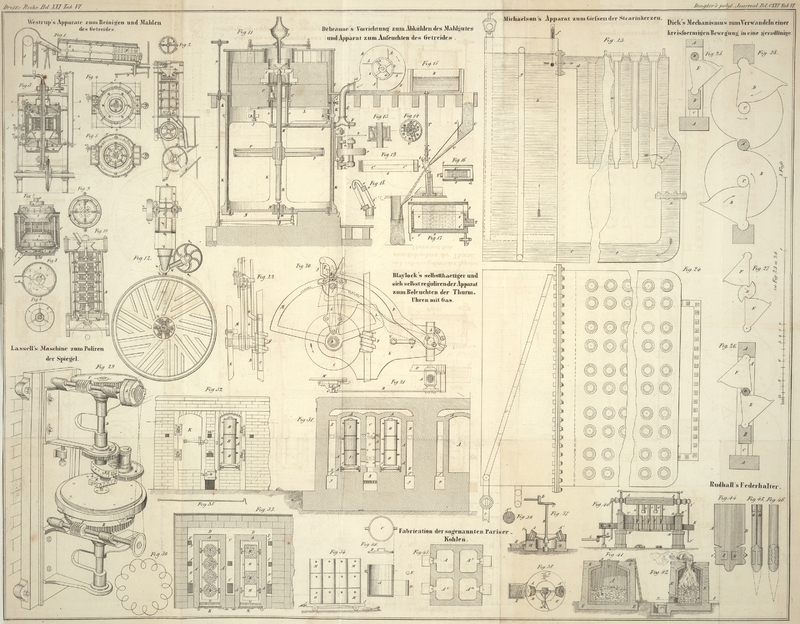| Titel: | Apparate zum Reinigen und Mahlen des Getreides, welche sich Walter Westrup in Wapping, Grafschaft Middlesex, am 24. Jan. 1850 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 121, Jahrgang 1851, Nr. C., S. 408 |
| Download: | XML |
C.
Apparate zum Reinigen und Mahlen des Getreides,
welche sich Walter
Westrup in Wapping, Grafschaft Middlesex, am 24. Jan. 1850 patentiren ließ.
Aus dem London Journal of arts, Jan. 1851, S.
1.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Westrup's Apparate zum Reinigen und Mahlen des
Getreides.
Fig. 1 stellt
den vollständigen Reinigungsapparat für das Korn im
verticalen Längendurchschnitt dar. Das Getreide wird durch den Hebeapparat A aus einem tiefer gelegenen Behälter in die geneigte
Rinne a, a gehoben, durch welche es in das Innere eines
großen horizontalen cylindrischen Apparates gelangt. Dieser Apparat besteht aus
einem durchlöcherten Cylinder B, B, welcher vermittelst
der Arme c, c, c an eine geneigte Welle b, b, b befestigt ist. Die Durchlöcherungen des
Cylinders B, B sind zweierlei Art, nämlich längliche
Schlitze und kreisrunde Löcher, durch welche die zerbrochenen oder schadhaften
Körner, sowie Staub, kleine Samenkörner und andere fremdartige Theile leicht fallen
können, während die gesunden Körner zurückbleiben. Durch eine an dem Ende der Achse
B befindliche Riemenrolle wird die rotirende
Bewegung auf den Cylinder B übertragen. Dieser Cylinder
ist von einem festen Gehäuse e, e umgeben, welches alle
durch die Löcher des Cylinders B gegangenen Substanzen
aufnimmt. Der innere Cylinder ist nicht stark geneigt, damit das Korn langsam von
einem Ende zum andern hinabgleitet. An der äußeren Fläche des Cylinders B sind Längenrippen. f, f, f
angebracht, welche sich von dem einen bis zu dem andern Ende des Cylinders
erstrecken. Diese Rippen sind mit einer Reihe geneigter Wischer (Wipers) g, g versehen,
welche die schadhaften Körner und fremdartigen Substanzen während der Rotation des
Cylinders allmählich gegen die Mündung h, h vorwärts
schieben, durch welche sie in einen untergestellten Behälter fallen. Das Getreide
aber fällt von dem Ende des Cylinders B auf ein endloses
Tuch, welches dasselbe nach dem Trichter oder Rumpf k
der Reinigungsmaschine leitet. Diese besteht aus einem senkrechten Cylinder von
Eisenblech, welcher an seiner inneren Seite rauh gearbeitet ist. Das Korn fällt
zunächst auf eine conische Platte I, welche oben an die
verticale Achse m befestigt ist. Die Oberfläche dieser
Platte I ist cannelirt, und reibt sich bei erfolgender
Umdrehung der Achse m gegen die unteren Seiten der festen Bürsten n, n, welche ihrerseits das auf die Platte I fallende Korn mit beträchtlicher Kraft gegen die rauhe
Oberfläche der Platte reiben. Das Korn fällt nach dieser Operation auf eine
horizontale kreisrunde Scheibe o, deren an der
verticalen Achse m mehrere übereinander angebracht sind.
Diese Platten sind aus Holz und mit gerieftem Eisenblech beschlagen. Zwischen je
zwei Scheiben o befinden sich vier an die Verticalachse
m befestigte und gleichfalls mit gerieftem
Eisenblech beschlagene Windflügel oder Arme p, p.
Unmittelbar unter der Kante jeder Scheibe o befindet
sich im Inneren des Cylinders C ein hölzerner ebenfalls
mit gerieftem Eisenblech beschlagener Ring q. Das durch
die Bürsten n, n bereits bearbeitete Korn fällt auf die
rauhe Oberfläche der ersten Scheibe o und wird von da in
Folge der durch die rasche Drehung der Achse m erzeugten
Centrifugalkraft gegen die rauhen Seiten des Cylinders C
geschleudert. Das Korn fällt sodann zwischen die Peripherie der Scheibe o und den schrägen Rand des Ringes q, wo es wieder gerieben wird, um gleich darauf durch
die Flügel p wieder gegen die rauhe Cylinderfläche C geworfen zu werden; von da fällt es auf die zweite
Scheibe o, wo sich die nämliche Operation wiederholt,
bis das Korn den Boden der Maschine erreicht. Die rotirenden Bürsten n* fegen sofort das Korn durch den Canal h* in eine Kammer, wo es einem kräftigen durch den
Ventilator r erzeugten Luftstrome ausgesetzt wird.
Dieser Luftstrom führt allen durch die vorhergehende Operation von dem Korn
getrennten Abfall und Staub durch eine Röhre ins Freie. Das gereinigte Korn aber
fällt auf ein geneigtes Sieb B*, durch welches die
kleineren Körner fallen, während die größeren Körner die Röhre A* hinab in einen untergestellten Behälter gleiten.
Der verbesserte Apparat zum Mahlen des Korns ist in Fig. 3 im
mittleren Verticaldurchschnitt, in Fig. 4 im
Horizontaldurchschnitt nach der Linie 1, 2 von Fig. 3, und in Fig. 5 im
Horizontaldurchschnitt nach der Linie 3, 4 von Fig. 3 dargestellt. Bei
dieser Anordnung werden zwei Paar Steine angewendet; die unteren Steine E, E sind die Läufer und an eine hohle Verticalwelle F über einander befestigt. Die mahlende Fläche der
Steine E ist conisch, und von dem Läuferauge gehen
Seitenlöcher durch die Steine nach den mahlenden Flächen, um diese durch die
herbeigeleitete Luft kühl zu erhalten. Zur Erleichterung dieser Operation ist die
Welle F hohl und wird durch eine Röhre von oben mit Luft
versehen. Die Luft gelangt durch Seitenlöcher, welche mit dem Inneren der Welle
communiciren, in das Läuferauge. Die oberen Steine G, G
sind stationär und ringförmig; ihre Mahlflächen haben eine der conischen Oberfläche
der Läufer entsprechende Neigung. Der bequemen Adjustirung wegen sind die oberen Steine in ringförmigen
Gestellen s, s gelagert, welche vermittelst der
hervorragenden Theile 1, 1, 1 (Fig. 4, 5 und 7) auf einem an das
Gestell befestigten Rande 2, 2, 2 liegen. Diejenigen Theile des Randes 2, 2, 2,
worauf die Hervorragungen 1, 1, 1 liegen, sind, wie am deutlichsten aus Fig. 7 zu
entnehmen ist, schräg, so daß einfach durch die horizontale Drehung des Gestells s, s der Stein mit der größten Genauigkeit nach der
Oberfläche des Läufers adjustirt werden kann. Um nun diese Adjustirung zu
bewerkstelligen, befindet sich an der Peripherie des Ringgestelles s, s eine kleine Verzahnung t, in welche eine endlose Schraube u greift.
Das eine Ende dieser Schraube enthält ein Winkelgetriebe, welches in ein ähnliches
an dem oberen Ende der Verticalachse v befindliches
Getriebe greift; die Achse v aber wird mit Hülfe eines
ähnlichen Paares von Winkelgetrieben und des Handrades w
in Umdrehung gesetzt. Die Adjustirung des unteren Mühlsteinpaares ist derjenigen des
oberen vollkommen analog. Das zu mahlende Korn gelangt durch die Röhre H in den Apparat; die Zuführung wird durch eine
Schieberröhre x regulirt, welche das untere Ende der
Röhre H umschließt, und mit Hülfe eines Hebels y auf- und niederbewegt werden kann. Von dem
andern Ende des letztern erstreckt sich nämlich eine lange Stange z abwärts, die an ihrem unteren Ende mit Schraubengängen
versehen ist, und vermittelst eines Handrades und einer Daumenschraube sich höher
und niedriger stellen läßt. Indem nun in Folge dieser Bewegung die untere Kante der
Schiebröhre der runden Scheibe 3 sich nähert oder von derselben entfernt, kann der
Zufluß des Korns nach Belieben regulirt werden. Das Korn fällt durch die Röhre x in die Speisungsbüchse, und von da durch die Röhre 4
in die Büchse 5 unmittelbar über das Auge des oberen Steins. Von der Büchse 5
gelangt das Korn zwischen die Mahlflächen der Steine G
und E, und wird durch diese zum Theil schon in Mehl
verwandelt. Dieses fällt auf die conisch geneigte Fläche 6, 6 und gelangt von da in
einen Drahtcylinder 1, 1, worin eine Anzahl an der Hauptwelle F befestigter Bürsten rotirt. Diese Bürsten treiben das Mehl durch die
feinen Maschen des Drahtgewebes, worauf das Mehl die geneigte Fläche 8, 8 hinabfällt
und in der Kammer J sich sammelt. Das unvollständig
gemahlene Mehl wird dagegen durch die geneigte Fläche 9, 9 zwischen das zweite Paar
Steine (Fig.
3) geleitet. Durch diese zweite Operation wird das Mehl vollständig gemahlen.
Von dem zweiten Steinpaar fällt das Mehl in die Kammer J, wo es sich mit dem von dem ersten Steinpaar kommenden Mehl vereinigt. Die
Trennung des Mehls nach dem Mahlen durch die oberen Steine hat den Zweck, das bereits erzeugte
Mehl nicht nutzlos durch das zweite Steinpaar gehen zu lassen. Am Boden der Kammer
J befindet sich an der verticalen Treibwelle eine
Scheibe K, auf welche das Mehl fällt. Durch die Rotation
der letzteren wird das Mehl gegen den Arm 10, Fig. 7 und 8, getrieben, welcher
dasselbe in den Canal 11 streift, der es in einen untergestellten Behälter leitet.
Unterhalb der rotirenden Scheibe K sind mehrere durch
Punktirungen in Fig.
8 angedeutete krumme Arme angebracht, welche das etwa unter die Scheibe
gerathene Mehl gleichfalls in den Canal 11 streifen. Es versteht sich von selbst,
daß die wirksamen Haupttheile von einem Mantel N aus
Canevas umschlossen sind, um das Wegstäuben des Mehls zu verhüten. Die Bewegung wird
vermittelst des conischen Räderwerks L, L, Fig. 3, auf die
Haupttheile übertragen.
Fig. 9 stellt
die Maschine zum Reinigen des Mehls im
Horizontaldurchschnitt, Fig. 10 im
Verticaldurchschnitte dar. Das Neue dieser Anordnung besteht in einer Reihe
kreisrunder Scheiben o, o, o, welche zwischen den
Bürsten an der Verticalachse m befestigt sind. Das Mehl
gelangt oben in die Maschine und fällt auf die erste Scheibe o, von welcher es durch die Centrifugalkraft gegen das Drahtgewebe des
Cylinders C getrieben wird. Die Bürsten p treiben sofort das feinere Mehl durch die Maschen des
Cylinders. Derjenige Theil des Mehls, welcher der Einwirkung der ersten Bürstenreihe
entgeht, fällt über den Rand der ersten Scheibe o auf
den geneigten Rand des Ringes q, welcher das Mehl auf
die zweite Scheibe o leitet, die es der zweiten
Bürstenreihe zur Bearbeitung zuführt; und so wiederholt sich die Procedur in den
übrigen Abtheilungen, bis alles Mehl von der Kleie getrennt und durch die Maschen
des Cylinders gegangen ist. Die Maschine ist von einem Mantel M, M umschlossen, und das durch den Draht- oder Seidenflor
getriebene Mehl wird auf gewöhnliche Weise aus dem Apparat geleitet, die Kleie aber
durch die rotirenden Bürsten n* durch den Canal h* aus dem Cylinder hinausgebürstet. — Ein
bedeutender Einwurf, der sich den verticalen Reinigungsmaschinen gewöhnlicher
Construction machen läßt, besteht in der großen Geschwindigkeit, mit der sie
umgetrieben werden müssen und dem daraus resultirenden Kraftverlust; ferner darin,
daß ein Theil des Mehls ungesiebt durch die Maschine geht, wenn die Geschwindigkeit
aus irgend einer Ursache plötzlich sich vermindern sollte. Bei der vorliegenden
Anordnung find jedoch diese Uebelstände beseitigt, indem hier kein Grund vorliegt,
die Maschine mit größerer Geschwindigkeit als die gewöhnlichen schiefliegenden
Cylinder umlaufen zu lassen. Denn es ist keine Gefahr vorhanden, daß irgend ein Theil des Mehls
ungereinigt durch die Maschine gehe, indem es selbst bei völligem Stillstand durch
die Scheiben o verhindert wird ungereinigt tiefer
herabzufallen.
Tafeln